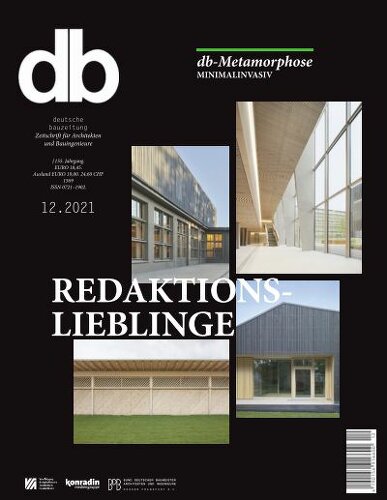Editorial
Die Tour zu den Lieblingen der db-Redaktion gehört im Dezember-Heft längst zur lieb gewonnenen Tradition für die Leser und die Redakteure. Und so machten wir uns auch 2021 wieder auf. Corona bedingt schweiften wir allerdings dieses Jahr nicht in die Ferne, sondern reisten nach Köln, Schwäbisch Hall, Lochau am Bodensee und Pforzheim. Folgen Sie uns auf den nächsten Seiten zum Historischen Archiv Köln, zu einem Kindergarten und einem Jugendzentrum und kommen Sie mit zum Abbaden ins Freibad. Alle Projekte stellen wir Ihnen unter dem gewohnt architekturkritischen Blickwinkel der db vor. | Die Redaktion
Das Gedächtnis der Stadt
(SUBTITLE) Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv in Köln
Mehr als zwölf Jahre nach dem Einsturz des Historischen Archivs konnte in Köln der Neubau bezogen werden. Den Architekten ist es gelungen, ideale Bedingungen nicht nur für die Archivalien, sondern auch für die Mitarbeitenden zu schaffen. Und auch der neue Standort macht deutlich: Das Archiv ist ein Ort, der sich zur Stadtgesellschaft öffnet.
Der 3. März 2009 gilt als der Tag eines des größten kulturellen Desasters Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg: Das Historische Archiv der Stadt Köln stürzte ein und versank in der offenen Baugrube der Nord-Süd-U-Bahn. Zwei Menschen starben, 30 Regalkilometer Akten wurden im Grundwasser verschüttet. Dank einer sofort einsetzenden Rettungsaktion gelang es, 95 % der Archivalien zu bergen, zum großen Teil gefrierzutrocknen und auf diverse auswärtige Depots, sogenannte Asylarchive, zu verteilen. Die Restaurierung der Bestände, so die derzeitige Prognose, wird bis zum Jahr 2060 andauern. Die Herausforderung für die Archivarinnen und Archivare besteht aber nicht nur in der physischen Wiederherstellung der Akten, sondern auch in deren Zuordnung. Denn auch die Archivstruktur wurde komplett zerstört, sodass eine klassische Systematik nicht mehr existiert und einzelne Objekte nur bedingt Beständen zugewiesen werden können. Auch wenn die beteiligten Baufirmen inzwischen zu einer Zahlung von 660 Mio. Euro verpflichtet wurden – der gesamte materielle Schaden wird auf 1,3 Mrd. beziffert.
Fahrlässigkeit, Pfusch am Bau, Kölscher Klüngel: Darüber ist hier nicht zu urteilen. Zu konstatieren indes bleibt, dass das historische Gedächtnis der Stadt, das selbst die Zerstörung Kölns im Zweiten Weltkrieg unbeschadet überdauert hat, für mehr als eine Generation von Forschern und Nutzern kaum ernsthaft konsultierbar ist. Angesichts dieser Ausgangslage mag es zynisch anmuten, der Katastrophe auch positive Aspekte abzugewinnen. Und doch, der Neubau des Archivs, das Anfang September 2021 eröffnet wurde, ist schlicht erfreulich. Und ein Gewinn für die Stadt, auch wenn seit dem Wettbewerb 2011 zehn Jahre vergangen sind. Immerhin sind mit 90 Mio. Euro die Kosten im Rahmen geblieben.
Wirkte die in die Severinstraße eingebundene Granitfassade des Bestandsgebäudes mit ihren spärlichen Lichtschlitzen hermetisch und abweisend, so gibt sich der 3 km entfernte Neubau dezidiert als öffentliches Gebäude zu erkennen. Darin bildet sich einerseits das veränderte Selbstverständnis von Archiven ab, die sich nicht zuletzt aus Gründen politischer Legitimation weniger als Verwahrinstitutionen denn als Serviceeinrichtung für Forschende, aber auch für die interessierte Bevölkerung verstehen, andererseits wäre es ohne die Vorgeschichte der Katastrophe wohl kaum zu einem solchen Bau an diesem Ort gekommen: In Hannover beispielsweise hat man sich unlängst dazu entschieden, das Stadtarchiv zusammen mit diversen Museumsdepots an einem unwirtlichen Ort in Stadtrandlage durch Investoren erstellen zu lassen und dann zu mieten. Eine solche Lösung wäre in Köln nicht in Frage gekommen. Der Standort ist attraktiv – der Neubau steht dort, wo die nach Südwesten führende Luxemburger Straße, eine der für Köln typischen ins Umland ausstrahlenden Radialachsen, den Inneren Grüngürtel begrenzt. Während die Straße Eifelwall mit ihrer Wohnbebauung die gründerzeitliche Stadtkante darstellt, ist das Archiv nicht als direktes Gegenüber, sondern eher als Solitär im Park konzipiert, ähnlich wie die verschiedenen Institute der nahen Universität weiter im Norden. Der Bau eines die Achse fortsetzenden Studierendenwohnheims im Süden ist bisher unterblieben, sodass der solitäre Charakter des Neubaus stärker in Erscheinung tritt als ursprünglich geplant.
Hülle und Kern
Die Darmstädter Architekten Waechter + Waechter konnten die Jury mit dem stringenten Konzept einer vierseitigen orthogonalen Mantelbebauung überzeugen, die ein zentrales Schatzhaus umgibt, das eigentliche Magazingebäude. Zur Zeit des Wettbewerbs bestand die Idee, im Neubau drei Institutionen zusammenzufassen: das Historische Archiv selbst, das Rheinische Bildarchiv und die Kunst- und Museumsbibliothek, die auf zwei Standorte, das Museum Ludwig und das Museum für Angewandte Kunst aufgeteilt ist. Aus Kostengründen fiel 2003 die Entscheidung, die Bibliothek an diesen Standorten zu belassen. Somit wird der Neubau von Historischem Archiv der Stadt Köln und Rheinischem Bildarchiv genutzt, die verwaltungstechnisch und institutionell eigenständig bleiben, aber die Räume mit Besucherverkehr wie Lesesaal, Auditorium und Ausstellungsbereich gemeinsam nutzen. Eine modulare Metallfassade mit tiefen Rippen, die als Brise-Soleils dienen, vereinheitlicht umlaufend den 126 langen und 45 m breiten dreigeschossigen Baukörper. Zur Stadt hin verhält sich das Gebäude nicht anders als zum Park, was seine Eigenständigkeit unterstreicht. Je nach Perspektive zeigt es sich offen oder geschlossen; lediglich die Erdgeschosszone der nordwestlichen Stirnseite ist komplett verglast. Hier, zum neu entstandenen Vorplatz hin orientiert, findet sich der Eingang für die Nutzerinnen und Nutzer, die in ein überaus helles und freundliches zweigeschossiges Foyer eintreten. Die dunkle Metalloptik des Äußeren weicht dem hellen Farbton weiß geölten Douglasienholzes, das die öffentlichen Bereiche prägt: Ausstellungsraum und Vortragssaal im EG sowie den großzügigen Lesesaal, den man über eine Treppe erreicht und der die gesamte Gebäudebreite im 1. OG in Anspruch nimmt. Zur freundlichen und hellen Atmosphäre trägt der Ausblick in den vorderen Innenhof bei, der rückwärtig durch den geschlossenen, mit aufgefalteter Baubronze bekleideten Magazinbaukörper begrenzt wird. Ein weiterer, schmalerer Innenhof befindet sich dahinter, sodass das Magazin zu zwei Seiten hin wirkungsvoll in Erscheinung treten kann. Die hofseitigen Korridore laufen auf allen Geschossen durch und bilden die klare Erschließung für die diversen Werkstätten, Restaurierungsateliers und Büros, die sämtlich nach außen hin orientiert sind. Die Organisation des Gebäudes ist streng funktional und erschließt sich unmittelbar, sobald man das Gebäude betritt: Die nordwestliche Stirnseite ist der öffentliche Teil des Baus mit der Verwaltung im 2. OG, während die Anlieferung der Archivalien über den Eifelwall und die Zufahrt auf der südöstlichen Stirn erfolgt, wo sich auch Quarantänebereiche befinden, durch die das Einbringen von Schädlingen verhindert wird.
Verhaltene Zeichenhaftigkeit
Herz und Zentrum des Gebäudes bildet der Magazinbau, der auch zu den Korridoren hin mit Platten aus Baubronze bekleidet ist. Mittig durch Gänge erschlossen, gliedern sich die insgesamt sieben Magazingeschosse mit ihren Ausmaßen von 56 x 27 m jeweils in vier gleich große Räume, die weitgehend mit Rollregalsystemen, aber auch mit Planschränken und Aufbewahrungssystemen für diverse Medien ausgestattet sind. Standardarchivboxen, die sich zu einer maximalen Länge von 50 Regalkilometern reihen, um für zukünftige Jahrzehnte gewappnet zu sein, bildeten gewissermaßen das repetitive Grundmodul, das schließlich zu Form und Dimension des Kernbauwerks führte. Die Wände bestehen aus 30 cm, die Decken aus 32 cm dickem Stahlbeton, sodass eine maximale thermische Trägheit erzielt wird. Da Materialien mit unterschiedlichen konservatorischen Anforderungen gelagert werden, gliedern sich die Archivbereiche in sieben unterschiedlich temperierte Klimazonen. Die Massivität der Bauweise, die Unterteilung in überschaubare Einheiten und die Fensterlosigkeit erlaubten es, das Thema des Brandschutzes auf passive Weise anzugehen und auf für Akten desaströse Sprinkler oder Hochdrucksprühsysteme und für Menschen gefährliche Sauerstoffeliminationsanlagen zu verzichten. Zur Wärme- respektive Kälteversorgung dient neben Fernwärme ein Eisspeicher unter dem großen vorderen Hof: Eine Wärmepumpe entzieht dem Wasser im Behälter Wärme, sodass dieses gefriert und die Kälteenergie im Sommer für die Lüftung genutzt werden kann. Archivgüter finden sich nicht nur im Magazinbaukörper, sie werden auch in anderen Bereichen des Hauses restauriert, genutzt oder bearbeitet. Das erklärt die umlaufenden tiefen Brise-Soleils – aber auch die Tatsache, dass die Höfe zwecks Vermeidung des Eintrags von Feuchtigkeit oder Wärme in die Raumluft nicht betreten werden dürfen.
Waechter + Waechter ist es gelungen, ein funktional im besten Sinne stringentes und zudem im wahrsten Sinne des Wortes einleuchtendes Gebäude zu realisieren, das sehr gute Bedingungen für das Archivgut schafft, aber auch auf die Befindlichkeiten der durch die Katastrophe traumatisierten Mitarbeiter Rücksicht nimmt. Ein Archiv mit Tiefmagazin wäre angesichts des Grundwasserdesasters von 2009 undenkbar gewesen. Das der zentrale Archivschrein nun sichtbar die Mantelbebauung überragt, ist ein willkommener Nebeneffekt. So himmelsstürmend und zeichenhaft wie der Ziegelsteinpfeiler von Ortner & Ortner gibt sich das Gebäude in Köln nicht, doch städtebaulich präsent ist es auf jeden Fall. Und Präsenz zu markieren, steht diesem Gebäude, das das Gedächtnis der Stadt bewahrt, gut zu Gesicht.db, Di., 2021.12.07
07. Dezember 2021 Ulrike Kunkel
Zur Nachahmung empfohlen
(SUBTITLE) Kindertagesstätte in Schwäbisch Hall-Hessental
Öffentliches Bauen hat seine Vor- und Nachteile. Wenn Bauherr, Nutzer und Architekt Hand in Hand arbeiten, kann sich das sehen lassen. Mit dem Kinderhaus in Schwäbisch Hall entstand ein Gebäude, das Kindern und Eltern Freude macht, dem Personal die Arbeit erleichtert und auch der Umgebung gut zu Gesicht steht.
Die »Tageseinrichtung für Kinder am Solpark« befindet sich in Schwäbisch Hall-Hessental, dem größten Stadtteil der, anders als der Name es vermuten lässt, eher fränkisch geprägten Stadt. Wie viele Kommunen kommt auch die große Kreisstadt dem Andrang an Kinderbetreuungsplätze kaum hinterher. Hier sind bekannte große Arbeitgeber sowie zahlreiche »Hidden Champions« angesiedelt. Bei den steigenden Miet- und Baupreisen ist einigen auch die gute Stunde Fahrt bis Stuttgart einen Umzug ins Hohenlohische wert. Die Einwohnerzahlen steigen, die Kitaplätze sind knapp – kein seltenes Bild. Ein schwarzer Kindergarten dagegen schon.
Auf den ersten Blick ist die Lage des 2020 eröffneten Kinderhauses zugegeben nicht besonders einladend: Zur einen Seite ein Industriegebiet, nicht weit vom Flugplatz, zur anderen Seite typische Neubaugebiete. Doch durch eben diese Neubaugebiete und auch für die Angestellten der zahlreichen Firmen besteht genau hier Bedarf. Zudem schimpft ein Fachhandel für Elektromotoren wohl eher weniger über spielende Kinder. Und dann wartet das Grundstück natürlich mit dem größten Pluspunkt auf: Platz. Sicher hätte man auf weniger Fläche auch bauen können, eine eingeschossige Anlage bietet aber insbesondere bei Kindergärten mehrere Vorteile: Komplizierte Rettungswege entfallen, Treppengitter und andere Sicherungsmaßnahmen sind nicht nötig, alle haben gleichermaßen Zugang zum Garten, auch ein Treffen und Mischen der Gruppen ist – sofern die aktuelle Pandemie es zulässt – wesentlich einfacher. »In der ersten Euphorie plant man eine Rutsche von einem Geschoss ins andere, aber in der Realität ist das alles viel zu kompliziert«, sagt Architekt Wolfgang Borgards.
Auffällig unauffällig
Zwischen den Werkshallen, Büros und etwas weiter weg den Wohnhäusern entdeckt man den eingeschossigen Baukörper gar nicht sofort. Wenn man den schwarzen Holzbau aber gefunden hat, passt dieser doch genau so hierhin und wirkt alles andere als unscheinbar. Die dunkle Fassade ist ungewöhnlich, vor allem für ein Kinderhaus. Wolfgang Borgards vergleicht sie mit einem »etwas größeren Gartenzaun«. Er darf das sagen, sein Büro K9 Architekten hat das Kinderhaus entworfen. Durch die Holzmaserung, die hellen Einschnitte, großzügigen Fenster und die angedeuteten Giebel erhält es einen einladenden, fast schon warmen Charakter. In das doch zahlreich vorhandene Grün der Umgebung fügt sich das Schwarz wunderbar ein und fällt ins Auge, ohne sich aufzudrängen. Die weißen Fenster – wegen des Witterungsschutzes aus Aluminium – wirken auf dem dunklen Hintergrund fast noch ein bisschen weißer. Die Dachaufsätze geben dem Baukörper Struktur und lassen ihn beinahe wie kleine Häuser wirken, was sich im Innern noch deutlicher abzeichnet. Die Flachdächer sind begrünt, auf den Schrägdächern befinden sich Solarpaneele.
Während das Haus zur Straße und zu den Seiten noch nicht viel preisgibt, öffnet es sich auf der Gartenseite umso mehr. Die Flügel rahmen den Garten ein, alles scheint nach draußen zu drängen. Durch die großen Einschnitte und Rücksprünge sind die Fenster und Türen hier geschützter und daher in Lärchenholz ausgeführt. Das macht das Ganze noch wärmer und irgendwie auch kindgerechter. Im Mittelpunkt der Außenanlage steht das obligatorische Klettergerüst, auffällig und prägend sind aber auch die zwei riesigen erhaltenen Apfelbäume. Eine Saftpresse war zum Zeitpunkt der Besichtigung gerade bestellt, die ersten Apfelkuchen bereits mit den Kindern gebacken. Ursprünglich sollte ein dritter Baum erhalten bleiben, dieser stand dann aber doch zu nah an der Fassade der Kleinkindgruppe und wurde durch einen neu gepflanzten ersetzt. Am Rand verläuft eine »Rennstrecke«, die mit ihrer geringen Steigung ideal für Bobbycar, Roller und Co. geeignet ist. Bis auf das Klettergerüst ist der Außenbereich eher frei und lässt Platz für eigene Spiele und Ideen. Auch die Trennung zwischen den über und unter Dreijährigen fällt mit einem kleinen Höhenunterschied sehr dezent aus. Beide Bereiche haben eigene vorgelagerte Terrassen. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man in den Holzfassaden mehrere Türen, die praktische Lagerflächen beherbergen. Die Frage nach Gestaltung oder Funktion wird im Kinderhaus mit einem klaren »beides!« beantwortet.
Schloss oder Dorf?
Der großzügig bemessene, helle Eingang lädt mit einer langen Bank, zum Verweilen ein, obwohl es sich lohnt, hineinzugehen. Die drei Satteldächer – zwei an der Straßenfront, eines am hinteren Teil – lassen die Struktur schon etwas erahnen. Die kleinteilige Gliederung erinnert an ein Dorf, die Architekten reden auch von Schlossflügeln. Das klingt etwas sehr herrschaftlich, macht aber durchaus Sinn. Das erste »Haus« beherbergt den gemeinschaftlich genutzten Teil. Wenn nicht gerade coronabedingt die Hintertüren genutzt werden müssen, kommen die Kinder hier an und verteilen sich auf die Gruppen. Dieses Foyer ist relativ groß bemessen und kann für Veranstaltungen sogar noch größer werden, indem der daran anschließende Essensraum zugeschaltet wird. In Anbetracht der drei Krippengruppen (unter drei Jahre) im hinteren Haus und vier Ü3-Gruppen im zweiten vorderen Haus mit Platz für insgesamt 130 Kinder macht es aber durchaus Sinn. Dank der Dorf-, Häuser- oder Schloss-Struktur hat man nie das Gefühl der Massenabfertigung, es verläuft sich.
Zwischen den Häusern befinden sich die Flure, Garderoben und Nebenräume wie Sanitärbereiche oder Büros. Die Flure sind teilweise lang, dank Oberlichtern sowie bewusst platzierten Öffnungen und Blickachsen aber immer hell und freundlich. Wie schon die Fassaden, sind auch die Innenräume sehr geradlinig gestaltet, aber nie kahl oder kühl. Diese Einrichtung ist für Kinder gemacht, ohne das permanent herauszuschreien.
Farbe kam selbstverständlich auch zum Einsatz: In den Gruppen- und Gemeinschaftsräumen befinden sich meist vollflächig über eine Wand verteilt Einbauschränke, die mit fröhlichen, jedoch nicht zu grellen Farben akzentuiert sind. Während der Kleinkindbereich über klassische Gruppentrennungen verfügt, die durch Glastüren verbunden sind, gilt im Ü3-Bereich ein offenes Konzept. Die Räume sind nicht den Kindern zugeordnet, sondern den Funktionen. So suchen sich die Kleinen aus, ob ihnen eher nach Theater, Atelier oder Baustelle ist. Insgesamt hat man das angenehme Gefühl, dass sowohl der Innen- als auch der Außenbereich die Bühne für die Kinder ist; welches Stück gespielt wird, entscheiden sie selbst. Die Räume geben nicht zu viel vor, bieten aber jede Menge Möglichkeiten. Auch das Gebäude selbst soll als Inspiration und gutes Beispiel dienen. »Ich finde den Gedanken schön, dass die Kinder sagen: ›Ich hab hier ein einigermaßen schönes Haus, einen Holzbau, so geht Bauen auch‹‹ sagt Wolfgang Borgards. Vielleicht wird hier ja auch der eine oder andere Baumeister groß, den passenden Architektentisch gibt es im Baustellenzimmer bereits.
Selbstverständlich dreht sich vieles um die Kinder, gute Arbeitsbedingungen für das Personal sind aber ebenfalls wichtig. Ein schönes Beispiel, wie hier an Kinder und Erzieherinnen gleichermaßen gedacht wurde, sind die sogenannten Schleusen: Großzügig bemessene, helle Bereiche mit viel Platz für Gummistiefel und Matschhosen sowie die direkt angeschlossenen kleinen Sanitärräume machen den Kleinen Spaß und den Großen die Arbeit leichter.
Zufriedenheit auf allen Seiten
Dass hier alle berücksichtigt wurden, liegt u. a. an der guten Zusammenarbeit von Architekturbüro, Bauherr und Kinderhaus. Von Anfang an – den offenen Wettbewerb gewannen K9 Architekten 2017 – wurden alle Beteiligten mit ins Boot geholt. Doch es wäre kein öffentliches Bauen, wenn es nicht auch Kompromisse gäbe. Gerne hätten die Architekten in den Gruppenräumen die gleichen hochwertigen Holz-Akustikdecken wie in den Gemeinschaftsräumen verwendet und auch die Industrie-Oberlichter waren nicht die erste Wahl. Im Endeffekt war es ein Abwägen, an welchen Stellen der Mehrwert besser eingesetzt war. Das Ergebnis ist ein wirklich schönes Haus – mit Gestaltungswillen und ästhetischem Anspruch, jedoch ohne Eitelkeiten.db, Di., 2021.12.07
07. Dezember 2021 Anke Geldmacher