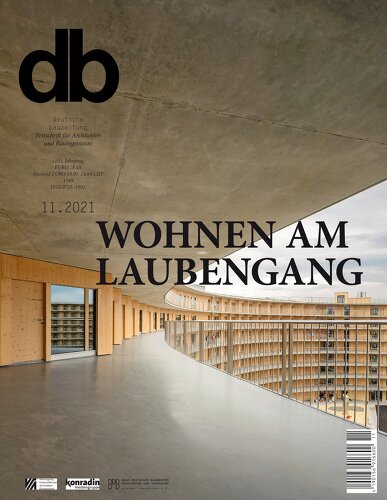Editorial
Einmal im Jahr widmen wir dem Wohnen ein ganzes Heft – machen Wohngebäude doch einen nicht unerheblichen Teil der gebauten Umwelt aus. Dennoch hat Wohnungsbau oft kein besonders aufregendes Image und der hier thematisierte Laubengang erst recht nicht. Noch immer sind viele Planer der Auffassung, ihre Entscheidung für einen Laubengang sogar verteidigen zu müssen. Sicherlich hat die außen liegende Erschließung häufig Platz- und/oder Kostengründe. Doch mit ein wenig Mut und Gestaltungswillen kann man weit mehr als aus der vermeintlichen Not eine Tugend machen. Wie schon in Francesco Guardis Gemälde aus dem 18. Jahrhundert liegt die endgültige Entscheidung, was daraus wird, bei den Nutzern und Bewohnern, die sich den Laubengang im besten Sinn zu eigen machen. | Anke Geldmacher
Autos raus, Leute rein
(SUBTITLE) Berlin: Wohngebäude »Gleis Park«
Seit letztem Jahr geht es mit einem dynamisch-geschwungenen Gebäudekomplex in den Gleisdreieck-Park hinein. Wo früher das markante Parkhaus von Renzo Piano stand, wird nun nur noch zur Hälfte geparkt und zur anderen Seite hin gewohnt – mit grandiosem Blick in den Park. Eine »Umnutzung« nach Teilabriss die konzeptionell und städtebaulich überzeugt und Schule machen sollte.
debis, die Dienstleistungstocher von Daimler-Benz, ist längst Geschichte, und der 1998 eröffnete Gebäudekomplex, den Renzo Piano und Christoph Kohlbecker zwischen Potsdamer Platz und Landwehrkanal errichtet haben, hat mittlerweile andere Eigentümer. Zum Gesamtkomplex gehörte seinerzeit auch ein langgestrecktes Parkhaus entlang der auf einer Brückentrasse geführten U2. Es entstand auf einer Bahnbrache südlich des Kanals und wurde wie auch die Bürobauten auf dem Potsdamer Platz mit den für Piano ikonischen ockerfarbenen Keramikplatten bekleidet. Doch die Anzahl von 1 500 Stellplätzen stammte offenkundig noch aus Prognosen einer Ära der hemmungslosen Individualmobilität: Die Hochgarage stand stets zu weiten Teilen leer, war also am Bedarf vorbeigeplant. Diese Situation war auf Dauer weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar, zumal die einstigen Brachflächen der Umgebung sich inzwischen in den überaus beliebten Park am Gleisdreieck verwandelt hatten. Dessen auf dem Gelände des früheren Potsdamer Güterbahnhofs entstandener und als Westpark titulierter Teil, der mit seinem nördlichen Zipfel bis ans Schöneberger Ufer vorstößt und auf der Ostseite vom Parkhaus flankiert wird, wurde 2014 fertiggestellt. Zeit also, für das unternutzte Parkhaus eine sinnvolle, zukunftsfähige und nicht zuletzt natürlich auch renditestärkere Lösung zu finden. Man entschied sich, das Gebäude längs zu kappen und damit die Stellplatzanzahl zu halbieren. Erhalten blieben die markanten Spindelrotunden im Norden und Süden sowie der zur U2 hin gelegene Strang mit den Stellplätzen, während die zum Park hin orientierte Seite rückgebaut und durch einen sechsgeschossigen Wohnbau von 185 m Länge ersetzt wurde. Unter acht Büros, die am eingeladenen Wettbewerb teilnahmen, konnte sich KSP Engel durchsetzen, 2020 war das Projekt fertiggestellt.
Gegliederter Baukörper
Der Neubau, der von den Rampenspindeln und vom verbliebenen Teil des Parkhauses dreiseitig umgriffen wird, öffnet sich mit durchgehenden Balkonen zum Park. Die unterschiedliche Bautiefe der Wohnungen führt zu einer geschwungenen Silhouette: Das Gesamtvolumen gliedert sich in vier Bauten mit je eigenem Eingang und eigener Adresse, sodass die Monotonie eines bandförmigen Megablocks vermieden wird; die Einschnitte brechen die Länge des durchgängigen Baukörpers auf angenehme Weise auf, ohne dass das Gesamtvolumen in einzelne Baublöcke zerfällt. Die stählernen Balkongeländer mit eingeschnittener Flosse wirken je nach Blickwinkel mal geschlossen und mal offen. So ergibt sich für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Sichtschutz, ohne dass die Brüstungen massiv ausfallen. Schwarze Stahlprofile mit leichtem Braunstich, weiße Fassadenbänder und der Champagnerton der rhythmisierenden Trennwände unterstützen die attraktive parkseitige Gestalt des Neubaus, die für die Passantinnen und Passanten fast chamäleonartig stets sich wandelnd in Erscheinung tritt.
Erschliessung durch Laubengänge
Ein zurückhaltender grüner Wall, eher eine Bodenwelle, grenzt die Wohnbebauung vom Park ab. Zwischen den Vorgärten des parkseitigen EG führen Durchgänge in die Sequenz rückseitiger Erschließungshöfe, die im Osten von der Außenwand der Restparkgarage begrenzt werden, die zugleich als Brandwand fungiert. Ein mittiger, vertikaler Erschließungskern pro Haus gliedert die Hofschicht in eine Sequenz von acht offenen Räumen; Laubengänge gewährleisten die Erschließung der Wohneinheiten in der Horizontale. Das ist aufgrund der gegebenen Situation – im Osten Parkhaus und Bahn (zukünftig sogar noch eine weitere Trasse), im Westen der Park – die einzig plausible Lösung. Und sie besitzt aufgrund des Umgangs mit Restriktionen und Potenzialen auch einigen Charme: Vielleicht funktioniert so etwas nur in Berlin, wo nicht alles im landläufigen Sinne schön zu sein hat. Aber die schmalen Höfe, die im Sommer angenehm kühl sind, wirken großzügig, die Laubengänge besitzen angenehme Proportionen. Eigentlich sollte hier alles grüner aussehen, aus Kostengründen schrumpften die begrünten Wände zur Teilbegrünung, ganz abgesehen von den Schwierigkeiten der Entwässerung. Auch die schöne Idee, die Keramikelemente des rückgebauten Garagenteils hier wiederzuverwenden, gewissermaßen als Reminiszenz an die vormalige Nutzung, wurde leider nicht umgesetzt. Die Liebe zum Detail zeigt sich aber überall, so z. B. am auf dem WDVS aufgetragenen Kammputz der Fassaden auf der Laubengangseite.
Alle Wohnungen werden über die Laubengänge erschlossen und orientieren sich zum Park hin. Die durchlaufende Homogenität der Fassaden lässt dabei nicht erkennen, dass sich dahinter durchaus unterschiedliche Wohnungstypen befinden. Haus 1, also das nördlichste, ist möblierten Mini-Apartments vorbehalten. Die Häuser 2 bis 4 umfassen jeweils 34 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen und Grundrissen; die Wohnungen im 5. OG besitzen einen Zugang zu einer individuellen Dachterrasse mit grandiosem Ausblick über den Park.
Die Eigentümer haben auf einen Mix gesetzt: einige Wohnungen werden kurzfristig vermietet, bei anderen setzt man auf langfristige Mietverträge, die dritte Kategorie sind gehobene Eigentumswohnungen.
Ökonomie und Ökologie
Gewiss: Der »Gleis Park«, so der Marketing-Name, zählt nicht zu den in Berlin so dringend notwendigen Projekten, um kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, gleichwohl überzeugt das Konzept, weil es zeigt, wie sich ökonomische und ökologische Ideen vereinen lassen: Autos raus, Leute rein. Auf diese Weise ist es ein Baustein für eine postautomobile Gesellschaft, selbst wenn diese für die Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht nur die benachbarte Hochgarage, sondern auch eine Tiefgarage nutzen können, noch gar nicht angebrochen sein muss. Aber der Rückbau zumindest des Teils eines Parkhauses und sein Ersatz durch einen attraktiven Wohnbau ist schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ganz abgesehen davon, dass das Projekt auch auf architektonischer Ebene zu überzeugen vermag.db, Di., 2021.11.09
09. November 2021 Ulrike Kunkel
Haus als Modul
(SUBTITLE) Antwerpen: Wohn- und Geschäftshaus
In einem neuen Viertel entwarfen die Architekten ein Haus, das verschiedene Funktionen verbindet und sich auch als Stadtbaustein verstehen ließe. Hinter einer zunächst rational anmutenden Struktur zeigen sich Wohnräume, die städtische und vorstädtische Qualitäten zusammenführen.
Antwerpen erlebt immense Transformationen. Weite, funktional brachliegende Gebiete werden entwickelt, etwa rund um den historischen Hafen oder am einstigen Schlachthaus. Nieuw Zuid, im Süden an der Schelde gelegen, hat dabei eine Sonderstellung, weil kaum mehr von Umbau die Rede sein kann, sondern auf dem geräumten Areal eines einstigen Rangierbahnhofs ein ganz neues Quartier entsteht. Und während sonst meist die stadteigene Entwicklungsgesellschaft AG Vespa führend verantwortlich ist, liegt Nieuw Zuid mit Ausnahme einzelner Bauten in Händen des privaten Developers Triple Living. Bis 2030 soll eine Nachbarschaft mit rund 2000 Wohneinheiten von gehobenen Kaufapartments bis Sozialwohnungen, mit Büros, Schulen, Kindergärten, Läden und einem Studierendenwohnheim heranwachsen. Ein Masterplan der Mailänder Secchi – Viganò von 2012 gibt dafür ein – nun zu rund einem Drittel gefülltes – Streifensystem senkrecht zum Fluss vor, in dem sich Hoch- und Flachbauten, Straßen, Pfade und offene Räume abwechseln.
Es ist dieses Stadtbauen, vor dem die Architekten Atelier Kempe Thill ihr 2019 fertiggestelltes Zuiderplein-Projekt als „städtebauliches Modul und Architektur zugleich“ bezeichnen. Das ist grundsätzlich zu verstehen und betont gleichzeitig die besondere Lage. Über einer gemeinsam mit POLO architects geplanten Tiefgarage bebauten beide Büros, die in der Nähe schon zuvor bei einem Projekt kooperiert hatten, je einen separaten Baublock. Kempe Thill erhielt dabei jene Fläche, die sich dem neuen zentralen Viertelsplatz zuwendet und diesen maßgeblich prägt.
Raumschichten
Auf einem Umriss von 45 x 45 m entwickelten die aus Deutschland stammenden, seit mehr als 20 Jahren in Rotterdam tätigen Architekten rund um einen Innenhof eine Struktur, die kaum rationaler erscheinen könnte. Wie ein Regal aus schlanken Sichtbetonstützen und Balken wendet sich der Bau mit fünf Geschossen dem neuen Platz zu und staffelt sich gen Südosten in zwei Schritten ab. Indem die eigentlichen Fassaden rundum 2,50 m zurückspringen, ergeben sich zweigeschossige Arkaden, die Ladenlokale im EG und Triple Livings eigene Büros im 1. OG markieren. Darüber folgen insgesamt 38 Eigentumswohnungen, allesamt mit großzügigen, immer gleich bemessenen Loggien ausgestattet. Nur die Eckfelder sind breiter, was der Ansicht zusätzliche Leichtigkeit verleiht. Im Hof wiederholt sich diese Struktur. Auch hier liegt eine vergleichbare Raumschicht vor dem eigentlichen Gebäude, die die Wohnungen teilweise über Laubengänge erschließt. Unterstrichen wird der fast abstrakte Eindruck durch die Materialität und reduzierte Farbigkeit. Zum Beton tritt spanischer Kalkstein, Putz im unteren Bereich des Innenhofs, eloxiertes und poliertes Aluminium sowie Holz für die Terrassen und Pergolalamellen.
Regel und Varianz
Verblüffenderweise gilt dabei zweierlei. Einerseits erlaubte es die rationale Struktur, die verschiedenen Funktionen regelrecht einzusortieren. Das war auch deshalb ein Vorteil, weil zuunterst zunächst ein Supermarkt mit darüber liegender Schauküche vorgesehen war, dessen Fläche dann in kleinere Einheiten umgeplant wurde. Andererseits ist der Entwurf keineswegs formalistisch, sondern abhängig von den Bedürfnissen sowie Veränderungen angepasst und komplexer variiert. Dazu zählt, dass erst mit der Umplanung der Innenhof bis auf EG-Niveau herabgeführt wurde, um dort statt tiefer Nutzflächen mehr Licht zu schaffen. Unterhalb der Dachterrassen reichen die Loggien höher als sonst hinauf, weil sie die Brüstung darüber mitausbilden, und erzeugen so ein bewegteres Bild. Vor allem aber offenbaren die Grundrisse, dass das äußere Raster nicht streng die innere Tragstruktur bestimmt. Deren Stahlbetonschotten weichen zum Teil von der Flucht der Stützen ab. Dies ermöglichte unterschiedliche Wohnungsgrößen; weil die Loggien außen aber gleichmäßig durchlaufen, entstehen notwendigerweise geschlossene Fassadenflächen, wo sich Freiraum und zugehörige Wohnung gegeneinander verschieben. Vor sie lassen sich nun die zweiteiligen Fenstertüren fahren, sodass Wohnraum und Terrasse nahezu bruchlos ineinander übergehen.
Zweckmässige Erschliessung
Die Balance aus Formwillen und Pragmatismus motivierte schließlich auch die Wahl der Laubenganglösung. Voraus ging, wie André Kempe im Gespräch erläutert, die Analyse von Erschließungsvarianten und ihrer Effizienz im spezifischen Gebäudeumriss. So wanderten Treppen und Lifte in die für Wohnnutzung schwierigen Eckzonen. Durch die Laubengänge ließen sich dann zusätzliche mittige Treppen vermeiden, die die kommerziellen Flächen weiter perforiert hätten. Ausschlaggebend war auch, dass auf dem Laubengang maximal eine Wohnung passiert werden muss. Eine Ausnahme bildet lediglich die riesige, gemeinschaftliche Dachterrasse im 3. OG, die man an zwei Einheiten vorbeigehend erreicht. Die Breite von 2,5 m wandelt die Erschließung zudem zum vollwertigen Aufenthaltsbereich, in dem man von den angrenzenden Schlafzimmerfenstern Abstand halten kann. Dass jene bis zum Boden hinabreichen, wirkt dennoch radikal – oder wiederum pragmatisch, wie Kempe es formuliert: „Es ist einfach eine weitere Option. Verhängen kann man Fenster immer. Sie nachträglich, wenn gewünscht, zu vergrößern, ist viel schwieriger.“
Urbanes Zusammenleben
Damit führt das Gebäude – das mit kompaktem Zuschnitt, Fernwärme, Solarzellen, Wärmetauscher und anderen Maßnahmen Passivhauswerte erreichen soll und Regen- und Grauwasser nutzt – schließlich gar nicht so sehr zur Frage, inwieweit sich der verpönte Laubengangtypus rehabilitieren lässt. Sondern viel grundsätzlicher zu Aspekten des urbanen Zusammenlebens. Für Kempe Thill ging es auch darum, wie sich Qualitäten urbanen und vorstädtischen Wohnens vereinen lassen. Eine wichtige Rolle spielen die Freibereiche, die dieses Projekt in üppigsten Ausmaßen bietet: privat, was den einzelnen Wohnungen trotz unmittelbarer Innenstadtnähe suburbane Atmosphäre verleiht, und (semi-)öffentlich, was die in dieser Hinsicht spannendsten Themen berührt. So stellt sich gerade bei gehobenen Eigentumswohnungen – teils selbstbewohnt, teils vermietet – die Frage des Arrangements untereinander: Welche Nutzungen sind auf den Laubengängen zulässig, welche auf der weiten Dachterrasse? Wie steht es um den Hof, der mit der Absenkung ins EG den unmittelbaren Anschluss an das Wohnen verloren hat? Und vor allem: Welche Regeln sind nötig, wer kümmert sich? So gilt eine Hausordnung, die etwa Barbecues ausschließt. Eine strenge Sperrstunde für die Terrasse gibt es nicht, aber Regelungen zur Lärmbeschränkung. Und vieles muss im Gebrauch erst verhandelt werden: Derzeit sind nur einige Blumentöpfe, ein paar erste Bistro-Tische auf den Laubengängen zu sehen. Beim journalistischen Besuch dort schließt jemand umgehend das Kippfenster seines Schlafzimmers. Und auf der Dachterrasse stehen bisher nur einige Palettenmöbel. Kempe Thill zeicheten auch eine Variante mit Begrünung, von der der Bauherr absah. Ob dort eine langfristige Möblierung gefunden wird und ob sie nicht doch eine Bepflanzung einschließen sollte, wird in den Eigentümerversammlungen noch erörtert. Zum Austausch untereinander richteten die Bewohner jüngst zudem eine App ein.
Stadt als Option
Die Laubengänge sind in diesem Gesamtgefüge zu sehen. Das Gespräch mit einer Bewohnerin mag stellvertretend für Meinungen sein, wenn sie die Bewegung vor ihrem Fenster nicht als störend empfindet: „Es ist gerade angenehm, den Nachbarn zu begegnen.“ Knapp zwei Jahre nach dem Einzug lerne man sich zunehmend kennen.
Für dieses Miteinander, für Begegnung und Abgrenzung gibt der Bau eine fast generische, kühle Raumstruktur vor, die den Bewohnern erlaubt, sie zu füllen, oder zwingender formuliert: die dies auch fordert. Was Parallelen zum Umraum nahelegt: Wie das neue Viertel langfristig belebt wird, wird sich in ein paar Jahren zeigen. In den noch nicht voll vermieteten Ladenflächen des Zuiderplein-Gebäudes sind bisher ein Fitness-Club, ein kleines Café und ein Restaurant eingezogen. Ähnlich überwiegen rundum Gastronomie und Galerien als klassische Pioniernutzer. Weiteres muss folgen – was den Willen zur Aneignung braucht und Zeit.db, Di., 2021.11.09
09. November 2021 Olaf Winkler