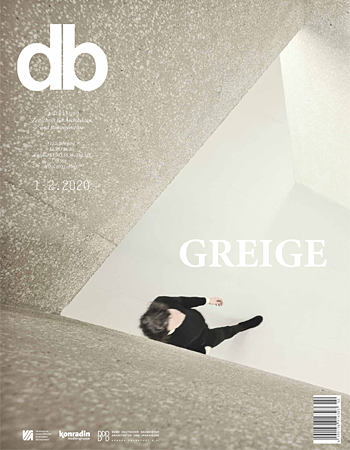Editorial
Das Farbspektrum zwischen Beige und Grau hat seit jeher seinen angestammten Platz in der Architektur. Im Kunstwort »Greige« zusammengefasst, steht es für die Farbigkeit vieler uralter Materialien und Bauweisen, ob in Form von Sand, Kies, Naturstein, Putz, gebranntem und ungebranntem Ton oder auch vergrauendem Holz.
Als eine Art farbliches Grundrauschen dient Greige durch seinen Ursprung in der Welt der Mineralien als Vermittler zwischen unserer gebauten und natürlichen Umgebung.
Angesiedelt zwischen Warm und Kalt, zwischen Hell und Dunkel ist der Farbton zudem prädestiniert als dezenter Begleiter auch von schrillen »Farbpersönlichkeiten«.
Dass Greige seit einigen Jahren in der Architektur wieder vermehrt Verwendung findet, überrascht nicht: Angesichts immer komplexer werdender gesellschaftlicher Herausforderungen wächst das allgemeine Bedürfnis nach Ausgleich und Ausgewogenheit. Zeitlich etwas versetzt spiegeln sich solche Strömungen auch stets in der Farbpalette unserer gebauten Umgebung wider. | Martin Höchst
Wohltuender Widerpart
(SUBTITLE) Erweiterungsgebäude des Landratsamts in Bad Kissingen
Stadtbaustein nennen die Architekten ihren Erweiterungsbau des Landratsamts in Bad Kissingen, der sich tatsächlich passgenau, als wäre es das letzte Stück eines Baukastens, in den Bestand fügt. Auch farblich gelang diese Einpassung. Beeindruckend, wie genau jedes Detail behandelt wurde. Das streng Geordnete dient dabei als wohltuender Widerpart des Spontanen, Gewachsenen, Vielfältigen ringsumher.
Es herrscht trübes Wetter am Tag der Projektbesichtigung im November. Der Weg vom Bahnhof führt durch die Innenstadt des gerade mal knapp 25.000 Einwohner zählenden, aber selbstbewussten unterfränkischen Kurorts Bad Kissingen. Hier hat sich früher einmal die internationale Haute Vaulet zur Kur eingefunden, aber auch um Geschäfte zu machen, Politik zu betreiben oder sich dem ein oder anderen Techtelmechtel zu widmen.
Wenngleich es nicht mehr diese Bedeutung hat, steht Bad Kissingen heute gut da. Die Delle, die die Gesundheits-Strukturreform von 1996 hervorgerufen hatte, liegt in der Vergangenheit, zuletzt zählte man über 1,6 Mio. Übernachtungen im Jahr.
Selbst im November zeigt sich die Stadt alles andere als grau. Die Putzfassaden sind in verschiedenen Gelb-, Rot-, Braun- oder Grüntönen gehalten, Buntsandstein in rötlicher, grünlicher und gelblicher Tönung ist zu finden, Ziegel-, Metall- und Betonfassaden ebenso. Mögen auch die hellen und warmen Farben überwiegen – der etwas weiter gefasste Kontext gibt keine eindeutige Empfehlung dafür ab, wie hier ein neuer Baukörper zu gestalten ist.
Das galt auch für den Erweiterungs-Neubau des Landratsamts, selbst dann, wenn man nur dessen Nachbarbebauung am Altstadtrand ins Visier nimmt. Er war notwendig, um dem gestiegenen Platzbedarf Rechnung zu tragen. Zwei niedrigere Gebäude aus der Nachkriegszeit wurden dafür abgerissen. 2019 eröffnet, ergänzt er zwei Bestandsbauten des Amts. Einer davon, gerade frisch saniert und energetisch ertüchtigt, ist aus den 60ern und besteht aus einem freistehenden Sitzungssaal mit einer dunkel eloxiertem Metallhülle sowie einem Verwaltungsbau, dessen weiße Fassade zeittypisch das Skelettraster der Tragstruktur ablesbar macht – inklusive Staffelgeschoss und Flugdach. Der andere, aus den 80ern, zeigt den eher hilflosen Versuch, historische Formen zu adaptieren: mit Krüppelwalmdächern und weißgerahmten, ockerfarbenen Fassadenelementen über einem grauen Natursteinsockel, wenig elegant proportioniert. Weitere Nachbarn des Erweiterungsbaus sind u. a. ein Fachwerkhaus mit ockerfarbenen Ausfachungen, Gebäude mit sand- und orangefarbenen Putzfassaden, eine davon bemalt. Letztlich diente den Architekten der mächtige Sandsteinbau des Rathauses in Sichtweite, 1709 als Adelssitz errichtet, als entscheidende Referenz für die Fassade des Neubaus.
Gut ausbalanciert
Schon im Wettbewerb, den Steimle Architekten 2016 nach einem Bewerbungsverfahren gewinnen konnten (ein zweiter Preis wurde nicht vergeben), hatte man das Fassadenmaterial definiert, an dem bis zur Realisierung festgehalten wurde: großflächige Betonfertigteile, die mit Zuschlägen aus Mainsand und Kalkstein eine dem Sandstein ähnliche, hellbeige Farbe bekommen. Die Betonfertigteil-Fassade soll die angestrebte monolithische Wirkung des prägnant und kompakt proportionierten Bauvolumens unterstreichen. Es wirkt, als wären ein drei- und ein viergeschossiger Baukörper ineinandergeschoben. Dadurch nimmt das Gebäude die unterschiedlichen Höhen der Umgebung auf: Zum Rathaus und den niedrigeren Nachbarn hin ist es dreigeschossig, zu den höheren Bestandsgebäuden des Amts wiederum viergeschossig.
Wie aus einzelnen Quadern genau in den Kontext eingepasst, ergeben sich dabei leichte Rücksprünge, führen zum Haupteingang an der Nordseite und lassen auf der Westseite eine Lücke zur Nachbarbebauung, sodass der Charakter der Altstadt aus kleinen Plätzen und Gassen fortgeschrieben wird. Der Stadtbaustein, wie die Architekten das Haus nennen, wird dem Kontext eingefügt, ohne jedoch auf eine eigenständige Präsenz im Stadtraum zu verzichten.
Die Balance aus Eingliederung und Selbstbewusstsein der Zeitgenossenschaft ist auch an der Fassadendifferenzierung abzulesen: Sockel und Faschen, beide leicht eingerückt, sind aus scharriertem Beton, wirken dadurch etwas heller und gehen ins Gräuliche. Die champagnerfarbenen Fensterrahmen aus eloxiertem Aluminium sind farblich fein darauf abgestimmt. Selbst die Sonnenschutzblenden zeigen sich in der Farbe der Betonfertigteile, sodass auch bei Verschattung der Fenster der homogene Charakter nicht beeinträchtigt wird. Einen kräftigen Kontrast dazu bildet das Dunkelbraun des Verbindungsstegs zwischen Neubau und Bestand im 2. OG sowie des eingeschobenen Volumens für den Sitzungssaal im EG an der Nordwestecke. Nie steht in Zweifel, dass dies ein moderner Bau ist, aber genauso wenig sollte er nach Absicht der Architekten seine Nachbarn übertrumpfen oder erdrücken – was auch bestens funktioniert.
Lohnender Aufwand
Viel Wert wurde auf die sehr akkurate Planung und Verarbeitung der Beton-Fertigteile gelegt. So auch bei ihrer Farbgebung, die man in mehreren Varianten bis hin zum Maßstab 1:1 untersuchte – zu wichtig war sie den Planern, als dass man sie dem Zufall hätte überlassen wollen. Das gilt auch für weitere Details: Die geschlossenen Fugen zwischen den Betonfertigteilen sind ockerfarben besandet, die Betonoberflächen selbst wurden gesäuert, um eine leicht strukturierte Oberfläche, die das Licht in einer dem Sandstein vergleichbaren Weise bricht, zu erzeugen. Die einzelnen Fertigteile zeigen sich ein klein wenig unterschiedlich, was der Gesamtwirkung aber eher guttut als schadet. Der Aufwand hat sich gelohnt – farblich vermittelt das Haus gelungen innerhalb seiner heterogenen Nachbarschaft, es ergänzt die eigenwilligen Nachbarbauten, anstatt sie herauszufordern.
Damit Regenwasser nicht bald schon Spuren hinterlässt und den makellosen Eindruck trübt, wurden die Fertigteile tiefenhydrophobiert. Das müsse man, so die Architekten, sicher irgendwann wiederholen, eine Betonfassade muss eben gepflegt werden, wie Putzfassaden auch.
Von außen fallen zudem wenige, bündig in der Fassade stehende, geschosshohe Fensterelemente auf – diese Prallscheiben aus Sonnenschutzglas zeigen an, wo die Flure liegen. Weiß man dies, könnte man also von außen bei sehr sorgfältiger Analyse schon erkennen, wie das Innere organisiert ist: Wie Windmühlenflügel sind die einzelnen Bürotrakte um einen zentralen Kern angeordnet, der wie die Geschossdecken aus Sichtbeton ist. Die Bauteile lassen sich somit thermisch aktivieren: Wasser vom nahegelegenen Liebfrauensee, der in einem unter dem Haus durchführenden Kanal mündet, kann zur Raumtemperierung genutzt werden. Der Kanal im Untergrund ist vor dem Haus an einer Stelle geöffnet, sodass er nicht vollkommen verborgen bleibt. Auf dem Dach des viergeschossigen Gebäudeteils ist eine Photovoltaikanlage installiert. Da man von den obersten Fluren auf das Dach des dreigeschossigen Bereichs sieht, verzichtete man dort darauf.
Nichts Nebensächliches
Wie an der Gebäudehülle hat man auch im Innern sehr penibel darauf geachtet, dass sich das Gebäude als präzise ineinander gefügtes Volumen zeigt. Kein Detail war zu nebensächlich, um es nicht zu beachten. Fugen und Spannlöcher der Sichtbetonflächen sind akkurat gesetzt und aufeinander abgestimmt. Der gläserne Aufzug gewährt im Treppenhaus den Blick über die Geschosse hinweg: Überall sind die einzelnen Bauteile streng flächenbündig gesetzt. Beschläge und Türbänder sind so angebracht, dass sie nicht stören. Nischen, etwa vor den Teeküchen und den Sanitärräumen, wurden in einem weiß lasierten Eichenfurnier eingefasst, sodass sie wie saubere Inlays wirken.
Der Fußboden ist in den Büros mit einem »Enomer«-Bodenbelag, in den Fluren mit 60 x 120 cm messenden, hellgrauen Großformatfliesen belegt, im Sitzungssaal kamen sie sogar in einem großzügig wirkenden und anspruchsvoll zu verarbeitenden Format von 120 x 240 cm zum Einsatz. Die Trockenbauwände in hellem, fast weißem Cremeton gehalten, wurden mit einer schmalen Fuge von der Sichtbetondecke abgesetzt und auch die Türen erhielten eine umlaufende Schattenfuge. Die Büros werden akustisch durch von der Decke abgehängte Baffeln gezähmt und die Fenster können erfreulicherweise von den Mitarbeitern nach eigenem Bedarf geöffnet werden.
Ist im Kontext des unregelmäßigen und vielfältigen Außen die Präzision und ruhige Farbgebung wohltuend und beruhigend, so bekommen sie im Innern fast schon etwas Erzieherisches. Der große Ehrgeiz, Fugen, Bauteile, Farbnuancen aufeinander abzustimmen, das Fehlen von Fehlern oder Unfertigem macht es schwer, sich vorzustellen, wie sich das Haus durch die Nutzung und die (warum auch nicht) bisweilen eigenwilligen Vorlieben der Menschen, die hier arbeiten, verändern wird – und ob es das eigentlich darf. Dass die Fläche sehr effektiv genutzt wurde und das Innere so kaum Großzügigkeit ausstrahlen kann, ist nicht den Architekten anzulasten.
Vielleicht hätte im Innern ein bisschen Farbe dann doch gutgetan. Ein wenig Farbe holen aber dann doch die Ausblicke ins Haus: Die Stadt ist bunt, selbst im November.db, Di., 2020.01.21
21. Januar 2020 Christian Holl
»Neutraler« Farbton für den Kunstkoloss
(SUBTITLE) Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne (CH)
Als wuchtiges Volumen steht das neue Kunstmuseum von Lausanne neben dem Bahnhof. Um Raum für einen Vorplatz zu schaffen, wurden die historischen Lokremisen weitgehend abgerissen. Die dezente Farbigkeit der Klinkerfassade soll eine gewisse Neutralität erzielen. Das gelingt auch, aber im Innern wirkt die konsistente Farbigkeit in Greige eher steril. Was aber auch mit der problematischen Abfolge der Räume zu tun hat.
Es gibt immer wieder einmal in der Schweiz tätige ausländische Architekturbüros, die, um es salopp auszudrücken, fast schweizerischer bauen als die Schweizer selbst. Dazu könnte man etwa die Briten Caruso StJohn und Sergison Bates zählen. Und, jüngstes Beispiel, Barozzi Veiga. Gleich drei Projekte konnte das in Barcelona beheimatete Büro in den vergangenen Jahren in der Eidgenossenschaft fertigstellen: die Erweiterung des Bündner Kunstmuseums in Chur, das Tanzhaus in Zürich und den im Oktober 2019 eröffneten Neubau des Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne. Bei letzterem war die Planungsspanne am längsten: 2010 fand der Wettbewerb statt, in den Barozzi Veiga auf dem Nachwuchsticket einrückten und der ihnen am Ende den Sieg der fachlich von David Chipperfield präsidierten Jury bescherte – und damit ihr erstes Projekt in der Schweiz. Der Bau neben dem Bahnhof polarisiert. Manche halten ihn für monströs. Das ist etwas übertrieben. Aber Barozzi Veiga, als deren bislang wichtigstes Werk wohl die Philharmonie in Stettin gelten kann, machen es den Besuchern generell nicht leicht, ihre Architektur ins Herz zu schließen. Vielleicht muss man aber in Lausanne dankbar sein, dass der Neubau des kantonalen Kunstmuseums zustande gekommen ist, denn der Weg dorthin war für das Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA) mühsam.
Daher zunächst ein Blick zurück. Die Ursprünge des Museums wurzeln in Kunstsammlungen und Stiftungen von Künstlern aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Kollektion wuchs sukzessive, 1906 konnte die Institution Räumlichkeiten im Palais de Rumine beziehen, einem neu errichteten Gebäude im Stil der Florentiner Renaissance. Der Prachtbau an der Place de la Riponne beherbergte diverse Kulturinstitutionen des Kantons; verschiedene Museen, die Bibliothek und die Universität. Konsequenz: Für das MCBA stand nur ein Geschoss zur Verfügung. Schon 1924 forderte der Direktor ein eigenes Haus, doch es sollte bis 1991 dauern, ehe die politische Entscheidung hierfür fiel. Nach zwei gescheiterten Versuchen, der Sammlung endlich zu einer neuen Heimat – zunächst am Ufer des Genfer Sees und dann am Rande der Altstadt – zu verhelfen, fiel schließlich die Entscheidung für einen Standort nahe dem Bahnhof. Gewissermaßen handelte es sich um einen Kompromiss, denn der Bahnhof liegt nicht oben in der Altstadt und nicht unten am See, sondern auf halbem Weg dazwischen und auf halber Höhe am Hang. Außerdem befanden sich hier ausgedehnte Hallen für das Abstellen und für die Reparatur von Lokmotiven. Die Gebäude wurden nicht mehr benötigt und harrten ohnehin einer neuen Nutzung, sodass die Stadt das Gelände im Austausch mit einer anderen Parzelle von den Schweizer Bundesbahnen erhielt. Auch das nahm, wie man zurecht kalkulierte, möglichen Gegnern den Wind aus den Segeln. Und schließlich wurde der Neubau des MCBA nicht mehr als singuläres Projekt vorangetrieben, sondern zusammen mit Neubauten für das auf Fotografie spezialisierte Musée de l’Elysée und das mudac, das Museum für Design und angewandte Kunst.
Neuanfang statt Umbau
Der Wettbewerb 2010 betraf also nicht nur das Neubauprojekt für das MCBA, sondern umfasste auch einen städtebaulichen Masterplan für die Umwandlung des ehemaligen CFF-Geländes in ein Kulturareal.
Die einstigen Lokomotivhallen befanden sich zwar niveaugleich unmittelbar westlich des Bahnhofs von Lausanne. Dennoch ist das langgestreckte Terrain hinsichtlich seiner Proportion und Lage nicht ohne Probleme. Auf der Südseite grenzt es unmittelbar an die vielbefahrenen Bahngleise Richtung Genf, Richtung Westen ist der Durchgang versperrt, und auf der Nordseite wird es durch Stützarkaden und Wohnbauten am steilen Hang begrenzt.
Der älteste Teil der Lokomotivhallen war schon 1911, also zur Bauzeit des 1916 eröffneten Bahnhofsgebäudes, fertiggestellt worden; seine Erhaltung wurde in der Wettbewerbsauslobung empfohlen, war aber für die Teilnehmer nicht verpflichtend.
Barozzi Veiga, die Überraschungssieger des Wettbewerbs, zählten zu den Architekten, die für den weitgehenden Abriss des Bestands optierten. Sie komprimierten das Raumprogramm zu einem 145 m langen, 21 m breiten und 22 m hohen orthogonalen Volumen, das im Süden nahe an die Gleise rückt und damit im Norden Platz für einen weitläufigen Platz lässt. Diese städtebaulich großzügige Lösung, die bei Erhalt der das Gelände weitgehend ausfüllenden historischen Hallen nicht realisierbar gewesen wäre, gab letztlich den Ausschlag für das Votum zugunsten des katalanischen Büros.
Wider den Bilbao-Effekt
Das Museumsprojekt hat sich zwischen Wettbewerbsgewinn und der durch Einsprachen von Anliegern verzögerten Realisierung nur in Details verändert, beispielsweise hinsichtlich der auf Wunsch der Museumsleitung vergrößerten Raumhöhe im obersten Geschoss. Schon im Wettbewerb aber setzten die Architekten auf die Blockhaftigkeit des weitgehend geschlossenen Volumens, die Rhythmisierung durch die geschosshohen lamellenartigen Pfeiler auf der Nordseite und einen Ziegelsteinmantel in einer – so die Wertung der Jury – »relativ neutralen Farbe«. Zur Anwendung kamen schließlich weißgraue Klinker eines deutschen Herstellers. Die Homogenität des Volumens weicht in der Nahsicht zurückhaltender Belebung, da dann die brandbedingt leicht unterschiedlichen Färbungen der Klinker und die Nachbehandlung der Fugen durch Aufrauung mit einem Stäbchen erkennbar werden. Erklärtes Ziel der Architekten war eine zurückhaltende Farbigkeit, die sich sowohl mit der technisch-industriellen Tradition des durch die Bahn bestimmten Orts als auch mit den hellen Natursteinbauten Lausannes vertrüge. In Form von Riemchen umhüllen die Klinker auch die insgesamt 84 Wandpfeiler der Nordseite, die jeweils aus vier vorfabrizierten Elementen bestehen, auf der Baustelle zusammengesetzt und mit dem Stahlbeton-Rohbau des Museums verbunden wurden. Nähert man sich dem Gebäude vom Bahnhof aus, also von der Ostseite, so zeigt sich das Volumen aus der Schrägperspektive zunächst verschlossen. Schritt für Schritt wird dann erkennbar, dass sich hinter den kolossalen Wandpfeilern eine Reihe von Fenstern verbergen. Dies betrifft in hohem Maße das EG mit seinen eher öffentlichen, dem Vorplatz zugewandten Nutzungen wie Eingangsbereich, Bookshop und Café. Die Stirnseite des Gebäudes, an der ein vorgeblendetes Metallprofil an den Schnitt einer der hier vorher bestehenden Hallen erinnert, zeigt sich vollkommen verschlossen, und auch die Südseite ist weitestgehend ohne Öffnungen. Hier gab es keine Alternative, denn die Nähe zu den Gleisen erforderte angesichts der Tatsache, dass an dieser Stelle 1994 schon einmal ein Gefahrgutzug entgleiste, höchste Sicherheit für die Sammlungsstücke und damit den Verzicht auf Fenster.
Man habe kein Centre Pompidou gewollt, auch kein Guggenheim Bilbao, betonen Architekten und Direktion unisono, sondern Räume ganz im Dienste der Kunst. Und so erklärt sich auch, dass es kein Restaurant im obersten Geschoss mit Blick über den Genfer See gibt, wie es im Vorfeld immer wieder gefordert worden war. Denn das hätte die Möglichkeit erschwert, das oberste Geschoss natürlich zu belichten. Den Blick auf den See zu verweigern, das war ein Konzept, das auch Peter Zumthor seinem Kunstmuseum in Bregenz zugrunde legte. Doch eine komplementäre Radikalität bei der Konzeption der Museumsräume, mit der das Museumsgebäude in Vorarlberg bis heute überzeugt und beeindruckt, erzielen Barozzi Veiga nicht. Weiße Wände, helles Parkett, Schattenfugen, viereckig geführte Lichtbänder im 1. OG, eingehängte Deckenraster aus Metall im 2. OG, die Tageslicht gefiltert durchlassen, aber auch für Kunstlicht geeignet sind: Ohne Zweifel haben die Architekten aus Barcelona bei ihrem ersten realisierten Museumsprojekt mit viel Sorgfalt für das Detail Räume geschaffen, die gut funktionieren. Und doch hält sich beim Parcours durch die Säle die Begeisterung in Grenzen. Die Atmosphäre bleibt steril.
Man könnte auch sagen: etwas konventionell. Es fehlt an Schwerpunktsetzung, an Dynamik. Besonders problematisch aber ist die Beziehung zwischen Erschließungszonen, öffentlichen Bereichen und den eher stereotyp gereihten Sälen für Sammlung und Sonderausstellungen. Betritt man das Museum am Haupteingang, so steht man in der gewaltigen Eingangshalle. Eine breite Freitreppe führt hinauf auf ein Podium in einem Gewölberaum mit einem großen halbkreisförmigen Fenster. Es handelt sich bei diesem Annex um das einzige Relikt des Lokomotivschuppens. Doch den zuvor offenen Dachstuhl haben die Architekten mittels eines historisch nicht vorhandenen Gewölbes in einen monumentalen »Thermenraum« verwandelt, der die Eingangshalle sakralisierend auflädt. Das wirkt aber nicht spielerisch-ironisierend, auch der Kontrast zwischen Blick auf Schienensträngen sowie Alltagswirklichkeit und ästhetischem Separatraum des Museums, wie man ihn zur Zeit der Postmoderne geliebt hätte, wird hier nicht zum Thema. Manches wirkt letztlich unausgegoren, etwa wenn die Architekten die Stufen als »Bänke« bezeichnen, obwohl die Atmosphäre des Raums kaum dazu einlädt sich hier niederzulassen. Auf beiden Seiten der Freitreppe führen nunmehr enge Treppenkatarakte empor zu den Ausstellungsräumen beidseitig der Mittelhalle. Im 1. OG, das – anders als heute praktiziert – ursprünglich der Sammlung vorbehalten sein sollte, sind die beiden Saalfolgen als Enfiladen organisiert, im obersten Geschoss findet sich überdies eine flexible Halle von 700 m², die sich durch verschiebliche Wände temporär unterteilen lässt. Eine weitere gegenläufige Treppenkaskade, diesmal von Stufenpodesten begleitet, verbindet die Geschosse weiter im Westen des Gebäudes.
Die Platzfläche vor dem Museum wird von großen, wie aus dem Boden geschnittenen und angekippten Betonscheiben akzentuiert. Vielleicht sind sie von der versenkten Lok-Drehscheibe inspiriert, die wie einige im Asphalt verlaufende Gleisstränge noch von der ursprünglichen Nutzung des Orts zeugen. »Plateform 10« heißt das neue Museumsquartier – es ist der Bahnsteig der Kultur neben den neun Bahnsteigen des Bahnhofs. 2021 sollen die anderen beiden Museen eröffnen, für die nach Plänen von Aires Mateus ein gemeinsames Gebäude westlich des MCBA entsteht. Erst 2026 werden mit dem Umbau des Bahnhofs samt Trassierung einer neuen Metrolinie die Arbeiten in der Umgebung abgeschlossen sein. Schon jetzt erhofft man sich die Signalwirkung des Museumsbaus unmittelbar an der Einfahrt zum Bahnhof Lausanne. Auffällig mag die mächtige Ziegelwand mit der heraustretenden Spolie der historischen Hallenstirn sein. Auf das Alibi des aus der Gebäudemasse tretenden Stummels hätte sich jedoch auch verzichten lassen.db, Di., 2020.01.21
21. Januar 2020 Hubertus Adam
Lokalkolorit
(SUBTITLE) Bürgerdienste der Stadt Ulm
Gestockter Sichtbeton prägt die Fassade des Neubaus der »Bürgerdienste der Stadt Ulm«, der dem Straßenraum an städtebaulich heikler Stelle ein markantes Gesicht gibt. Seine Materialfarbigkeit bringt der Beton auch ins Innere des Service-Rathauses.
Zurzeit prägt schmutziges Baustellengrau die Gegend rund um den Ulmer Hauptbahnhof. Unmittelbar vor dem Hauptportal gähnt eine stahlbetonbewehrte Schlucht, in der mit Hochdruck an einer großflächigen Tiefgarage gearbeitet wird.
Gleich dahinter, wo auf 10.000 m² das Wohn- und Geschäftsquartier »Sedelhöfe« entsteht, verstellen hoch aufragende Rohbauskelette den Weg. Auch die Olgastraße, die vom Bahnhofsplatz abgeht, um dann westwärts dem Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer zu folgen, war bis vor Kurzem eine Baustelle. Man hat die vier Autospuren um Straßenbahngleise ergänzt, die Fahrbahndecke erneuert und die Gehwege verbreitert. Demnächst werden Bäume den »City Ring« säumen, denn die Verkehrsschneise soll sich nach und nach in einen Boulevard, wie es ihn bis in die Vorkriegsjahre hier gab, zurückverwandeln.
An die zerstörte städtebauliche Grandezza von einst erinnert am ehesten noch das imposante Landgericht, das 1898 im Stil der Renaissance an der Olgastraße 106 errichtet wurde. Ferner unterstreicht der jüngst restaurierte, expressiv-organische Bau des Theaters Ulm von 1969 die Bedeutung der Straße als Nahtstelle zwischen Alt- und Neustadt. Ansonsten beherrschten lange Zeit mediokre Büro- und Verwaltungsbauten das Straßenbild, das sich allerdings schon seit einigen Jahren wandelt. So sind im Rahmen des Entwicklungsprojekts »Zukunftskonzept Innenstadt 2020« einige Gebäude entstanden, die tatsächlich wieder so etwas wie boulevardesken Flair in den miefigen Verkehrsraum bringen. Dazu zählt das Geschäftshaus »Wengentor« von Stemshorn Kopp Architekten, das Bürogebäude der Staatsanwaltschaft von Schulz und Schulz, die Sporthalle für das Kepler- und Humboldt-Gymnasium von h4a sowie der Sitz der Handwerkskammer von Hotz+Architekten. Das jüngste Projekt dieser Art ist das vom Stuttgarter Büro Bez + Kock Architekten entworfene Gebäude der »Bürgerdienste der Stadt Ulm«.
Heimatliche Gefühle
Das im Januar fertiggestellte Service-Rathaus, das eine Vielzahl städtischer Dienststellen unter einem Dach vereint, hebt sich deutlich von der Umgebung ab. Mit seiner strengen Rasterfassade setzt es einen wohltuenden Kontrapunkt sowohl zum Baustellen-Chaos in Richtung Bahnhof als auch zur Bauklötzchen-Collage des unmittelbar benachbarten Handwerkskammer-Gebäudes. Zur angenehmen Wirkung tragen neben der strukturellen Klarheit aber auch Farbigkeit und Textur der Sichtbetonfassade bei. Dabei fällt es durchaus schwer, die Farbe der Gebäudehülle zu bestimmen. Ein vornehmes Grau scheint durch, aber auch ein freundlich-warmes Beige. Greige trifft es daher wohl am besten. Nun ist Greige ein Farbton, der seit Jahren in der Welt der Mode und des Interiordesigns immer mal wieder als Letzter Schrei ausgerufen wird. Gefällt einem die Fassade deshalb? Zeigt sich das Geschmacksurteil hier von kulturindustriellen Prägungen beeinflusst und vorgeformt? Mag sein – oder auch nicht. Denn im Grunde genommen bezeichnet das Etikett »Greige« ja nichts anderes als ein ganzes Spektrum von Farben, die in der Natur allgegenwärtig sind und auch in der Architektur von alters her Verwendung finden. Kalk, Sand, Kies, Gips, Granit, Zement, Beton und Terrazzo prägen mit ihren Greige-Tönen das Gesicht zahlloser Gebäude und ganzer Städte. Als Farben der Erde, die uns an Äcker, Felsgebirge oder Sandwüsten erinnern, sind sie uns ähnlich vertraut wie Grasgrün oder Himmelblau. Wahrscheinlich sind es urheimatliche Gefühle, die ihr Anblick in uns hervorruft. Der Aspekt der modischen Distinktion? Es mag ihn geben, aber für Martin Bez und Thorsten Kock spielte er bei der Fassadengestaltung des Bürgerdienste-Hauses allenfalls eine untergeordnete Rolle.
Eher kam es den Architekten bei der Farbwahl darauf an, dem Gebäude so etwas wie ein Lokalkolorit zu verleihen. Um die Sichtschale der kerngedämmten Ortbetonkonstruktion wie gewünscht einzufärben, wurde der Betonmasse »Ulmer Weiß« beigemischt, ein in der Münsterstadt häufig verwendetes weiß-gelbliches Jurakalkgestein aus der Region. Richtig zur Geltung kommt dessen Farbigkeit freilich erst durch die handwerkliche Behandlung der Betonhülle. Die Flächen wurden gestockt, die Kanten scharriert. Nebenbei entstand auf diese Weise das natursteinähnliche Bild der Fassade.
Schräger Schnitt
Was die Form des Baukörpers angeht, so erscheint sie auf den ersten Blick ganz simpel: Über einem lang gestreckten zweigeschossigen Sockel erhebt sich an der Ostseite ein fünfgeschossiger Turm. Orthogonalität ist vermeintlich das Gesetz, das sowohl die Gliederung der Teile als auch die Form des Ganzen beherrscht – bis man die Abweichung bemerkt: Auf der Westseite ist der Turm leicht abgeschrägt, sodass er sich zur Olgastraße hin schlanker präsentiert als zur rückwärtigen Keltergasse hin, wo sich der Mitarbeiter- und Lieferanteneingang sowie die Zufahrt zum PKW-Aufzug für die Dienstfahrzeuge befinden.
Die Bürger, die einen Termin beim Meldeamt, bei der Ausländerbehörde, bei der Führerscheinstelle oder einer der anderen Dienststellen wahrnehmen möchten, betreten das Haus nicht auf einer der beiden Flanken, sondern auf der östlichen Stirnseite. Der Eingang ist dort in einen Gebäudeeinschnitt integriert, der im selben Winkel wie die westliche Turmseite abgeschrägt ist. Davor erstreckt sich ein kleiner Platz bis zur gegenüberliegenden Handelskammer. Auf diese Weise entsteht eine angemessen repräsentative Eingangssituation, die auch einen praktischen Vorteil bietet: Besucher können den Zugang sowohl von der Innenstadt als auch von der Olgastraße aus bequem erreichen.
Freundliche Präsenz
Maßgebend bei der Raumplanung war v. a. die Besuchsfrequenz. Die beiden Sockelgeschosse beherbergen demzufolge die großflächigen Servicebereiche mit viel Publikumsverkehr. Unmittelbar hinter dem Eingang befindet sich der Infotresen für den Erstkontakt mit den Besuchern. Von dort aus führt der Weg in den zentralen Wartebereich, der als doppelgeschossige Halle ausgebildet ist. Unterm Dach markiert eine großflächige Deckenleuchte den Platz, den idealerweise ein gläsernes Oberlicht hätte einnehmen sollen, doch die optimale Lösung, die den Atriumcharakter des Raums gestärkt hätte, ließ sich leider aus Kostengründen nicht realisieren. Dass die Wartehalle dennoch einen starken Eindruck macht, liegt an der Materialität des raumbildenden Rahmens. Wie bei der Außenfassade ist es auch hier gestockter, greigefarbener Sichtbeton, der den Ton angibt und der nördlichen Hallenwand, der umlaufenden Brüstung auf der Galerie sowie der Bewehrung der ins OG führenden Treppe eine Anmutung massiver und zugleich freundlicher Präsenz verleiht.
In Erscheinung tritt das charakterstiftende Material auch im fünfgeschossigen Turm, der weitere Servicestellen, Büros und Besprechungsräume beherbergt. Aus gestocktem Sichtbeton sind sowohl die Wände des tragenden Gebäudekerns als auch die Brüstungen der daran anschließenden Lufträume, die jeweils zwei Geschosse verbinden und die ansonsten nüchtern-funktional ausgestatteten Flurbereiche deutlich aufwerten.
Dass die Mélange aus weißen Wandflächen, grauen Streckmetalldecken und greigefarbenem Beton etwas eintönig wirken könnte, war den Architekten bewusst. Sie haben die Gefahr durch einen kräftigen Farbtupfer gebannt: Die Sitzkissen auf den von den Planern entworfenen Wartebänken und die schalldämpfenden Wandbespannungen der Serviceboxen in den Sockelgeschossen sind aus leuchtend rotem Filz und bilden einen belebenden Kontrast zum vorherrschenden Kolorit. Im Bereich der Wartehalle setzen zwei Wandfragmente aus rotem Backstein einen weiteren Akzent. Die Scheiben sind durch farblich hervorgehobene Streifen auf dem Terrazzoboden verbunden. Diese Streifen zeichnen den Grundriss eines Pulverturms aus dem 14. Jahrhundert nach, dessen Überreste im Zuge der Fundamentlegung des Gebäudes freigelegt wurden. »Der Fund brachte die Bauarbeiten erst einmal zum Stillstand und hätte das Projekt fast vereitelt«, sagt Martin Bez. Gut, dass es weitergegangen ist. Der Sitz der »Bürgerdienste der Stadt Ulm« gibt dem Straßenraum an einer städtebaulich empfindlichen Stelle ein neues, sympathisches Gesicht. Und mit seinem hellen und freundlichen Interieur bietet er den Besuchern eine sicherlich willkommene Erholung vom ewigen Bau- und Straßenlärm vor der Tür.db, Di., 2020.01.21
21. Januar 2020 Klaus Meyer