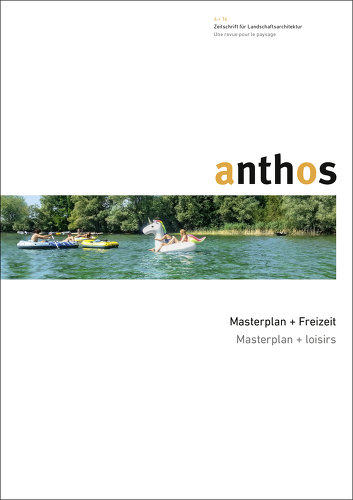Editorial
Angenommen, es wäre alles einfacher, als es tatsächlich ist. Dann liessen sich die Anforderungen an grossmassstäbliche Projekte und Konzepte allein situations- und zeitbezogen formulieren, sachlich und angemessen. Bedürfnisse der Bevölkerung würden berücksichtigt, Partikularinteressen, ökonomische Scheinzwänge und persönliche Animositäten blieben aussen vor. Der ideale Planungsuntergrund gewissermassen.
Angenommen also, es wäre so. Auch dann würde rasch festgestellt, dass die Komplexität hoch ist. Das bedingte nicht nur, dass diese Planungen über sämtliche Grenzen hinweg verliefen, geografisch, ordnungspolitisch und stofflich, sondern auch, dass sie nur inter- und transdisziplinär angegangen und «geplant» werden könnten. Zu den zeit- und situationsbedingten Anforderungen gehörten strategische Überlegungen zum Umgang mit Raum. Dass er ein endliches Gut ist, haben nicht erst Brundtlandtbericht und Nachhaltigkeitsdiskurs herausgefunden.
Dazu zählte auch, das mit der Charta von Athen übernommene Dogma der Funktionentrennung zu überwinden. Es beeinflusst längst nicht nur die Stadtplanung, in der es hübsch Wohnen von Arbeiten und Freizeit trennt, es hat sich längst in allen Bereichen eingenistet: Das Naturschutzgebiet liegt neben dem Naherholungsgebiet, neben dem Siedlungsrand mit den Wohnhäuschen, neben den Arbeitsplätzen.
Wenn es einfacher wäre, als es ist, würde der Raum gesamthaft gedacht und multifunktional entwickelt. Ein Ansatz wären Überlagerungen. Naturschutz und (verträgliche) Erholungsnutzungen könnten übereinander liegen und Synergien finden: höhere Akzeptanz und kürzere Wege. Überlagerungen könnten auch neue, clevere Finanzierungsstrategien hervorbringen, wenn beispielsweise Mittel für Hochwasserschutz, Verkehrsinfrastruktur, Erholung/Tourismus und Freiraumplanung miteinander gekoppelt werden.
Im Wohnungsbau werden derzeit an so vielen Orten neue Projekte angestossen. Es wird Zeit, dass auch in räumlichen und infrastrukturellen Planungen mit bestehenden Instrumenten wie Masterplänen und Freiraumkonzepten innovative Lösungen entwickelt werden: systemisch (im Sinne von ganzheitlich und inklusiv), prozessual (mit klar definierten Strukturen, Abläufen, Entscheidungswegen), dynamisch (sozial, kulturell und ökologisch offen, anpassungs- und widerstandsfähig).
Der Konjunktiv wunderbar. Laut Duden verwenden wir ihn für Situationen, die nicht real, sondern nur möglich sind. Ein Anfang ist es allemal.
Sabine Wolf