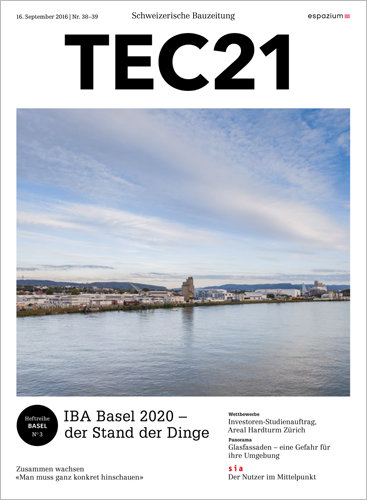Editorial
Innehalten, durchschnaufen, eine Standortbestimmung vornehmen – das machen Mannschaften in der Halbzeitpause. Und anschliessend geht man im besten Fall mit gesammelten Kräften zurück aufs Feld, versucht, Ergebnisse zu verbessern, gute Ansätze zu vertiefen.
Bei der Internationalen Bauausstellung IBA Basel 2020 geht es in die zweite Halbzeit. Die Plattform, die als Planungsinstrument die trinationale Region am Rheinknie zusammenwachsen lassen will, präsentiert dieser Tage im Rahmen der IBA Basel Expo 2016 den aktuellen Projektstand der interessierten Öffentlichkeit. Von einst 110 Projekten sind inzwischen drei umgesetzt und mit dem IBA-Label ausgezeichnet, 19 befinden sich auf gutem Weg, bei zehn scheint eine zumindest teilweise Realisierung bis 2020 möglich – wenn es der IBA gelingt, an den Schwung der ersten Halbzeit anzuknüpfen.
In den vergangenen Jahren hat TEC21 kontinuierlich über Entstehung, Etablierung und Fortschritte der IBA Basel 2020 berichtet. Nun schliessen wir uns der Standortbestimmung an, zeigen einen Überblick über die aktuellen Planungen und vertiefen einige exemplarische Projekte. Ein Interview mit IBA-Geschäftsführerin Monica Linder-Guarnaccia ergänzt die Beiträge um die Innensicht. Viel Spass beim Entdecken!
Tina Cieslik
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Hexenkessel mit zwei Türmen
15 PANORAMA
Perspektiven für die Agglomeration? | Glasfassaden – eine Gefahr für ihre Umgebung
22 VITRINE
Happy Birthday | Drinnen und draussen | Holz 2016
29 SIA
Der Nutzer im Mittelpunkt | Reduktion von Teilsicherheitsbeiwerten nicht zulässig | Neuer Geschäftsbereich «Kommunikation» | Erdbebensicher entwerfen | Ausbildungsinitiative für Bauleiter
35 VERANSTALTUNGEN
THEMA
36 IBA BASEL 2020
36 ZUSAMMEN WACHSEN
Tina Cieslik
Halbzeit heisst Standortbestimmung bei der IBA Basel 2020: ein Überblick über die laufenden IBA-Projekte, ergänzt um ausgewählte Vertiefungen.
42 «MAN MUSS GANZ KONKRET HINSCHAUEN»
Judit Solt
Zwei Sprachen, drei Länder, unzählige Akteure: Geschäftsführerin Monica Linder-Guarnaccia gewährt TEC21 einen Blick hinter die Kulissen der IBA.
AUSKLANG
49 STELLENINSERATE
53 IMPRESSUM
54 UNVORHERGESEHENES
Zusammen wachsen
Am Anfang war es eine Vision: drei Länder, vier Bundesländer, Kantone oder Departemente und eine Vielzahl an Städten und Gemeinden zu einer Region zusammenwachsen zu lassen – zwischenmenschlich, räumlich, aber auch politisch und planerisch. Inzwischen ist diese Idee, wenn auch noch nicht realisiert, so doch auf dem Weg dazu, Schritt für Schritt umgesetzt zu werden.
Entstanden ist die IBA Basel 2020 aus der Arbeit des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB), einer Plattform, die das grenzüberschreitende Wirken auf der Ebene der Politik und der Verwaltung koordiniert. Die konzeptionellen und strategischen Planungen dieser Plattform schloss man 2009 mit einem Memorandum ab. Der Wunsch: ein grenzüberschreitendes Projekt für die Region. Zur Auswahl standen zunächst auch eine Expo oder eine Bewerbung für die Olympischen Spiele. Das Rennen machte mit einer Internationalen Bauausstellung IBA schliesslich ein Format, das in Deutschland eine lange Tradition hat. Ursprünglich tatsächlich als Werkschau zur zeitgenössischen Baukultur konzipiert, entwickelte sich das Format über die Jahre zu einem alternativen, jeweils temporär begrenzten Instrument von Städtebau und -planung.
In Basel startete die Umsetzung im Herbst 2010, im April 2011 ging man mit einem Projektaufruf an die Öffentlichkeit. Das Ergebnis waren weit über 100 Projektvorschläge. Ein wissenschaftliches Kuratorium prüfte sie auf die Kompatibilität mit den IBA-Kriterien «Modellcharakter», «transnational» und «Exzellenz (sozial, ökonomisch, ökologisch)» und kategorisierte sie in den Handlungsfeldern «Landschaftsräume», «Stadträume» und «Zusammen leben». Bei den Konzepten handelte es sich sowohl um bereits bestehende Planungen, die sich durch die Einbettung in die IBA einen neuen Schub erhofften, als auch um neue Ideen.
So geordnet und mit Empfehlungen zur Weiterbearbeitung ausgestattet, stellten sich die mehr als 40 übrig gebliebenen Projekte Anfang November 2011 der Öffentlichkeit vor. Auf Grundlage der Empfehlungen des Kuratoriums werden die Projekte Schritt für Schritt weiterentwickelt und durch das IBA-Büro begleitet. Dabei durchlaufen sie mehrere Stufen: Kandidatur, Vornominierung, Nominierung und Label.
Eine dreiwöchige Ausstellung der damaligen 43 vornominierten Projekte wurde im Herbst 2013 in Basel gezeigt. In der anschliessenden Vertiefungsphase galt es, die Machbarkeit zu konkretisieren. Die Rolle der IBA ist dabei vielfach die eines Moderators, der die Beteiligten an einen Tisch bringt, die Planungsprozesse begleitet und bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten hilft. Die Schwierigkeiten dabei liegen oft im Alltäglichen: abweichende Zeit- und Geldbudgets oder unterschiedliche Abläufe in politischen Prozessen (vgl. Interview: «Man muss ganz konkret hinschauen»).
Aktuell läuft die zweite Halbzeit der IBA Basel 2020: Bis zum 20. November können die drei bereits umgesetzten Projekte mit Label sowie die nominierten Konzepte im Rahmen der Zwischenpräsentation in der Voltahalle in Basel besichtigt werden. Dann gilt es, zum Endspurt anzusetzen: Wer sich mit dem IBA-Label schmücken will, muss in den beiden kommenden Jahren zumindest eine Teilumsetzung bis 2020 nachweisen können.(Tina Cieslik)
Ein Weg am Fluss: Rheinliebe
Die IBA Basel 2020 möchte die grenzüberschreitende Kooperationskultur zwischen Frankreich, der Schweiz und Deutschland im Raum Basel fördern. Dem Rhein als verbindendem, oft aber auch trennendem Element kommt dabei eine besondere Rolle zu: Zum einen ist «Vater Rhein» eine starke Identifikationsfigur, zum anderen zwingt die gemeinsame Verantwortung und Nutzung der ökologischen und wirtschaftlichen Ressourcen des Flusses zu kooperativem Handeln.
So erstaunt es nicht, dass beim Projektaufruf im Jahr 2011 mehrere Konzepte mit Bezug zum Fluss eingingen. Um die verschiedenen Ansätze und Ideen zu koordinieren, fasste die IBA Basel sie in der Projektgruppe «Rheinliebe» zusammen. Langfristig soll sich die ca. 80 km lange Zone an beiden Ufern zu einem zusammenhängenden und für die Bevölkerung zugänglichen Natur- und Landschaftspark entwickeln. Unter dem Dach der «Rheinliebe» entwickelte die ARGE Studio Urbane Landschaften im Auftrag der IBA einen sinnlichen Zugang zum Territorium, identifizierte «Verführungs-, Verschlossene und Bewundererlandschaften». Konkret verfolgt man unter anderem folgende Projekte: den Rheinuferweg St. Johann–Huningue (vgl. TEC21 20/2016); «Bad Bellingen rückt an den Rhein»; «RhyCycling revisited», den Rheinfelder «Rheinuferweg extended» und «Entdeckung Rhein».
Während bei den Rheinuferwegen die Erschliessung der Ufer als Erholungszone im Fokus steht, soll «Bad Bellingen rückt an den Rhein» den bisher durch Bahntrassee und Autobahn vom Altrhein abgetrennten Kurort näher an den Fluss bringen – mittels besserer Erschliessung für Fussgänger oder neuer Kanustationen. «RhyCycling revisited» untersucht die Kreisläufe von (Abfall-)Materialien rund um den Fluss. Die Ergebnisse werden in einem digitalen Archiv räumlich und zeitlich dokumentiert. Ein wichtiger Punkt der «Rheinliebe» ist der Anspruch an Vollständigkeit: Um alle Uferabschnitte einzubeziehen, hat die IBA Basel weitere Projektträgerschaften für die grenzüberschreitende «Rheinliebe» gewinnen können.
Die Projekte sind unterschiedlich weit fortgeschritten: So konnte im April der Rheinuferweg zwischen dem baslerischen St. Johann und dem französischen Huningue eingeweiht werden. Das Projekt hat das IBA-Label erhalten. Bei der Erweiterung des Rheinuferrundwegs in Rheinfelden hat im Herbst/Winter 2014/15 ein Projektwettbewerb für einen Steg über den Fluss stattgefunden, im Frühsommer 2017 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden – der Projektstand entspricht einer Nominierung. (Tina Cieslik)
Industrie mit neuer Aufgabe: DMC Mulhouse
Das 75 Hektaren grosse Areal der ehemaligen Textilfabrik DMC (Dollfuss, Mieg & Cie) im französischen Mulhouse gehört zur IBA-Projektgruppe «Transformationsgebiete». Seit sich die Textilindustrie in den Fernen Osten verlagerte, ging die Produktion sukzessive zurück, das Areal wurde zur Industriebrache. Durch die gemeinsame Planung von unterschiedlichen Nutzern und der Stadt Mulhouse kann das historisch bedeutende Industriegebiet in den nächsten Jahrzehnten schrittweise umgenutzt und aufgewertet werden. Mit der Eröffnung des Tram-Trains, einer S-Bahn zwischen Mulhouse und Dornach (F), begann die Stadt 2010 die Rückeroberung des Quartiers im Herzen von Mulhouse.
Zu den Schwerpunkten des nominierten IBA-Projekts gehört es, temporäre Nutzungen zu fördern, bestehende Gebäude zu sanieren und Freiräume aufzuwerten. Dabei setzt das neue Quartier auf kulturellen und kreativen Unternehmergeist, nachhaltige Wirtschaft und Dienstleistungen. In einem Teil der bestehenden 100 000 m² grossen Fabrikhallen haben sich bereits Kreativunternehmen niedergelassen. Die mehr als 60 Kunst- und Theaterschaffenden, Fotografen, Grafiker, Tontechniker, Schreiner, Bildhauer, Szenografen und Tanzgruppen aus Mulhouse und der grenzüberschreitenden Region sind im Verein Motoco («more to come») zusammengeschlossen. Dank der Unterstützung durch Bürgermeister Jean Rotter konnte der Verein im Juni 2013 das Gebäude pachten und sich ein Vorkaufsrecht sichern.
Mit der Idee des Openparc hat Motoco-Gründer Mischa Schaub das Angebot seit 2015 erweitert. Es umfasst die vier Themencluster Openfab, Openstudio, Openhost und Playerpiano. Als Beispiel stellt der im Gebäude 75 beheimatete Verein Openfab Prototypen und Kleinserien in einem Maschinenpark her. Nach der 2016 abgeschlossenen Instandsetzung des Gebäudes 75 steht die Sanierung der weiteren Gebäude noch aus. Da diese aufwendig und kostenintensiv ist, suchen die Nutzer Kooperationen mit lokalen Partnern, europäischen Hochschulen und mit Förderprogrammen der EU.
Zum IBA-Projekt nominiert wurde das DMC, weil die zahlreichen Veranstaltungen das Gelände zurück in das Gedächtnis der trinationalen Bevölkerung bringen. Openparc ist ein Musterbeispiel für grenzüberschreitende Bottom-up-Prozesse. Die IBA unterstützt das Projekt durch Networking, auf der Suche nach Finanzierungs- und Koordinationspartnern sowie mit dem IBA-Hochschullabor, in dem Studierende Ideen für das Gelände erarbeiten. Um den Standort leichter zugänglich zu machen, plant die Stadt, bis 2020 die Verbindung zwischen dem Quartier und dem Bahnhof Dornach (F) zu verbessern. Durch neue Wegverbindungen und Durchbrüche in der Mauer, die das Gelände heute fast vollständig umgibt, soll das Quartier bis 2020 zur Stadt hin geöffnet werden. Grünflächen und die Biodiversität des Geländes werden zukünftig sichtbarer und können die Partnerschaften mit umliegenden Schulen und Vereinen verbessern.
Von Schweizer Seite wird Mulhouse als Kreativraum noch zu wenig wahrgenommen. Das Projekt bietet die Chance, die noch verhaltene Beziehung zwischen der wirtschaftlich und kulturell starken Stadt Basel und dem Entwicklungsraum Elsass zu stärken. (Katharina Marchal)
Infrastruktur besser nutzen: Aktive Bahnhöfe
Mit der Aufwertung der Bahnhöfe in der Region Basel will das Projekt nachhaltige Impulse für eine grenzüberschreitende Mobilität setzen. Der ganzheitliche Ansatz reicht von einer einheitlichen Signaletik bis zu städtebaulichen Konzepten im Umfeld der Bahnhöfe.
Ausgangspunkt war die Charta «Aktive Bahnhöfe» vom September 2013, mit der die folgenden fünf Bahnhöfe näher untersucht wurden: Badischer Bahnhof Basel, Gare de Saint-Louis, Hauptbahnhof Lörrach, Bahnhof Rheinweiler und Bahnhof Rheinfelden (Baden). Bereits die erste Analyse zeigte erheblichen Handlungsbedarf: Die Defizite reichen von der uneinheitlichen Bezeichnung für die Anbieter des öffentlichen Verkehrs über fehlende Pläne zum Dreiland und fehlende Tarifinformationen bis zu einem fehlenden Besucherleitsystem vom Bahnhof zu anderen Mobilitätsangeboten und fehlenden Informationen für fremdsprachige Gäste. Mittlerweile sind insgesamt 14 Bahnhöfe der S-Bahn in Frankreich, Deutschland und der Schweiz am Projekt beteiligt. Möglich war dies dank einem intensiven Dialog zwischen den beteiligten Gemeinden und den nationalen und regionalen Bahngesellschaften.
Mit gemeinsamen Standards sollen die Bahnhöfe zu modernen Mobilitätszentren entwickelt werden. Beginnen will man mit einem einheitlichen Besucherleitsystem; eine Liniennetzkarte soll an allen Bahnhöfen ausgehängt werden. Dazu kommt eine regionale Karte, die auf die jeweilige Ortschaft ausgerichtet ist, und eine Karte des Quartiers mit Angaben zur unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs. Zusammen mit Informationen über die Tarife werden alle diese Inhalte übersichtlich und dreisprachig (deutsch, französisch, englisch) auf Stelen präsentiert. Ziel dieser Massnahmen ist es, die Orientierung mit einem grenzüberschreitenden, einheitlichen Auftritt zu erleichtern.
Die Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen sollen vermehrt «Teil des öffentlichen Lebens» werden, wie Dirk Lohaus, der zuständige Projektleiter der IBA Basel, sagt.[1] Um dieses Ziel zu erreichen, will man das Angebot an Nutzungen und Dienstleistungen erweitern und vermehrt Konsumgüter des täglichen Bedarfs am Bahnhof anbieten. Auch der Umstieg von einem Verkehrsmittel zum anderen, vom Carsharing-Auto zum Fahrrad, zur Strassenbahn oder zum Sammeltaxi, kann verbessert werden. Generell sollen die Aufenthaltsqualität in den Bahnhöfen erhöht und die Umgebung der Bahnhöfe attraktiver werden.
Bereits im Oktober wird mit dem Hauptbahnhof Lörrach der erste Pilotstandort fertiggestellt sein. Weitere sechs Bahnhöfe folgen bis Ende 2016, und auch die Charta soll im kommenden Jahr überarbeitet werden. Ziel ist es, bis 2020 alle 14 Standorte zu realisieren. Darüber hinaus wirkt das Projekt als Katalysator, der neuen Partnern die Mitwirkung erleichtert und sie dazu motiviert, ihre Bahnhöfe ebenfalls zu aktivieren. So setzen viele im Sog der für das Label der IBA Basel nominierten Beiträge die Ziele dieses IBA-Projekts auch ohne Label um.
Das Projekt verdeutlicht, wie sichtbar die Landesgrenzen in Basel noch immer sind und wie schwer es fällt, sie zu überwinden. Auch deshalb müssen zuerst die Grundlagen geschaffen werden, wie beispielsweise ein einheitliches mehrsprachiges Besucherleitsystem und ein trinationaler Tarifverbund. Das Projekt setzt genau da an und will mit einer Initialzündung an 14 Bahnhöfen Impulse für das ganze Netz des öffentlichen Verkehrs geben. Ein ambitioniertes Projekt ganz im Sinn des Mottos der IBA Basel: «Au-delà des frontières, ensemble – Gemeinsam über Grenzen wachsen». (Jean-Pierre Wymann)
Anmerkung:
[01] BZ, Badische Zeitung, 23. August 2014.
Mobiler Katalysator: IBA KIT
Das nominierte Projekt IBA KIT ist Teil des Pilots «Trinationale Freiraumproduktion», das im Rahmen der IBA Basel 2020 ins Leben gerufen wurde. Mit dem Projekt sollen die Nutzung und Gestaltung von urbanen Freiräumen experimentell erforscht und gezielt gefördert werden. Die Beteiligten sind vor allem die Stadtgärtnereien der drei Länder (F, D, CH), die zusammen mit der IBA Basel das Projekt erarbeitet haben und weiterhin verfolgen. Aktive Mitwirkung kommt vonseiten der Bevölkerung, die die IBA KITs testet und sich für Umfragen und Studien zur Verfügung stellt.
Die Gemeinde Riehen hat in Zusammenarbeit mit dem Basler Landschaftsarchitekturbüro Bryum als erste Gemeinde der IBA-Projektpartner einen Prototyp entwickelt, eine «temporäre Freiraumkiste», genannt IBA KIT. Es ist ein partizipatives Werkzeug, das je nach den Erwartungen und Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer gestaltet wird. Fest vor Ort stehend oder mobil, fordert es Bewohner und lokale Institutionen auf, sich aktiv an der Entwicklung und Verbesserung ihrer Lebensumgebung zu beteiligen. Das erste IBA KIT stand von November 2013 an ein Jahr lang der Bevölkerung des Niederholzquartiers von Riehen als Freiraumangebot und multifunktionales Spielelement zur Verfügung. Unterschiedliche, gratis nutzbare Spiel- und Freizeitgeräte richteten sich vor allem an die jüngere Generation und an Familien.
Im roten Container befanden sich unter anderem Schaukeln für Kleinkinder, Tisch und Sitzbänke sowie ein Badmintonnetz mit Schlägern. Die Kiste enthielt ausserdem sechs abschliessbare Spinde, in denen interessierte Bewohner und Quartiergruppen eigene Spielgeräte unterbringen konnten. Zwei offene Spinde beinhalteten Spielgeräte, aber auch Kehrschaufel, Besen und Abfallzange. Nach dem ersten Pilotprojekt und der Platzierung auf der Andreasmatte in Riehen wurden die Quartierbewohner im Umkreis der Freiraumkiste schriftlich befragt. In einer Studie wurden anschliessend Beurteilungen des Projekts sowie Verbesserungsvorschläge analysiert. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in die weitere Gestaltung des Projekts eingeflossen.
Von der Andreasmatte und dem Sarasinpark wanderte das IBA KIT Riehen über die Grenze, zur Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Lörrach-Brombach (D). Dort sorgten seine Spiel- und Sportgeräte für Abwechslung im Alltag der Bewohner. Im Mai 2015 weihten die multikulturellen Bewohner eines Plattenbauviertels in Saint-Louis (F) ihr IBA KIT als Treff- und Austauschort ein. Ein Anwohnerverein gründete hier einen Gemeinschaftsgarten. Im Oktober 2015 lud das IBA KIT Rheinfelden (Baden) die Bewohner ein, sich einen neuen Park anzueignen und nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Um das KIT entstanden eine Gärtnergruppe, ein Mountainbike-Pumptrack und eine Boulegruppe. Im Juni 2016 weihte die Gärtnerei der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel das IBA KIT UPK ein, das eine Etappe des neuen grenzüberschreitenden Spazierwegs Burgfelderpark bildet. Es soll den Austausch zwischen UPK und dem Umfeld stärken.
Derzeit existieren vier IBA KITs. Bis Ende des Jahres werden vier weitere in Weil am Rhein, Lörrach, Mulhouse und Basel-Stadt errichtet. Die bisher gesammelten Erfahrungen zeugen von deren Fähigkeit, verschiedene soziale Gruppen zusammenzubringen, neue Funktionen in die Quartiere zu integrieren und so ein gutes Zusammenleben zu fördern. (Katharina Marchal)
Terra incognita wird Begegnungsort: IBA Parc des Carrières
Noch wird hier Kies abgebaut: Der geplante IBA Parc des Carrières, hart an der Landesgrenze zwischen Frankreich und der Schweiz, ist heute ein unzugänglicher Ort. Während die Siedlungsbebauung von Basel und Allschwil bis an die Grenze reicht, ist die gegenüberliegende Seite von Landwirtschaft und Familiengärten geprägt – und von einer Grube, in der im Trockenabbau auf einer Tiefe von bis zu 14 m Kies gewonnen wird. Die meisten Wege enden an der Grenze.
Doch in dem unbebauten Terrain liegt die Chance – schon bald soll sich die elf Hektaren grosse Kernzone zu einem länderübergreifenden Grünraum entwickeln, der den Gemeinden Allschwil, Basel, Saint-Louis und Bourgfelden und Hégenheim als Begegnungsort dienen soll. Die Grube ist noch bis 2040 in Betrieb, die Transformation geht also sukzessive vonstatten. Das Projekt, eine Public Private Partnership von IBA Basel, Bürgerspital Basel, Kanton Basel-Stadt, Gemeinde Allschwil, Ville de Saint-Louis, Commune de Hégenheim und Communauté d’Agglomération des Trois Frontières, plant dafür mit vier Etappen: Die erste sieht grüne Korridore mit Langsamverkehrswegen vor, die die Parzelle und andere grüne Gürtel verbinden, sowie den Bau eines Kinderspielplatzes als erstes Zentrum.
Die drei folgenden Phasen betreffen die Transformation der drei bereits abgebauten Kiesgrubenabschnitte. Daneben muss die freie Zufahrt für die Kiesgrubenbetreiberin gewährleistet bleiben. Die abgebauten Kiesabschnitte werden gemäss ihrer Besonderheiten renaturiert und zum Park umgewandelt: Die ersten beiden Parzellen werden als artenreiche Magerwiesen mit einzelnen Gehölzgruppen und Kieselelementen gestaltet und extensiv landwirtschaftlich genutzt. Parzelle 3 hebt sich von den eher landschaftlichen Flächen ab: Ein Ringweg mit Stegen bildet eine gestaltete Parklandschaft.
Ein wichtiger Punkt betrifft die Anbindung an die bestehenden Siedlungsstrukturen: Korridore nach Allschwil, Basel und Bourgfelden sorgen für eine einfache Erschliessung. Aufbauend auf einer Entwicklungsstudie von 2013 (IBA Basel 2020; Courvoisier Stadtentwicklung, Basel; Digitale Paysage, Bauxwiller) erarbeitete man ein Vorprojekt, das die Investitions- und Unterhaltskosten konkretisierte. Damit beauftragt wurden die Landschaftsarchitekten pg landschaften aus Sissach und LAP’S (Les ateliers paysagistes) aus Bartenheim. Mit den ersten Arbeiten, den Korridoren, wird für 2017 gerechnet. Bis 2022 sollen die ersten Etappen umgestaltet sein, die Fertigstellung ist bis in etwa zehn Jahren vorgesehen.
Die Transformation der Kiesgrube steht in einem grösseren Kontext: Zum einen dient sie als Pilotprojekt im Rahmen der IBA-Projektgruppe «Kiesgruben 2.0 – Seen und Parks für die Region». Hier werden Zukunftsszenarien für die Kiesgruben der Region entwickelt. Zum anderen ist der IBA Parc des Carrières ein Baustein von aktuellen Planungen im Umfeld. Mit der Verlängerung der Tramlinie 3 und der Planung einer Umfahrungsstrasse (Route des Carrières und Zubringer Allschwil) sind zurzeit grosse Infrastrukturprojekte in Bearbeitung. Schliesslich sind mit der Öffnung und Aufwertung der Freizeitgärten, dem Freiraumkonzept Allschwil und dem Projekt «Trame verte» der Stadt Saint-Louis komplementäre Vorhaben in Planung. Die IBA übernimmt dabei die Koordination zwischen den verschiedenen Projekten. Der IBA Parc des Carrières besitzt aktuell den Status «nominiert» und ist bis 2020 auf gutem Weg zur Labelisierung.TEC21, Fr., 2016.09.16
16. September 2016 Tina Cieslik