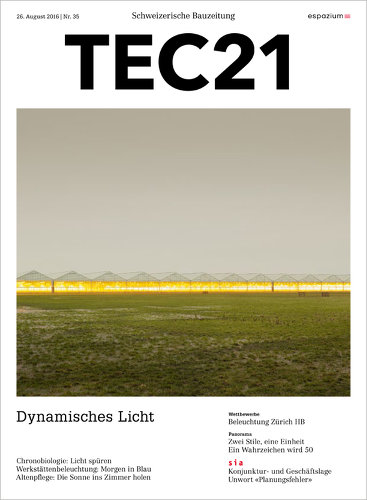Editorial
«Mensch und Gesundheit» – so lautete eines der Topthemen der diesjährigen Light & Building, der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, die Ende März in Frankfurt am Main stattfand. Licht taktet unsere innere Uhr. Fehlt ein ausreichender Bezug zum Tageslicht – was in unserer 24-Stunden-Gesellschaft immer häufiger der Fall ist –, können dynamische Beleuchtungssysteme einspringen. Sie ergänzen herkömmliches Kunstlicht und variieren ihre Lichtstärke und -farbe analog zum Tagesverlauf.
Das wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus – Schlafqualität, Konzentrationsfähigkeit und allgemeines Wohlbefinden steigen. Wichtig ist dies vor allem für immobile Personen, etwa alte Menschen. Denn mit dem Alter nimmt zum einen der Lichtbedarf zu, zum anderen haben gebrechliche Personen oder Menschen mit einer Behinderung oft weniger Möglichkeit, nach draussen zu gehen. Neben Büros sind daher Pflegeeinrichtungen ein Haupteinsatzort von dynamischen Beleuchtungen. Mit steigender Tendenz: Eine Marktstudie der Elektro- und Lichtbranche ergab, dass bis im Jahr 2020 bereits 7% aller Leuchten dynamisch gesteuert sein werden.
Um sich wohlzufühlen, genügt eine technisch optimierte Beleuchtung allein jedoch nicht. Auch ästhetische Ansprüche möchten erfüllt sein. Der Entwurf von Leuchten ist daher eine beliebte Aufgabe von Architektinnen und Architekten.
Nathalie Cajacob, Nina Egger
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Maximal einleuchtend
10 PANORAMA
Zwei Stile, eine Einheit | Ein Wahrzeichen wird 50 | Zu Hause im Stahl
16 VITRINE
Leuchtenbauer | Aktuelles aus der Baubranche
22 SIA
Solide Entwicklungen im Projektierungssektor | Unwort «Planungsfehler» | Engagierter Wegbereiter
27 VERANSTALTUNGEN
THEMA
28 DYNAMISCHES LICHT
28 LICHT SPÜREN
Anna Wirz-Justice, Colin Fournier
Licht ermöglicht mehr als nur Sehen – wie Chronobiologie Architektur beeinflussen kann.
31 MORGEN IN BLAU
Mathias Wambsganß, Johannes Zauner
Eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung entschied sich für dynamische Beleuchtung. Ebenso wichtig ist die Wahl der Oberflächen.
34 DIE SONNE INS ZIMMER HOLEN
Tina Cieslik
Dynamische Beleuchtung kann die innere Uhr von immobilen Menschen unterstützen. Das zeigen drei Beispiele aus der Altenpflege.
AUSKLANG
38 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Licht spüren
Erst wenn Licht auf unsere Augen trifft, können wir sehen. Doch unsere Augen steuern auch, wann wir wie wach und konzentriert sind. Unser Wohlbefinden hängt vom rechten Licht zur rechten Zeit ab. Das soll sich auch in Architektur und Planung niederschlagen.
Schon der grosse Architekt Louis Kahn wusste: «Wenn ich einen Plan sehe, der versucht, mir Räume ohne Licht zu verkaufen, verwerfe ich ihn einfach, ohne weiter über ihn nachzudenken, weil ich weiss, dass er falsch ist.» Tatsächlich ermöglicht uns (Tages-)Licht mehr als die rein visuelle Wahrnehmung. Mit den Auswirkungen des 24-stündigen Hell-Dunkel-Zyklus und den jahreszeitlich bedingten Änderungen der Tagesdauer auf Biochemie, Physiologie und das Verhalten lebender Organismen befasst sich die Chronobiologie, die Wissenschaft von den biologischen Rhythmen.
In den letzten 25 Jahren entwickelte sie sich zu einem bedeutenden Forschungsgebiet, was insbesondere auf die Entdeckung der Uhrengene und einer neuen Fotorezeptorzelle im Auge zurückzuführen ist. Letztere hat einen spezifischen Einfluss auf das circadiane System. Der innere Rhythmus wird «circadian» genannt, da er lediglich «circa diem» ist, seine Periodizität also nur ungefähr, aber nicht exakt bei 24 Stunden liegt. Die innere Zeit muss in den äusseren 24-Stunden-Tag über sogenannte «Zeitgeber» mitgenommen werden. Der wichtigste Zeitgeber für Menschen ist das Licht.
1980 entdeckten Forscher, dass es eine Lichtstärke von mehr als 1000 Lux braucht, um das circadiane System des Menschen zu beeinflussen. Dieser Wert entspricht der Lichtstärke im Freien, wenn die Sonne über den Horizont steigt.
Die biologische Uhr des Menschen
Das circadiane Zeitmesssystem besteht aus einer Anzahl untereinander verknüpfter Elemente. Jeder Mensch verfügt in seinem Gehirn über eine biologische Uhr. Gewisse Hormone (wie das in der Zirbeldrüse hergestellte Melatonin) können einen Rückkopplungseffekt auf diese Hauptuhr haben.
Informationen aus der Umwelt werden über Fotorezeptoren in den Ganglienzellen übermittelt, die das Fotopigment Melanopsin enthalten. Letzteres ist äusserst empfindlich gegenüber dem kurzwelligen Ende des sichtbaren Lichtspektrums, dem blauen Licht. Diese Fotorezeptoren sind mit einem nichtvisuellen Trakt verbunden, der zum Nucleus suprachiasmaticus führt, einem Kerngebiet im Hypothalamus, in dem die innere Hauptuhr angesiedelt ist.
Nichtvisuell bedeutet, dass hier Informationen über Beleuchtungsstärke und Lichtspektrum übermittelt werden – im Gegensatz zu den klassischen Fotorezeptoren Stäbchen und Zapfen, die mit dem Sehtrakt verbunden sind. Letzterer führt in Gehirnbereiche, die für die Wahrnehmung von Farben, Linien, Bewegung und Formen verantwortlich sind. Uhrengene sind ein wichtiger Bestimmungsfaktor unserer circadianen Rhythmik. Individuen unterscheiden sich stark voneinander, was zu Unterschieden im Schlaf-Wach-Zyklus oder zu sogenannten Chronotypen führt (frühe Chronotypen = «Lerchen», späte Chronotypen = «Eulen»).
Zusätzlich zu einem genetischen Bestimmungsfaktor ändert sich der Chronotyp im Lauf der Entwicklung. So sind Kinder eher Frühaufsteher, zu Beginn der Pubertät verschiebt sich ihr Schlaf-Wach-Zyklus aber zunehmend auf spätere Zeiten. Ab dem Ende der Adoleszenz kehrt sich diese entwicklungsmässig bedingte Verzögerung langsam um und führt schliesslich zum frühen morgendlichen Erwachen und frühen Zubettgehen älterer Menschen. Deswegen kann man auf Teenager und Bewohner von Pflegeheimen nicht dieselben Beleuchtungskriterien anwenden und darf nicht davon ausgehen, dass ein bestimmtes, zeitlich fixiertes Lichtprogramm auf Personen mit verschiedenen Chronotypen passt.
Eindeutig hingegen sind die Ergebnisse bei der Untersuchung saisonaler und nichtsaisonaler Depression wie auch bei einer Reihe psychiatrischer und neurologischer Störungen. Sie zeigen, dass ein nach Intensität, Dauer und Zeitpunkt strukturiertes Lichtprogramm therapeutische Wirkung entfaltet. Um diese Krankheiten zu vermeiden, ist daher besonderes Augenmerk auf die tägliche Lichtexposition zu richten. Letztere ist als grundlegender Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden zu betrachten.
Umsetzung in die Praxis
Was aber bedeuten diese Erkenntnisse für Planung, Architektur und Innenarchitektur? Folgende Richtlinien können als Leitfaden dienen:
Es kann sinnvoll sein, dass in Wohnungen und an Arbeitsplätzen zu gewissen Tageszeiten eine höhere Lichtintensität herrscht, ohne dass der visuelle Komfort beeinträchtigt wird. Dies ist jedoch nicht in allen Bereichen nötig (Energieverlust), sondern vor allem in der Nähe des menschlichen Auges. Unterschiedliche Chronotypen erfordern personalisierte Lichtprogramme.
Spezifische Anforderungen verschiedener Altersgruppen müssen berücksichtigt werden. Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommt ein helles Morgenlicht so früh wie möglich nach dem Aufstehen (am Frühstückstisch) oder auch eine im Schlafzimmer simulierte Dämmerung zugute.
Schulräume können in der ersten Stunde helle Beleuchtung brauchen. Im Gegensatz hierzu kann Abendlicht älteren Personen in ihrer bevorzugten Umgebung dabei helfen, vor dem Zubettgehen länger wach zu bleiben.
Diese höhere Lichtintensität sollte so weit wie möglich durch die Verwendung von natürlichem Licht erreicht werden, da es im Vergleich zu künstlichem Licht stärkere Beleuchtung und zudem weitere Zeitgebersignale bietet: variierende Beleuchtungsgrade, Farbtemperatur (vgl. Glossar; Kasten unten) und Sonnenausrichtung im Tagesverlauf von morgens bis abends. Auch die verschiedenen Arten von Zwielicht entfalten eine biologische Wirkung und umfassen sieben Grössenordnungen unterhalb des bei Sonnenaufgang herrschenden Lichts.
Innenräume von Gebäuden sollten so gestaltet sein, dass sie die durch Lauf und Stand der Sonne bedingten Mitnahmesignale nicht behindern, indem beschattete Flächen minimiert werden und der Ausblick in die Ferne ermöglicht wird.
Das verbreitetste Beispiel einer solchen Gestaltung ist die Ausrichtung von Schlafzimmern Richtung Osten, sodass die Lichtverhältnisse am Morgen auf den physiologischen Zeitpunkt des Erwachens abgestimmt sind. Es kann von Vorteil sein, dieses Prinzip auf andere Tätigkeiten anzuwenden, die regelmässig innerhalb von Gebäuden stattfinden.
Fehlt ausreichend Tageslicht, sollte die künstliche Beleuchtung jene Prinzipien des natürlichen Lichts simulieren, die für die Chronobiologie relevant sind.
Bei der Flächennutzung sollte die Stadtplanung das umfassende Erleben circadianer und saisonaler Rhythmen der natürlichen Umwelt ermöglichen.
Künstliches Licht: nah am Original
Die Entdeckung des blauempfindlichen melanopsinhaltigen Fotorezeptors sowie Studien, die aufzeigen, dass monochromatisches Blaulicht am wirksamsten ist, um Melatonin zu unterdrücken, die Phasen circadianer Rhythmen zu verschieben sowie Wachsamkeit und Leistung zu steigern, haben dafür gesorgt, dass die Entwicklung von Beleuchtungssystemen mit hoher Farbtemperatur intensiv vorangetrieben wurde.
Indes ist das circadiane System nicht ganz so einfach und zu viel Blaulicht nicht immer positiv. Rotes Licht kann den Melanopsin-Fotorezeptor dahingehend sensibilisieren, die Melatoninunterdrückung und Phasenverschiebung zu verstärken. Demzufolge spielen die Zapfen, die bei Tageslicht der aktiven Sehfunktion dienen, auch eine Rolle. Zukünftige dynamische Beleuchtungssysteme sollten Licht in verschiedenen Farben für verschiedene Zwecke (erhöhte Wachsamkeit oder Hilfe beim Einschlafen) in bestimmter Abfolge und in verschiedenen Intensitäten erzeugen.
Schon heute sind Gebäude mit zahlreichen Zeitmessgeräten und Sensoren ausgerüstet, die während des Tageszyklus verschiedene Parameter der inneren Umgebung justieren; die Temperaturregelung ist das beste Beispiel. In Zukunft könnten auch Fotosensoren Informationen über die aussen herrschenden Lichtverhältnisse liefern und das Kunstlicht im Inneren jeweils entsprechend adaptieren.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Lichtverschmutzung: Künstliche Lichtquellen in privaten und öffentlichen Räumen sollten so konzipiert und platziert werden, dass sie die nächtliche Lichtverschmutzung gering halten, um in den städtischen Wohngebieten wie auch den Schlafräumen der Wohnungen angemessene Dunkelheit zu schaffen. Dunkelheit ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor für circadiane Anpassung, genau wie der graduelle Übergang von Dunkelheit zum hellen Tag im Zwielicht (vgl. «Die Sonne ins Zimmer holen»).
[Anna Wirz-Justice, PhD, ist emeritierte Professorin am Zentrum für Chronobiologie – Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
Colin Fournier, AA Dip (Hon), ist emeritierter Professor für Architektur und Stadtplanung an der Bartlett School of Architecture, University College London
Übersetzung aus dem Englischen: TTN Translation Network, Genf]
Anmerkung:
Dieser Abdruck ist eine gekürzte Version des Artikels. Das Original erschien erstmals in der Zeitschrift «World Health Design», Januar 2010, S. 44–49.TEC21, Fr., 2016.08.26
26. August 2016 Colin Fournier, Anna Wirz-Justice
Morgen in Blau
Nach zwei Jahren Betrieb tritt eine Schreinerwerkstatt den Beweis an: Biologisch wirksame Beleuchtung ist schon heute umsetzbar, ohne den räumlichen Entwurf oder die monatlichen Fixkosten massgeblich zu beeinflussen. Die Bedeutung der richtigen Materialwahl aber erstaunt.
Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben teilhaben zu lassen ist das Leitbild einer Firma im bayerischen Landsberg am Lech. Weil jedoch die gewachsene Betriebsstruktur den Anforderungen an eine moderne Produktion nicht mehr genügte, fiel im Jahr 2012 die Entscheidung für einen Neubau. Der Auftrag für die neue Produktionsstätte beinhaltete, die positive Wirkung von Licht auf das Wohlbefinden zu berücksichtigen und gezielt mit einzuplanen. Für den 2500 m² grossen Neubau wurden daher die Erkenntnisse über die nichtvisuelle Wirkung[1] von Licht (vgl. «Licht spüren») Grundlage für die Entwicklung des Tages- und Kunstlichtkonzepts.
Da diese Thematik für die Baupraxis hochrelevant ist, förderte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) die integrale Planungsphase ebenso wie die anschliessende Evaluation. Unterstützt wurde unter anderem die Entwicklung eines erweiterbaren Holzbaus, eines zukunftsorientierten Energiekonzepts und eines Tages- und Kunstlichtkonzepts, das sich an den Erkenntnissen über biologisch wirksames Licht orientierte.
Im Februar 2014 nahm die Schreinerei den Betrieb wieder auf. Seitdem evaluieren die Hochschule München und die Lichtplaner von 3lpi die Kunstlichtanlage und die erwarteten positiven Effekte. Erste Erkenntnisse aus dem vom Planungsbüro im Juni 2016 abgeschlossenen technischen Monitoring liegen nun vor.
Schritt 1: maximales Tageslicht
Für die Planung von melanopischen Lichtwirkungen gab es keine dezidierten Hilfsmittel. Stattdessen mussten die bestehenden Lichtsimulationsprogramme mit Parametern aus der Radiometrie (Spektraldaten) angepasst werden. Die dafür notwendigen Daten wiederum wurden im Projekt mithilfe von spektral aufgelösten Reflexionsmessungen erhoben. Anhand der verfügbaren Vorgaben[2] untersuchten die Lichtplaner, ob eine melanopisch wirksame Lichtanlage in der Werkstätte mit den bestehenden Planungswerkzeugen und den erhobenen Daten konzipiert werden kann und ob die anschliessende Umsetzung mit den Zielwerten übereinstimmt.
Bei der Planung des Tageslichts ermittelten die Lichtplaner das Potenzial des Architekturkonzepts. Die Studie beschränkte sich dabei nicht nur auf die Raumgeometrie sowie auf die Grösse, Anordnung und Beschaffenheit der Tageslichtöffnungen. Auch die Oberflächengestaltung des Innen- und unmittelbaren Aussenraums und die Qualität der transparenten Bauteile beeinflussen das Tageslichtangebot.
Die Oberflächenreflexion der Innenkonstruktion wurde iterativ optimiert, im sheddachnahen Bereich wurden flächige Wärmestrahlplatten angebracht, und die Transparenz der Sheddachverglasungen wurde erhöht – dafür wurde, um den sommerlichen Wärmeschutz einzuhalten, die Transparenz der grossflächig verglasten Südfassade verringert. So liess sich die mittlere Tageslichtmenge im Neubau gegenüber dem ursprünglichen Entwurf um fast 40 % steigern, ohne das räumliche Konzept signifikant zu beeinflussen.
Die Verglasung wurde insbesondere im Hinblick auf ihre Lichtdurchlässigkeit im biologisch wirksamen Bereich ausgewählt. Bei einer der zur Auswahl stehenden Verglasungen lag die Lichtdurchlässigkeit im melanopisch wirksamen Bereich des Spektrums bei 490 nm um 14 % höher, wobei die bauphysikalischen Daten ansonsten vergleichbar waren.
Schritt 2: Kunstlicht, mehr als normgerecht
Unabhängig vom Tageslicht musste die Kunstlichtanlage die Anforderungen an die melanopische Wirksamkeit erfüllen. Hierfür wurde ein Mehrkomponentenkonzept entwickelt. Am Tag wird zur biodynamischen Wirksamkeit mehr Licht benötigt, als die Norm fordert. Eine LED-Direktkomponente an einem Schienensystem mit einer Farbtemperatur von 4000 K stellt die normgerechte Beleuchtung energieeffizient sicher. Diese Komponente allein erfüllt die Anforderungen an eine biologisch wirksame Beleuchtung jedoch nicht.
Eine Indirektkomponente auf Grundlage einer T16-Leuchtstoffröhre ergänzt daher die LED-Beleuchtung. Sie ist auf den Decken- und Sheddachbereich ausgerichtet, um einen möglichst grossen Raumwinkel für den Nutzer auszuleuchten. Das Leuchtmittel hat eine Farbtemperatur von 17 000 K. Die Farbtemperatur bestimmt die nichtvisuelle Wirkung pro eingestrahlter Leistung. Erst zusammen mit der Intensität («Helligkeit») und einer Bestrahldauer ergibt sich eine melanopisch wirksame Dosis.
Vereinfacht ausgedrückt: Je höher die Farbtemperatur, umso weniger Energie muss eine Anlage aufwenden, um eine melanopische Wirkschwelle zu erreichen. Durch den sehr hohen Blauanteil ist die eingesetzte Leuchte in hohem Mass melanopisch wirksam. Die Steuerung des Kunstlichts folgt sowohl ergonomischen (Erfüllung der Sehaufgabe, nichtvisuelle Lichtwirkungen, visuelle Komfortkriterien) als auch energetischen Zielvorgaben.
Zu festgelegten Tageszeiten wird das Lichtangebot gezielt verändert, um eine biologische Wirkung sicherzustellen und damit den circadianen Rhythmus der Nutzer zu unterstützen. Im Rahmen der Inbetriebnahme wurde der aktivierende und synchronisierende Zeitraum zwischen 8 und 11 Uhr gelegt. Reicht in dieser Phase das Tageslichtangebot ganz oder in Teilen aus, um das Niveau der Sehaufgabe und die gewünschte melanopische Wirkung sicherzustellen, werden die Kunstlichtkomponenten zur Energieeinsparung gezielt gedimmt bzw. ausgeschaltet. Konkret bedeutet das: Neben einer tageslichtabhängigen Steuerkomponente ist eine parallele, tageszeitabhängige Komponente implementiert.
Schritt 3: Überprüfen
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Evaluation überprüft die Hochschule München aktuell mit Fragebögen und Interviews, inwieweit sich die erwarteten positiven Effekte derartiger Lichtlösungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirken. Im ergänzenden technischen Monitoring erfassten die Planer thermische und elektrische Energieverbräuche und untersuchten den Betrieb der Kunstlichtanlage über ein Jahr hinweg intensiv. Dieses Monitoring wurde im Juni 2016 abgeschlossen.
Die Hauptaufgabe des Monitorings war es, den prognostizierten mit dem eingetretenen Kunstlichtstrombedarf zu vergleichen und mögliche Abweichungen zu analysieren. In der Jahressimulation wurde für die realisierte Anlage 7.7 kWh/m2a berechnet. Der tatsächliche Verbrauch stellte sich um ca. 9 % niedriger ein. Bei der umfangreichen Nachmessung im Frühjahr 2016 bemerkten die Lichtplaner jedoch, dass der durch Alterung und Verschmutzung erwartete Lichtstromrückgang von der Steuerung nicht ausreichend kompensiert wurde.
Die Vor-Ort-Messungen umfassten auch die Oberflächenreflexion und die Auswirkung von Leuchtenreinigung. Die Reflexionsmessung der Holzoberflächen an den Innenwänden machte deutlich, wie stark diese über bereits kurze Zeiträume nachdunkeln. Die OSB-Wandbeplankung hatte seit dem Einbau 19 % an Reflexion im sichtbaren und sogar 28 % im melanopisch relevanten Spektralbereich verloren. Das zeigt die grosse Bedeutung, die der Materialwahl zukommt – denn diese Reduktion muss die Kunstlichtanlage kompensieren, um die nichtvisuellen Wirkungen sicherzustellen.
Auch der Einfluss der Verschmutzung der Leuchten war Bestandteil der Untersuchung. Mit nur 5% Lichtstromreduktion über zwei Betriebsjahre ist die Verunreinigung für einen Holzverarbeitungsbetrieb jedoch als gering einzustufen.
Schritt 4: Dazulernen
Im Rahmen des Projekts sowie des anschliessenden Monitorings konnte gezeigt werden, dass die Planung und Überwachung einer melanopisch wirksamen Beleuchtung grundsätzlich möglich ist. Der zusätzlich notwendige Energieverbrauch einer solchen Anlage ist nicht unerheblich, aber – entsprechende Planung vorausgesetzt – akzeptabel.
Die zusätzlichen Energiekosten stehen in keinem Verhältnis zu Mitarbeiterkosten oder den zu erwartenden Vorteilen einer wirksamen Lichtlösung. Die Mitarbeiterkosten liegen sogar bei einer solchen Arbeitsstätte um ein Hundertfaches (hier: Faktor 800) höher als die zusätzlichen Kosten für Kunstlichtstrom, wenn man beides auf den Quadratmeter herunterrechnet. Die Evaluation zur Nutzerzufriedenheit ist noch im Gang. Die Befragung der Mitarbeiter erwies sich als aufwendiger als ursprünglich gedacht. Bislang zeigt sich die Tendenz, dass die zusätzliche Beleuchtung am Tag im Winter zu signifikanter Verbesserung beim Einschlafen sowie für die Zeit nach dem Aufstehen führt.
Bauherrschaften, Architekten und Planer sollten im Vorfeld unbedingt prüfen, ob bzw. inwieweit Tageslicht bereits die melanopische Wirksamkeit erfüllen kann, und erst im zweiten Schritt – auf Basis dieser Erkenntnisse – eine Kunstlichtanlage projektieren. Die Einhaltung der «nichtvisuell» wahrnehmbaren Parameter über die Anlagenlebensdauer ist eine der wichtigsten Fragen, denen sich Anlagenerrichter und -betreiber nicht nur in diesem Projekt, sondern künftig allgemein stellen müssen.
Anmerkungen:
[01] Melanopische Lichtwirkungen sind nichtvisuelle Lichtwirkungen, die über das Auge vermittelt werden. Sie umfassen u. a. die Melatoninsuppression bei Nacht, die Vigilanz/Aufmerksamkeit sowie die Synchronisation an den Tag-Nacht-Rhythmus.
[02] DIN SPEC 5031-100:2015-08 und 67600:2013-04. Derzeit gibt es sehr wenige offizielle Richtlinien, die Planungsempfehlungen für melanopische Lichtwirkungen geben. Die DIN SPEC (mögliche Basis für eine zukünftige Norm) sind erste Ausläufer. In der Schweiz und international wird viel dazu geforscht, doch im breiten Normenmarkt wird sich dieses Thema erst in den kommenden Jahren festigen.TEC21, Fr., 2016.08.26
26. August 2016 Johannes Zauner, Mathias Wambsganß
Die Sonne ins Zimmer holen
Morgens fit aus dem Bett, am Nachmittag keinen Taucher haben und am Abend entspannt sein – das sollen dynamische Leuchten ermöglichen. Seit einigen Jahren werden sie auch in der Altenpflege eingesetzt. Dieser Beitrag stellt drei von der Age Stiftung[1] geförderte Beispiele vor.
Drei Viertel aller Informationen nehmen wir über die Augen auf – vorausgesetzt, unsere Sehfähigkeit ist nicht eingeschränkt. Sie nimmt jedoch stetig ab: Mit zunehmendem Alter verkleinert sich der Pupillendurchmesser; Augenlinse, Hornhaut und Glaskörper verlieren an Transparenz. Das hat Folgen für die Sehfähigkeit, beeinflusst aber auch chemische Prozesse im Körper: Die Trübung der Linse filtert hauptsächlich das blaue Licht heraus – eben jenes, das über die körpereigene Melatoninproduktion für die Steuerung des Tag-Nacht Rhythmus (circadianer Rhythmus, vgl. Glossar im Kasten unten) zuständig ist.
Nachts ist die Konzentration des Hormons um ein Zehnfaches erhöht. Krankheiten wie Winterdepression werden mit der geringen Lichtmenge durch kürzere Tage in Zusammenhang gebracht.
Alte Menschen sind mehrfach durch Lichtmangel betroffen: Zum einen ist ihre Sehfähigkeit eingeschränkt und ihr circadianer Rhythmus daher eher aus dem Gleichgewicht; biologisch wirksame Beleuchtungen in Pflege- und Altersheimen sollen hier Abhilfe schaffen. Zum anderen halten sie sich meist im Innenräumen auf, wo ihr Körper nicht genug Vitamin D bilden kann – das wiederum kann zu einer eingeschränkten Kalziumabsorption und damit zu Knochenbrüchen führen.
Alterspflegezentrum Appenzell AI
Eines der jüngeren Beispiele für die Anwendung ist das im Juni 2016 eröffnete Alterspflegezentrum des Kantons Appenzell Innerrhoden. Der Neubau auf dem Spitalgelände nördlich von Appenzell ging aus einem 2011 durchgeführten Projektwettbewerb hervor, den das Zürcher Büro Bob Gysin Partner für sich entschied. Die heutige Anlage auf dem Spitalareal genügte nicht mehr, insbesondere sollte eine Gruppe für Demenzkranke geschaffen werden. Vorgesehen war ein kompakter vierstöckiger Neubau ohne direkten Bezug zu den Bestandsbauten.
Die Gebäudetiefe von teilweise über 45 m wird durch zwei Lichthöfe gebrochen, die das Tageslicht bis ins Erdgeschoss leiten. Die polygonale Form erlaubt Durchblicke und den Sichtbezug zum Aussenraum. An den Gebäudeaussenseiten sind in den Obergeschossen jeweils die Zimmer der rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner untergebracht, die Kerne für die Erschliessung sind den Lichthöfen zugeordnet. Auf der Südseite des Baus befindet sich auf dem 1. Obergeschoss eine Terrasse mit einem in sich geschlossenen Demenzgarten, dessen Bepflanzung die Sinne anregen soll.
Als erstes Alterspflegezentrum in der Ostschweiz wurde der Bau mit dynamischen Licht ausgestattet – auf Wunsch der Bauherrschaft, die das Konzept bereits vom Alters- und Pflegeheim Sonnweid in Wetzikon her kannte. Die Wirkung der dynamischen Leuchten wird von einem mehrjährigen Monitoring begleitet. Lichtdecken in den Aufenthaltsräumen des 1. und 3. Obergeschoss sollen das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals erhöhen. Zusätzlich sind zwei Leuchtdecken in der «Pflegeoase» im 3. Obergeschoss angebracht. Hier wohnen bis zu sechs besonders pflegebedürftige Personen, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind.
Die ansonsten automatisch gesteuerten Leuchten sind hier auch manuell bedienbar, um jeweils individuell auf die Bewohnerinnen und Bewohner eingehen zu können. Das 2. Obergeschoss dient als Kontrollbereich. Erweist sich die dynamische Beleuchtung als wirkungsvoll, kann die Etage nachgerüstet werden. Eine Besonderheit ist der Einsatz der Leuchten in den Stationszimmern: Sie sollen die Anfälligkeit für Medikationsfehler reduzieren und die Konzentrationsfähigkeit im anstrengenden Arbeitsfeld der Pflege unterstützen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner reagieren nicht uneingeschränkt positiv auf die Leuchtdecken: Sie empfinden sie als zu hell und als Energieverschwendung («draussen scheint ja die Sonne»). Die (temperaturneutralen) LED-Leuchten beeinflussen das subjektive Wohlbefinden – wenn man sich lang unter der Decke aufhalte, so ist zu hören, bekäme man einen warmen Kopf. Auch das Personal ist nicht uneingeschränkt überzeugt: Man empfinde die Decken als zu hell und wünsche sich mehr individuelle Steuerungsmöglichkeiten.
Sonnweid das Heim, Wetzikon ZH
Die Sonnweid im zürcherischen Wetzikon ist eine Pioniereinrichtung in der Betreuung von Demenzkranken (vgl. TEC21 47/2010). Seit 2007 kommen hier dynamische Lichtdecken zum Einsatz, die den Tag-Nacht-Rhythmus der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützen sollen. Ein Erweiterungsbau bot 2011 die Möglichkeit, die dynamische Beleuchtung grossflächig zu installieren und ihre Wirkung wissenschaftlich zu begleiten (Architektur: Bernasconi Partner Architekten, Luzern).
Die Anlagen bestehen aus 1 × 1 m grossen Paneelen mit einer Leistung von je 21 W, die zu bis zu 9 m² grossen Lichtflächen zusammengefügt wurden. Sie befinden sich in den Aufenthaltsräumen, die Beleuchtungsstärke variiert zwischen 100 und 1500 Lux in vertikaler Richtung am Auge (Tageslicht: 3500–100 000 Lux). Im Gegensatz zu den bereits bestehenden Anlagen sind die neuen Paneele mit je zwölf Fluoreszenzleuchten in zwei unterschiedlichen Farbtemperaturen ausgestattet – eine marktfähige Steuerung mit LED existierte zur Bauzeit noch nicht.
Durch die Mischung von warmweissen (2700 Kelvin) und tageslichtweissen (6500 Kelvin) Leuchtmitteln lässt sich die Lichtfarbe im Raum graduell einstellen. Die Veränderung im Tagesverlauf von Warmweiss und ca. 500 Lux am Morgen zu 1000 bis 1500 Lux am Nachmittag bei tageslichtweissem Licht und 100–200 Lux in Warmweiss am Abend wird über einen Computer gesteuert und bildet nicht die tatsächlich herrschenden Lichtverhältnisse im Aussenbereich ab. Letzteres war zwar erwünscht, liess sich aber zu diesem Zeitpunkt technisch nicht ohne Weiteres realisieren.
2012 leitete die Neurobiologin Mirjam Münch (EPF Lausanne) die Studie «Wirkung von dynamischem Licht auf den Schlaf- und Wachrhythmus, das Wohlbefinden und die Immunfunktion bei älteren Menschen mit Demenz».[2] Die auf acht Wochen angelegte Untersuchung im Herbst/Winter mit über 100 Probanden teilte diese in zwei Gruppen auf: Die erste war in den Aufenthaltsräumen der circadianen Beleuchtung ausgesetzt, die Kontrollgruppe hielt sich in herkömmlich beleuchteten Räumen auf. Alle Teilnehmer konnten sich frei bewegen. Ein Bewegungstracker am Handgelenk, der auch die jeweilige Beleuchtungsstärke mass, zeichnete die individuelle Aktivität auf.
Ergänzend dazu dokumentierten das Pflegepersonal und geschulte Mitarbeiter den emotionalen Zustand der Bewohnerinnen und Bewohner in standardisierten Fragebögen. Die Studie brachte überraschende Ergebnisse: Nur unter Berücksichtigung der gesamten Beleuchtungsstärke, der die Bewohner tagsüber ausgesetzt waren, ergaben sich signifikante Unterschiede. Der Verlauf der Melatoninkonzentrationen zeigte eine starke Variation zwischen den Probanden, was darauf schliessen lässt, dass die Synchronisation der inneren Uhr mit dem äusseren Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr so gut getaktet ist.
Bei den Ruhe-Aktivitäts-Zyklen ergaben sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und beim Schlaf waren in der Gruppe mit der grösseren Lichtmenge tagsüber die Bettgehzeiten später sowie die Verweildauer im Bett kürzer. Die Auswertung der Fragebögen zum persönlichen Wohlbefinden zeigten eine höhere Lebensqualität für die Gruppe, die tagsüber insgesamt mehr Licht ausgesetzt war, ebenso wie signifikant höhere Werte bei Freude und Aufmerksamkeit – für die Betreiber des Heims Grund genug, das Konzept weiterzuverfolgen.
Alterskompetenzzentrum Hofmatt, Münchenstein BL
Die Stiftung Hofmatt in Münchenstein bei Basel wurde von 2011 bis 2015 zu einem Alterskompetenzzentrum mit 165 Plätzen erweitert (Architektur: Oplatek Architekten, Basel; Lichtplanung: Adrian Huber, Basel). Im Rahmen der Erweiterung implementierte man ein Lichtkonzept, das speziell auf die Bedürfnisse an Demenz erkrankter Menschen zugeschnitten ist. Sie sind im Gartengeschoss und im ersten Obergeschoss untergebracht, darüber liegen die Wohneinheiten für betreutes Wohnen und für Menschen mit chronischen Erkrankungen.
Eine geriatrische Arztpraxis und ein Spitex-Stützpunkt ergänzen das Angebot, ebenso wie temporäre Tages- und Nachtstätten für den vorübergehenden Aufenthalt von betreuungsbedürftigen Personen. Neben einer dynamischen Beleuchtung in den Aufenthaltsräumen wurden erstmalig Dämmerungssimulatoren in den Zimmern der Demenzpatienten getestet.[3] Studien weisen darauf hin, dass speziell die Übergänge zwischen Tageslicht und Dunkelheit Zeiten sind, an denen sich die innere Uhr orientiert und die somit für die Regulation des Tag-Nacht-Rhythmus entscheidend sind.
Forscher der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und der EPFL untersuchten, ob die Simulation der Dämmerung einen Einfluss auf die Schlaftiefe und die Schlafqualität bei Bewohnerinnen und Bewohnern mit mittlerer und schwerer Demenz haben. Zum Einsatz kam dabei eine neu entwickelte, mobile LED-Stehleuchte, die die Dämmerung simulierte. Ausserdem evaluierte man, ob sich die Stimmung und die Wachheit tagsüber verändern.
Dynamische Dämmerungssimulatoren (DDS) beruhen auf dem gleichen Konzept wie Lichtwecker: Zu Tagesbeginn steigt die Beleuchtungsstärke an, was zum Aufwachen anregen soll. Im Gegensatz zum Lichtwecker funktioniert der DDS auch abends mit einer nachlassenden Beleuchtungsstärke. Per Knopfdruck lässt sich bernsteinfarbenes Licht zuschalten, das die Dämmerung simuliert und zum Einschlafen animiert.
Das Forschungsprojekt ermöglichte die Entwicklung einer Leuchte mit einem Algorithmus, der die Dämmerung eines beliebigen Tages im Jahr und an jedem Ort der Erde mit einem Beleuchtungsstärkenbereich von 0.001 Lux bis 780 Lux (Sonnenaufgang) reproduzieren konnte.
An der Studie nahmen 20 Personen teil. Nach einer Eingewöhnungswoche erhielten zehn von ihnen für den Zeitraum von acht Wochen einen DDS, anschliessend wurde für weitere acht Wochen gewechselt. Die simulierte Dämmerung blieb während des Versuchs konstant. Wie bei der Studie in der Sonnweid dokumentierten Aktivitätsmonitore den Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus der Teilnehmenden, und das Pflegepersonal beurteilte den Zustand der Probanden in Fragebögen.
Auch hier präsentierten sich die Ergebnisse überschaubar: Zwischen den Vergleichsgruppen zeigten sich keine Unterschiede im Ruhe-Aktivitäts-Rhythmus oder in den Schlafparametern. Dafür war das Wohlbefinden und die Laune der Bewohnerinnen und Bewohner unter der Anwendung der DDS morgens besser als in der Zeit ohne DDS. Dies war aber nur bei denjenigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Fall, die unter besonders starken kognitiven Einschränkungen litten. Die Stiftung nutzt die Prototypen dennoch weiterhin, eine Weiterentwicklung der Leuchte ist geplant.
Wie weiter?
Nicht alles, was nicht messbar ist, hat auch keine Wirkung. Trotzdem erstaunt die Ausdauer, mit der Pflegeheime auf dynamisches Licht setzen. Gemäss Mirjam Münch, die die beiden Untersuchungen in der Sonnweid und in der Stiftung Hofmatt wissenschaftlich leitete, gibt es dafür gute Gründe: «Eine dynamisches Lichtkonzept stellt vor allem im Winter eine verbesserte ‹Zeitgeberfunktion› für die innere Uhr dar. Das ist gerade bei Menschen mit Demenz enorm wichtig, weil bei dieser Gruppe die Tag-Nacht-Unterschiede via innere Uhr nicht mehr so gut reguliert werden können. Eine tageslichtabhängige Steuerung wäre dabei unbedingt erwünscht.»
Die Theorie klingt gut – möglicherweise wäre mit einer besseren Vermittlung zumindest eine höhere Akzeptanz beim skeptischen Pflegepersonal zu erreichen.
Anmerkungen:
[01] Die Age Stiftung in Zürich möchte die öffentliche Wahrnehmung des Themas Wohnen und Altern schärfen. Sie unterstützt innovative Lösungsansätze in der Deutschschweiz mit finanziellen Mitteln. Infos, auch zu Fördermöglichkeiten: www.age-stiftung.ch
[02] «Wirkung von dynamischem Licht auf den Schlaf- und Wachrhythmus, das Wohlbefinden und die Immunfunktion bei älteren Menschen mit Demenz», 2012 im Alters- und Pflegezenrtrum Sonnweid das Heim. Projektbeteiligte: Mirjam Münch, EPFL, Michael Schmieder (Heimleitung), Katharina Bieler (Projektmanagement), Stiftung Sonnweid AG. Infos: www.age-stiftung.ch/uploads/media/Schlussbericht_2010_015.pdf
[03] «Dynamische Dämmerungssimulation bei Menschen mit Demenz», Studie November 2014 bis März 2015 im Alterskompetenzzentrum Hofmatt. Projektbeteiligte: Dr. Mirjam Münch (Charité Universitätsmedizin, Berlin), Prof. Dr. Anna Wirz-Justice und Dr. Vivien Bromundt (Zentrum für Chronobiologie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel), Marc Boutellier, Projektleiter Stiftung Hofmatt; Entwicklung DDS-Leuchte: Fraunhofer Institut, Stuttgart; LEiDS, Stuttgart; Beratung Dämmerungssimulation: Haberstroh Architekten, Basel. Infos: www.age-stiftung.ch/uploads/media/Schlussbericht_13_015.pdfTEC21, Fr., 2016.08.26
26. August 2016 Tina Cieslik