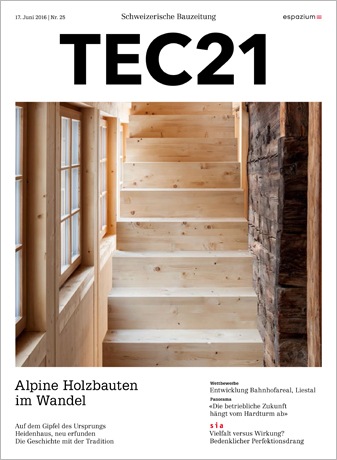Editorial
Wie die Schweizer Alpen sind auch die traditionellen Holzbauten dieser Region ein identitätsstiftender Mythos. Aber die diffuse Bezeichnung «alpiner Holzbau» reicht vom Blockhaus bis zum mit feingliedrigen Laubsägelideko verzierten Chalet. Wohl gerade wegen dieser Wandelbarkeit zieht sich das Bild im Kollektivgedächtnis der Schweizer durch Kinderbücher, Werbekampagnen, Bergdörfer und Skiorte.
Neue Hotelchalets in Übergrösse oder alpin inspirierte Einfamilienhäuser stehen oft unter Verdacht, einen weiteren Meilenstein des landschaftlichen Niedergangs und der Zerstörung intakter Dorfkerne zu verkörpern. Historische Holzbauten sind dagegen durch moderne Materialien, Bauvorschriften, Infrastruktur, Klimaveränderung, Tourismus, Bevölkerungszuwachs oder Entvölkerung gefährdet.
Die verletzliche Altbausubstanz erfordert ein umsichtiges Vorgehen bei Renovation, Umbau oder Ergänzung. Die Herangehensweisen sind jedoch so individuell wie die jeweilige Ausgangslage – neben der Auseinandersetzung mit der Tradition und ihrem Stellenwert in der heutigen Zeit.
In fast allen Fällen ist aber die Kunst des Weglassens aufschlussreich. Nicht nur in der Architektur, sondern auch beim Energieverbrauch lassen sich in Zeiten, in denen man sich vermehrt dem Natürlichen und Ursprünglichen zuwendet, Erkenntnisse für das «Unterland» gewinnen. Gedanken zur Frage nach dem, was in unserer Zeit massvoll und notwendig ist, sind in jedem Fall angebracht.
Danielle Fischer