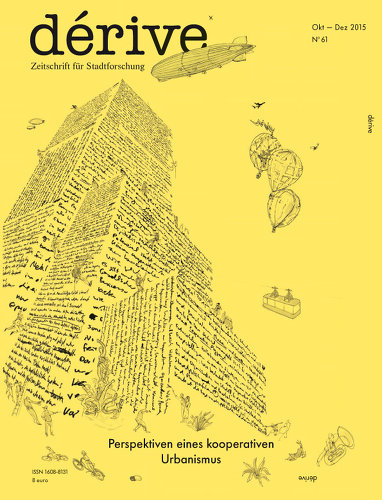Editorial
»We want every adult in the country to be an active member of an active neighbourhood group. [...] Neighbourhoods will be given the power to engage in genuine local planning through collaborative democracy – designing a local plan from the ›bottom up‹«. Kooperatives Schlaraffenland?! Nein – nur ein Auszug aus der 2010 veröffentlichten Broschüre Big Society Not Big Government der britischen Conservative Party. Immerhin, so könnte man anmerken, wissen die britischen Konservativen mittlerweile wieder, dass es so etwas wie Gesellschaft gibt, das war ja nicht immer so. Aber was ist davon zu halten, wenn eine der neoliberalsten Parteien Europas von »collaborative democracy«, »bottom up« und »active neighboourhood« spricht? Schließlich sind ganz ähnliche Forderungen auch im linken Urbanismus-Diskurs zu finden. Bereits 2008 hat dérive ein Schwerpunktheft zum Thema Gouvernementalität veröffentlicht, in dem die Entwicklungen entlang des Konzepts Regieren durch Community des britischen Soziologen Nikolas Rose kritisch hinterfragt wurden. Der schlanke Staat, der kein Wohlfahrtsstaat mehr sein will, will sich seiner – vor allem sozialpolitischen – Aufgaben entledigen und dafür lieber seine Untertanen einsetzen. Nicht alles, was Kooperation heißt, glänzt.
Dass es nicht ausreicht, schöne Projekte kooperativ zu entwickeln und umzusetzen, zeigt Tatjana Schneider in ihrem Beitrag Tod dem Projekt! Lang lebe der systemische Wandel. Denn dabei, so Schneider, besteht immer die Gefahr, dass schlussendlich nicht die ursprünglichen AkteurInnen profitieren. Ungleiche Macht- und Eigentumsverhältnisse sorgen regelmäßig dafür, dass hierarchische Ordnungen unangetastet bleiben und die Ergebnisse deren Aufrechterhaltung nicht gefährden können oder sie sogar stärken.
Eine der Voraussetzungen für echte Kooperation ist die Möglichkeit und das Recht zur Teilhabe jedes Bewohners und jeder Bewohnerin einer Stadt – unabhängig von der jeweiligen Staatsbürgerschaft – am Gesamtkunstwerk Stadt, wie der Wiener Bürgermeister Michael Häupl in den letzten Monaten immer so schön sagt. Sowohl aktiv, indem Wünsche, Ideen, Wissen und Tatkraft eingebracht werden, als auch passiv, indem das gemeinsame Œuvre Stadt (das ist jetzt Henri Lefebvre, nicht BM Michael Häupl) genossen und genutzt werden kann. Jochen Becker greift in seinem Beitrag das Konzept einer Urban Citizenship auf und zeigt an mehreren Beispielen aus Berlin,in welche Richtung es gehen könnte und wo die Problemezu verorten sind.
Wie soll und kann eine kooperative Stadt tatsächlich funktionieren? Welche Ansätze versprechen eine echte Kehrtwende weg vom Unternehmen Stadt? Danijela Dolenec greift diese Fragen in ihrer Beschäftigung mit Urban Commons auf und betont, dass es dabei nicht nur um die Frage des Eigentums gehen kann, sondern dass auch Fragen der Organisation und Steuerung (Governance) von entscheidender Bedeutung sind. Sie erinnert an das Werk Branko Horvats, der vor dem Hintergrund des jugoslawischen Modells der Selbstverwaltung besonders auf die Notwendigkeit der Abschaffung des bürokratischen Machtapparats hinwies.
Immer wieder als Vorbild ins Rennen geführt wird die Entwicklung freier Software und ihre Entstehungsbedingungen, wenn es um das Thema Urban Commons geht. Dubravka Sekulić unterstreicht in ihrem Beitrag, dass ein entscheidender Aspekt für die Entwicklung der digital commons die Veröffentlichung der GNU General Public License durch Richard Stallman war. Wie Tatjana Schneider betont auch sie, dass grundlegende Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um kooperative Stadtproduktion zu ermöglichen, die nicht nur der Behübschung und Festigung der bestehenden Verhältnisse dient, sondern tatsächlich Kooperation auf Augenhöhe ermöglicht.
Das Thema Selbstverwaltung steht auch in Dario Azzellinis Beitrag Worker Control and Workplace Democracy im Mittelpunkt. Er wirft einen Blick zurück auf die Geschichte der ArbeiterInnenselbstverwaltung und zeigt die neueren Entwicklungen von Fabriksbesetzungen und -übernahmen durch die Arbeitenden auf, deren Beginn mit dem Zusammenbruch des argentinischen Finanzsystems und der darauf folgenden Pleitewelle 2001 anzusetzen ist.
Felix Stalder zeichnet in seinem Beitrag Zwischen Smartness und Kooperation – Möglichkeiten der informationellen Stadt die strukturellen Veränderungen der Subjektivität durch den Einfluss der sozialen Medien und des Internets nach und lotet aus, welche Auswirkungen diese Verschiebungen im Hinblick auf eine kooperative Stadt haben könnten.
Neben den theoretischen Perspektiven und Analysen liefert PlanBude St. Pauli im Rahmen des Schwerpunkts auch ein ganz konkretes Beispiel einer kooperativen Stadtproduktion in Hamburg. Nach langjährigen stadtpolitischen Kämpfen der BewohnerInnenschaft der ehemaligen Esso-Häuser in St. Pauli konnte ein kooperativer Planungsprozess von und mit dem Stadtteil durchgesetzt werden – make bottom-up funky! lautet der Schlachtruf dazu. Näheres dazu im Schwerpunkt-Beitrag der Planbuddies und beim urbanize-Festival, wo die Prozesse rund um die Esso-Häuser mit Ausstellung, Teilnahme an der Veranstaltung Kooperative Stadtproduktion bottom-up und dem Dokumentarfilm Buy, Buy St. Pauli vorgestellt werden. Ein zweites praktisches Beispiel stellt Alina Mogilyanskaya vor: Es handelt sich dabei um die Einführung eines kommunalen Personalausweises in New York, den auch Menschen bekommen können, die keinen legalen Aufenthaltsstatus in den USA haben, was ihnen das Alltagsleben einigermaßen erleichtert. In der Serie zur Geschichte der Urbanität widmet sich Manfred Russo in einer weiteren Folge Henri Lefebvre – diesmal der Revolution der Städte. Das Kunstinsert von zweintopf, setzt sich mit der schönen und zunehmend gefährdeten österreichischen Institution der Tabak
Trafik auseinander.
Allen, die zwischen 2. und 11. Oktober in Wien sind, sei noch einmal das urbanize! Festival ans Herz gelegt: In der zwischengenutzten Festivalzentrale, die seit Mitte September auch syrischen Flüchtlingen als Notunterkunft dient, wandelt urbanize! unter dem Festivalmotto Do It Together Stadttheorie in solidarische Praxis. Alle Infos zum Festival und allen Veranstaltungen finden sich unter www.urbanize.at.
Welcome – Join us!