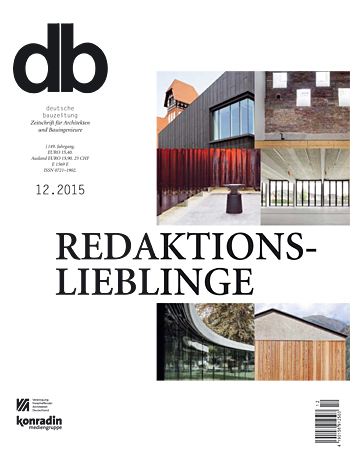Editorial
Auch in diesem Jahr ist die Dezember- Ausgabe der db den Lieblingsbauten der Redakteure gewidmet. Zur Auswahl der wie gewohnt kritisch betrachteten Projekte gehören dieses Mal eine Totenkapelle, die Ulrike Kunkel bei ihrer Recherchereise zum Südtirol-Heft entdeckte, der einfühlsame Umbau eines Berufsschulgebäudes in Heilbronn, dem sich Dagmar Ruhnau nähert, und ein Feuerwehrhaus in Österreich, das es Achim Geissinger angetan hat. Begleiten Sie uns auf der Entdeckungsreise zu unseren diesjährigen Favoriten. Viel Freude dabei! | Die Redaktion
Seelenlandschaft
(SUBTITLE) Totenkapelle und Erweiterung des Friedhofs in Katharinaberg (I)
In einem Dorf im Südtiroler Schnalstal wurde der Friedhof erweitert und um eine Totenkapelle ergänzt. Entstanden ist ein bemerkenswerter Ort, der durch klare Formen und zurückhaltende Gestaltung Ruhe und Konzentration ausstrahlt. Ein Platz für Trauer und Abschiednahme – ohne Pathos und bedrückende Schwere.
Das Dorf Katharinaberg im Schnalstal liegt recht spektakulär auf einem Bergsporn in 1 245 m Höhe. Von Meran kommend, erschließt sich das ca. 22 km lange Tal rechter Hand nach Nordwesten. Durch einen Tunnel gelangt man in die felsige Eingangsschlucht, passiert zunächst das Schloss Juval und erreicht nach einiger Zeit den Abzweig Richtung Katharinaberg. Die schmale Straße schlängelt sich auf den ca. 200-Seelen-Ort zu und gibt in der einen oder anderen Biege bereits den Blick auf den Kirchberg mit neuer Friedhofserweiterung und -einfassung sowie Totenkapelle preis. Durch die steile Hanglage und das damit einhergehende hohe »Fundament«, ragt die Kapelle aus dieser Perspektive doppelt so hoch auf, wie auf der Eingangsseite zur Kirche hin. Die Pfarrkirche St. Katharina im Hintergrund behauptet sie sich also durchaus selbstbewusst vor ihrem Nachbarn.
Bisher hatte die Gemeinde Schnals, zu der neben Katharinaberg noch vier weitere Ortschaften gehören, keine Totenkapelle, da die dreitägige Aufbahrung vor dem Begräbnis traditionell zu Hause stattfand. Durch veränderte Wohn- und Lebensformen kommt man allerdings auch hier mehr und mehr davon ab, sodass eine Kapelle für die Aufbahrung erforderlich wurde. Der kleine, in Form und Gestaltung bestechend simple und zurückhaltende Bau bietet nun den angemessenen Rahmen für die stille und persönliche Trauer und Verabschiedung, aber auch für die gemeinschaftliche am Tag der Beerdigung, an dem sich die Trauergemeinde auf der Rasenfläche vor der Kapelle versammelt.
Bei nicht einmal 1 300 Einwohnern im gesamten Schnalstal, überrascht es zunächst, dass auch eine Friedhofserweiterung notwendig wurde. Doch die Erklärung liegt in einer Besonderheit des Schnalstals: Jeder Verstorbene bekommt hier eine neue Grabstelle, sodass alle Familien mehrere Gräber haben, und das erfordert Platz. Daher wurde der Friedhof bereits einmal vergrößert und mit einer Stützmauer eingefasst. Nun stand eine neuerliche Erweiterung an und ein geeignetes Terrain musste gefunden werden. Den Bereich direkt an der Kirche zu nutzen kam nicht in Frage, da wegen des sehr steinigen Bodens die mögliche Aushubtiefe nach heutigen Anforderungen zu gering gewesen wäre. Also folgte die Gemeinde der Idee des Architekten, um die erste Ringerweiterung einen zweiten Ring zu legen; ebenfalls befestigt durch eine verputzte Mauer. Diese wird auf der westlichen Hangseite von einer Treppe begleitet, die einen wieder auf das Geländeniveau der Kirche und auf die Rasenfläche davor, einem alten Gräberfeld, bringt. Von hier aus ist auch die neue Totenkapelle zugänglich. Die kleine Kapelle ist als Teil der Einfriedungsmauer zu lesen und wächst quasi aus dieser heraus. Beide sind in Betonkonstruktion errichtet und einheitlich mit einem verriebenen, grobkörnigen Putz verputzt. Die Dachfläche aus Lärchenholz unterstreicht die Verbundenheit mit der Natur, farblich hat sich das silber-grau gewordene Holz inzwischen der hellen Farbe des Putzes angeglichen. Die Sparren aus Lärchenholz sind im Innenraum sichtbar; darüber liegt eine Schalung, auf der Schalung eine PVC-Haut, die das Wasser in die Dachrinne führt, darüber, mit einigem Abstand, die Holzbretter. So kann die Dachrinne versteckt liegen und nichts stört die klare, einfache Linie.
Ein Ort der Helligkeit
Durch ein großes zweiflügliges Tor, das in die Eingangsseite aus Lärchenholz eingeschnitten ist, betritt man das Innere des Aufbahrungsraums. Die hellen, glatt verputzten Wände, der offene Dachraum und der polierte Betonestrich prägen den nahezu undekorierten Raum. Und natürlich die Natur!
Die komplett verglaste Stirnseite öffnet sich zum Tal hin und holt die grandiose Landschaft in das Gebäude hinein. Der Blick zu den Bergen, den Wäldern und in den Himmel spendet den Trauernden Trost. Im Vordergrund lediglich ein minimalistisches Kreuz. Der neutral gehaltene Raum und der Bezug zur Natur berühren die Sinne und schaffen einen friedlichen Ort der Ruhe und der Einkehr. Eine »Stube«, die Platz für den schwierigen Prozess des Abschiednehmens bietet und Nähe zum Verstorbenen zulässt.
Trauer und Tod architektonisch eben nicht mit Dunkelheit, Schwere und üppiger Symbolik gleichzusetzen, das war dem Architekten Arnold Gapp ein wichtiges Anliegen. Dass Architektur im Falle der Trauer unterstützend wirken kann, diesen Eindruck vermittelt der kleine Bau durchaus eindrucksvoll.db, Di., 2015.12.01
01. Dezember 2015 Ulrike Kunkel
Traditionspflege in Sichtbeton
(SUBTITLE) Umbau eines Bauernhauses in München Alt-Riem
Dass Investoren verfallene Bauernhöfe sanieren, um sie anschließend als Wohnungen zu vermieten, kommt nicht alle Tage vor. Im Münchner Stadtteil Alt-Riem hat die Firma Euroboden auf genau diese Weise ein baufälliges Denkmal vor dem Abriss gerettet. Trotz eines neuen Innenlebens aus Beton stellt das umgebaute Haus viele Bezüge zur landwirtschaftlichen Vergangenheit des Orts her.
Kein Wort mehr gegen Investorenarchitektur! Wer glaubt, dass professionelle Immobilienentwickler stets gesichtslose Allerweltsbauten planen, sieht sich beim Schusterbauerhaus in München-Riem eines Besseren belehrt. Allerdings gehört der Bauherr, die Firma Euroboden, auch zu den wenigen Ausnahmen in der Branche, die höchst individuelle Wohnprojekte verwirklichen. Zuletzt erregte das Unternehmen mit Apartments in einem umgebauten Münchner Hochbunker Aufsehen.
In Alt-Riem hatte Euroboden ein Bauernhaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts gekauft, das stark heruntergekommen und nur deshalb noch nicht abgebrochen war, weil es unter Denkmalschutz steht. Es gilt als letztes noch erhaltenes Zeugnis, das von der bäuerlichen Baukultur des Orts erzählt. Der Wohnteil war noch leidlich erhalten, auch wenn Teile der Ausstattung, etwa die alten Türen, während des langen Leerstands gestohlen worden waren; vom Stall- und Scheunenteil befanden sich nur noch die Außenwände in einem nutzbaren Zustand. Geschäftsführer Stefan Höglmeier heuerte daher Peter Haimerl als Architekten an, der mit seinem Projekt »Birg mich Cilly« in Viechtach bereits ein ähnlich abrissreifes Bauernhaus gerettet und umgebaut hatte. In Riem ist Haimerl nun mit einer Doppelstrategie ans Werk gegangen: im ehemaligen Wohnteil des Hauses so viel Substanzerhalt wie möglich, im stark zerstörten Stallteil ein beherzter Neuanfang. Dort stabilisiert jetzt ein eingeschriebener Betonkörper die alten Mauern und das Dach.
Kontinuität der Hülle
Das Äußere des Gebäudes bleibt davon weitgehend unberührt; zumindest an der Straßenseite ist sein landwirtschaftlicher Ursprung immer noch deutlich zu erkennen. An der Grundstücksgrenze geht es bereits los: Weil Einfriedungen für die Bauernhöfe im Münchner Umland traditionell unüblich waren, entfernte Haimerl die Gartenmauer zur Straße. Stattdessen markiert nun ein Belagswechsel von Asphalt zu Kies den Übergang von öffentlichem zu privatem Außenraum. Einen weiteren Beitrag zur Zonierung leistet die große flache hölzerne Multifunktionskiste vor dem Haus. Sie zeichnet den Grundriss des Misthaufens nach, der sich früher genau dort befand, und bietet „passenderweise“ Platz für die Mülltonnen. Außerdem verbirgt sie Fahrräder, Gartengeräte und eine Laube, deren Holzdach sich zur Seite schieben lässt.
An den Hausfassaden erzeugt ein von Hand aufgetragener Kalkputz jene unregelmäßige Oberfläche, die für das unprätentiöse ländliche Bauen der Region typisch war. Das Madonnenrelief über der Eingangstür wurde restauriert, die alten Sprossenfenster aufgearbeitet und jeweils mit einem zusätzlichen innenliegenden Isolierglasflügel unauffällig zum Kastenfenster ergänzt. Dämmung findet sich lediglich unterm Dach, weil sie sich nur dort so einbauen ließ, › › dass das tradierte Aussehen des Gebäudes nicht leidet. Statt Gauben, die zwar mehr Raum für die oberen Geschosse gebracht hätten, aber dem Typus Bauernhaus gänzlich fremd sind, verbessern Dachflächenfenster die Lichtzufuhr. Sie sind deutlich dezenter, zumal sie so eingebaut wurden, dass sie nicht wie üblich aus der Dachhaut hervorstehen, sondern bündig mit ihr abschließen. All dies dürfte das Herz von Denkmalpflegern höher schlagen lassen. Lediglich die Biberschwanzdeckung wirft Fragen auf: Warum wurde hier auf die Möglichkeit verzichtet, unter die neuen Ziegel ein paar alte aus Abbruchhäusern zu mischen? Sie hätten das Dach weniger steril wirken lassen und ihm ein bisschen Patina gegeben.
Originales Interieur
Im Gebäudeinnern finden sich nun zwei Wohnungen von je rund 150 m² die übliche Größe einer Doppelhaushälfte. Doch von symmetrischem Zwillingswohnen keine Spur: In Loos'scher Raumplan-Manier sind die beiden Einheiten komplex ineinander verschränkt, sodass auch die nördliche Haushälfte Zimmer nach Süden erhalten hat.
Wer den ehemaligen Wohnteil betritt, muss gleich hinter der Haustür zwei Stufen nach unten gehen. Denn um die sehr niedrige Geschosshöhe auszugleichen, wurde der EG-Boden moderat abgesenkt. Man gelangt in den sogenannten »Fletz«, einen Flur, der einmal quer durchs Haus führte. An seinem Ende wurde ein Raum abgetrennt, der von der Rückseite des Gebäudes zugänglich ist und anstelle eines Kellers Platz für die Haustechnik bietet. In den Zimmern linkerhand bedeckt ein heller Dielenbelag die neue Bodenplatte, die Wände tragen weißen Putz. Er verbirgt die Wandheizung, dank der es möglich war, auf Radiatoren zu verzichten, die nicht zu einem bäuerlichen Interieur gepasst hätten. Rechterhand geht es in die Wohnküche, die im ehemaligen Stall eingerichtet wurde. Nacktes Mauerwerk verweist auf die nicht-repräsentative frühere Nutzung. Um für mehr Licht zu sorgen, ließ Haimerl vier Öffnungen in die Gebäuderückseite brechen, durch ihre spielerische Anordnung geben sie sich als nachträglicher Eingriff zu erkennen.
Eine steile knarzende Holztreppe führt vom Fletz ins obere Geschoss. Hier zeigen die Räume das größte Maß an Authentizität. Genauso gedrungen wie vor zwei Jahrhunderten dienen sie als Schlaf- und als Kinderzimmer. Originale Türen mit hoher Schwelle und niedrigem, handgeschnitzten Sturz sind alles andere als barrierefrei und verlangen den Bewohnern besondere Vorsicht ab. Die Dielen des unebenen alten Bodens blieben genauso unbekleidet wie weite Teile der Holzwände, auf denen sich die Farbreste vergangener Jahrhunderte erkennen lassen.
Radikaler Eingriff
Die zweite Wohnung betritt man über das ehemalige Scheunentor. Es wurde durch ein neues ersetzt, die Öffnung dahinter vollflächig verglast. Weil die alten Holzdecken morsch waren, wurde dieser Teil des Gebäudes komplett umstrukturiert. Unter dem Dach mit seiner 45°-Neigung versteckt sich jetzt ein Betonwürfel, der um 45° gekippt auf der Kante steht. Mit seinen Oberseiten zeichnet er das Dach von innen nach, seine geneigten Unterseiten dienen mal als Treppenlauf, mal als Auflagerfläche für eine Sitzbank, mal als schräge Decke.
Ein Split-Level-Raumkontinuum zieht sich vom abgesenkten EG, in dem ein Gästezimmer untergebracht ist, über den Essplatz im helleren Hochparterre bis hinauf unters Dach, wo die Bewohner auf einer Galerie am Kamin sitzend die Weite des Wohnraums und die Lichtfülle der Dachfenster genießen können. Immer wieder wechselt die Laufrichtung, durch die zahllosen Schrägen entsteht eine große räumliche Vielfalt. Um in dem offenen Interieur die Akustik in den Griff zu bekommen, ließ Haimerl einige Wandflächen und Brüstungen mit Nadelfilz bekleiden. In der Küche interpretiert er mit einer schwarzen Herdnische, die in die Wand eingelassen ist, das verrußte »Rauchkucherl« alter Bauernhöfe auf neue Weise. Einzige sichtbare Originalbauteile sind die alten Kehlbalken.
Wie raffiniert die Räume ineinandergreifen, zeigt sich im Bad: Über eine Luke unter dem Waschbecken lässt sich Schmutzwäsche entsorgen, die dann im darunterliegenden Hauswirtschaftsraum landet. Beinahe könnte man in dieser Wohnung vergessen, dass man sich innerhalb einer historischen Hülle bewegt. Bauernhaus-Atmosphäre kommt erst wieder in den etwas schummrigen Schlafzimmern mit ihren alten kleinen Giebelfenstern auf.
Mut zum Unperfekten
Das Ungewöhnlichste an dem Haus ist, dass hier nicht etwa eine Privatperson am Werk war, die für sich selbst ein Liebhaberstück geschaffen hat, sondern ein kommerziell agierender Bauherr, der für unbekannte Nutzer plant. Schön wäre, wenn dieser Umbau auch andere Investoren ermutigen würde, sich bei Denkmalen auf Konzepte mit einer starken architektonischen Aussage einzulassen. Er zeigt, dass sich auch Immobilien an den Mann bringen lassen, die sich nicht an gängigen Standards orientieren. Teils sehr niedrige Räume, wurmstichige Holzbalken, laut knarzende Böden, bei denen man an einer Stelle sogar zwischen den Dielen ins Zimmer darunter blicken kann, aber auch Interieurs mit ruppigem Sichtbeton und Wände, die um 45° aus der Vertikalen gekippt sind – all das ist meilenweit von den Usancen heutigen Mietwohnungsbaus entfernt. Ein Markt dafür ist aber offensichtlich vorhanden: Obwohl die beiden Einheiten mit einer Monatsmiete von rund 3 000 Euro selbst für Münchner Verhältnisse kein Schnäppchen sind, waren sie innerhalb weniger Stunden sofort vergeben.db, Di., 2015.12.01
01. Dezember 2015 Christian Schönwetter
Den Ort lesbar machen
(SUBTITLE) Mittelpunktbibliothek Alte Feuerwache in Berlin
Wer in Berlin ein öffentliches Gebäude bauen will, sollte v. a. mit (wenig) Geld umgehen können und über Improvisationstalent verfügen. Besonders gelungen ist es, wenn man dem Ergebnis das gute Konzept, nicht aber die zahlreichen Einschränkungen ansieht. Den Architekten dieser Bibliothek in Schöneweide ist dies durch die einfühlsame Einbindung des Bestands und mithilfe einiger Tricks gelungen.
Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick zählt zu den ruhigeren Stadtteilen Berlins. Abseits der Hauptverkehrsstraßen mag das auch so sein " an der Michael-Brückner-Straße, die Teil der Berliner Bundesstraße B96a ist, spürt man davon aber nur wenig. Stattdessen prägen der Straßenverkehr, die S-Bahn sowie eine Tankstelle mit Autowaschanlage das Bild und v. a. auch die akustische Wahrnehmung. Direkt gegenüber dieser nicht sehr einladenden Szenerie befindet sich eine unter Denkmalschutz stehende Feuerwache, die nun gemeinsam mit einem Neubau von Chestnutt_Niess Architekten als neue Mittelpunktbibliothek des Stadtteils genutzt wird.
Die Feuerwache wurde 1907/08 von Karl Alfred Herrmann gebaut. Für ein Feuerwehrgebäude scheinen die kleinteiligen Elemente ungewöhnlich, sie haben jedoch einen ganz pragmatischen Hintergrund: Der Schlauchturm diente gleichzeitig als Übungsobjekt für die Feuerwehrleute, die an Erkern, Vorsprüngen und Traufen das Anleitern und Aufsteigen trainierten. Nebenan befinden sich eine Schule und ein Pumpenhaus aus der gleichen Bauzeit.
Die Grundschule wurde im Rahmen der Stadterneuerung ebenfalls aufgewertet. Bibliothek, Schule und ein Nachbarschaftszentrum machen diesen Ort nun wieder zu einem Anlaufpunkt für die Anwohner.
Bestandsaufnahme
2009 wurde Chestnutt_Niess Architekten aus vier Büros ausgewählt und mit der Planung der Bibliothek beauftragt. Gleichzeitig begann die umfangreiche Sanierung im denkmalgeschützten Gebäude. Besonders wichtig war den Architekten, die schon mehrere Projekte im Bestand verwirklicht haben, den Ort lesbar zu machen. Jedes Gebäude erzählt ihrer Ansicht nach eine Geschichte, die es zu entdecken und weiterzuerzählen gilt. Chestnutt_Niess nahmen den Bestandsbau als Dreh- und Angelpunkt, indem sie den zweigeschossigen Neubau wie eine Spirale anordneten, die im Norden an den alten Schlauchturm andockt. Im EG gibt es zusätzlich eine Verbindung von Alt- und Neubau durch den eingeschossigen gläsernen Eingangsbereich. Von dort werden die Bibliothek, der Innenhof und auch die als Mehrzwecksaal genutzte ehemalige Wagenhalle erschlossen. Die Spiralform ist nicht nur im Grundriss, sondern auch im Schnitt ablesbar: Das Gebäude nimmt die Höhen der Feuerwache als Referenzpunkte auf. Daher fällt das Dach zum Altbau hin maßstabsschonend ab und fasst durch die Neigung auch den Innenhof ein. Der niedrigste Punkt befindet sich an der Ecke an der Eingangsbereich und Neubau aneinanderstoßen. Dann schlängelt es sich bis zur gegenüberliegenden Ecke im Osten nach oben und fällt danach wieder auf der anderen Seite Richtung Altbau ab.
Das Raumprogramm für die rund 85 000 Medien war eng und umfassend, das Budget knapp, dazu kommen Faktoren wie das kleine Grundstück und der hohe Grundwasserstand. Da eine Bibliothek keine Außenflächen benötigt, wurde das Grundstück unter Berücksichtigung der Abstandsflächen und der nötigen Feuerwehrzufahrt maximal ausgenutzt. Durch dieses Ausreizen der Flächen entstand in der Mitte genug Platz für einen Innenhof, der die Bibliothek belichtet und einen geschützten Außenraum bietet.
Weniger ist mehr
Betritt man die Bibliothek, hat man sofort einen Eindruck über alle Etagen. EG und OG sind wie Galerien über dem UG angeordnet. Deckenausschnitte, Lufträume und Fensteröffnungen sorgen für Großzügigkeit in der eigentlich eher kleinen Bibliothek mit 2 200 m² Hauptnutzfläche und dem Minimum an nötiger Raumhöhe. Die Geometrie des Gebäudes ist komplex, aber dank der Übersichtlichkeit leicht verständlich. Auch die Mitarbeiter der Bibliothek schätzen den Überblick und die intuitive Orientierung im Haus. Die Lufträume sind nicht übereinander gelagert, wodurch vielfältige Blickachsen entstehen und gleichzeitig der Schall besser verteilt und umgeleitet wird – nicht unerheblich in einer Bibliothek. Im OG sorgen gelochte Deckenelemente zusätzlich für Schallabsorption.
Das EG ist zum hellen Hof ausgerichtet, während sich das OG nach außen orientiert. Im OG gibt es keine Fenster zum Hof, was das Dach vom Innenhof aus sehr flächig und präsent erscheinen lässt. Die Wahl der Außenbekleidung verstärkt diesen Eindruck zusätzlich: Vorpatiniertes Zinkblech kam sowohl für die Fassade als auch für das Dach zum Einsatz. Im gesamten Gebäude gibt es – bis auf die 24h-Rückgabestelle an der Straßenseite – keine kleinteiligen Öffnungen. Stattdessen gliedern bewusst platzierte große Fensterflächen den Raum und schaffen so verschiedene Zonen. Im Norden erstreckt sich eine große Öffnung über beide oberirdischen Etagen und einen kleinen Teil des Dachs. Durch die niedrige Gebäudehöhe, den großen Abstand zum nächsten Gebäude und den Oberlichtanteil dringt trotz Nordausrichtung viel Licht ins Innere. Gerade zum Lesen sei dieses indirekte Nordlicht sehr angenehm, so die Architekten.
Um möglichst wenig Flächen zu verschwenden. sind in alle Außenwände und Brüstungen entweder Regale oder Arbeitstische integriert. Alles folgt einem einfachen Prinzip: Stützen, Kern und Decken sind aus Sichtbeton gefertigt, die hinzugefügten Elemente sind sozusagen auf die Konstruktion gestülpt. So ist sofort erkennbar, welche Elemente konstruktiv und welche gestalterisch sind. Für die Wandbekleidung haben die Architekten schlichte Sperrholzbretter verwendet. Als Bodenbelag wählten sie grünes Linoleum, das widerstandsfähig und günstig ist und zudem einen schönen Kontrast zum roten Backstein des Bestandsbaus bildet. Beim Sichtbeton hätten sie auf den ebenfalls eher robusten Eindruck aber gerne verzichtet. »Sichtbetonklasse 1 ist selten der Wunsch der Architekten, das hat natürlich mit Kosten zu tun«, so Rebecca Chestnutt bei der Besichtigung. Insgesamt mussten die Architekten aber kaum Kompromisse eingehen, vielmehr haben sie aus den Vorgaben und Einschränkungen ein Entwurfsprinzip gemacht.
Der Keller beginnt im 3.OG
Zu den Kniffen zählt u.a. die leichte Anhebung des EGs, wodurch sie für das UG weniger in die Tiefe gehen mussten. Die entstandenen Niveauunterschiede zur Straße und zum Bestand werden durch flache Rampen ausgeglichen. Kellerfläche ist teuer, und in Berlin steht das Grundwasser zudem recht hoch. Insgesamt ist das UG mit geringerer Fläche und wenig Nebenräumen für Technik kompakt und wirtschaftlich gehalten. Möglich macht das folgender Trick: In der Alten Feuerwache werden nur die unteren drei Geschosse als Verwaltungsräume und für den Mehrzwecksaal genutzt. Der Turm verfügt wegen seiner kleinen Grundfläche hauptsächlich über Verkehrswege. Hätte man diese Räume ebenfalls für die Bibliothek als Nutzfläche verwendet, hätte man nur wenig Platz gewonnen, wäre aber aufgrund der Höhe in die Gebäudeklasse 5 gerutscht " mit teuren Konsequenzen für den Brandschutz. Auch ein zusätzliches Treppenhaus wäre nötig geworden. Chestnutt_Niess haben daher fast die gesamte Lüftungs- und Heiztechnik in die oberen Turmgeschosse gelegt und sich so Platz im UG sowie strengere Auflagen gespart.
Etwa 50% der Regale sind in die Wände integriert, die andere Hälfte sind schlichte in den Raum gestellte Regale. Beide Regaltypen haben durch die hellen Fronten und dunklen Innenflächen Kontrast und Tiefe. Angesichts der Aussage, dass das Raumprogramm sehr viele Medien vorsah und der Platz begrenzt war, wirken die Regale überraschend leer. Das liegt an einer großzügigen Planung, die Wachstum einkalkuliert, aber auch an der erfreulichen Tatsache, dass die Bibliothek gut angenommen wird und daher nicht annähernd der gesamte Bestand in den Regalen steht.db, Di., 2015.12.01
01. Dezember 2015 Anke Lieschke