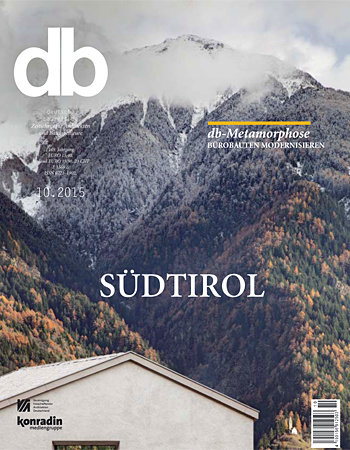Editorial
Fast zehn Jahre nach unserer letzten Südtirol-Ausgabe betrachten wir die Region erneut und fragen: Wie hat sich das Bauen in Südtirol entwickelt und verändert? Was sind die vorrangigen Bauaufgaben und Themen? Welche uns bekannten Architekten prägen weiterhin die Architektur vor Ort und welche neuen Büros sind hinzugekommen? Und in der Tat ist es um einige der altbekannten, und im letzten Heft noch mit Projekten vertretenen Protagonisten – wie Walter Angonese oder Walter Dietl – recht ruhig geworden, stattdessen sind neue oder bislang weniger präsente Namen auf der Bildfläche erschienen, von denen wir einige mit ihren Bauten vorstellen. Anhand der ausgewählten Projekte lässt sich aber auch erkennen, was Südtiroler Architektur ausmacht, wofür sie steht und was sie prägt: auf jeden Fall der starke Bezug zur Landschaft – zu den Berghängen und Gipfeln; gebaut wird mit der Natur – aber auch die Verbundenheit zu örtlichen Bautraditionen, wobei diese weiterentwickelt und interpretiert werden. Zudem zeichnet sie hohe handwerkliche Qualität und Sorgfalt im Detail aus sowie der Einsatz natürlicher und ortsbezogener Materialien wie Naturstein, Holz und (Lehm)Putz, ergänzt durch Glas, Metall und Beton. Durch den begrenzten Platz im Heft, ist es natürlich nur ein Streiflicht, das wir auf die Südtiroler Architekturszene werfen können; doch sicher gewährt es spannende Einblicke und macht vielleicht Lust auf eine baldige Reise in die Region. | Ulrike Kunkel
Investition in die Zukunft
(SUBTITLE) Grundschule in Taufers im Vinschgau (I)
Die neue Grundschule bietet nicht nur zeitgemäße Lernräume für rund 40 Grundschüler aus 5 Jahrgangsstufen sowie eine öffentliche Bibliothek, sie ist gewissermaßen Zeichen einer neuen Zeit und Teil einer komplexen Umstrukturierungsmaßnahme, die dem auf 1 250 m über dem Meeresspiegel gelegenen Straßendorf eine neue Perspektive gibt.
Für einen Ort mit knapp 1 000 Einwohnern zählt die Durchführung eines Ideen- und Planungswettbewerbs keineswegs zum Tagesgeschäft. Entsprechend sorgfältig ging die Gemeinde Taufers im Südtiroler Vinschgau vor und ließ sich zunächst einmal v. a. viel Zeit. Ziel des 2006 ausgelobten Verfahrens war daher die Entwicklung eines in den darauffolgenden 10-15 Jahren umzusetzenden Gesamtkonzepts zur Neustrukturierung der öffentlichen Einrichtungen. Mit anderen Worten: Es ging um nichts Geringeres als um die Zukunft des Dorfs, das – wie viele andere Dörfer auch – unter der stetigen Abwanderung junger Familien leidet. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass das in einer Informationsveranstaltung präsentierte Vorprojekt der neuen Grundschule bei den Einwohnern im Mittelpunkt des Interesses stand.
Die Jury, zu der u. a. die mit dem alpinen Bauen vertrauten Schweizer Architekten Carl Fingerhuth und Conradin Clavuot gehörten, entschieden sich unter den 32 eingereichten Arbeiten für das Projekt des Bozener Büros CeZ Calderan Zanovello Architekten, weil es sich fast so lesen ließ wie die dreidimensionale Übersetzung des Auslobungstexts. Entsprechend heißt es im Juryprotokoll: »Die selbstbewusste und doch subtile Eingliederung und der liebevolle, erfinderische und sinnvolle Umgang mit dem Bestand zeigt den Willen der Verfasser, einen respektvollen und doch Neues und Befreiendes bringenden Eingriff vorzunehmen.«
Im Anschluss erfolgte auf Grundlage des siegreichen Masterplans und der ebenfalls beauftragten Planung des Grundschulneubaus die gesetzlich vorgeschriebene Auslobung weiterer Realisierungswettbewerbe: beispielsweise der Umbau des Rathauses, die Erweiterung des ehemaligen Gasthauses »Schwarzer Adler« zum kulturellen Treffpunkt mit Vereinsräumen (Jugendgruppe, Schützen, Heimatbühne, Frauenchor) sowie der Neubau eines Kindergartens. All diese Verfahren konnten Calderan Zanovello Architekten aufgrund des jeweils preisgünstigsten Angebots für sich entscheiden – mit dem positiven Nebeneffekt, dass die im Umkreis von lediglich 100 m an der Hauptstraße Taufers liegenden Gebäude heute funktional und architektonisch miteinander verbunden sind und harmonieren.
Das neue Schulhaus für ca. 40 Grundschüler der ersten bis fünften Klasse platzierten die Architekten als Solitär an der Stelle eines baufälligen Altbaus unmittelbar an der Hauptstraße. Dass es sich hierbei auf den ersten Blick um ein außergewöhnliches Gebäude handelt, vermitteln allein schon die unregelmäßigen, teils flächenbündigen, teils in abgeschrägte Laibungen gesetzte Fenster sowie der abgerundete Übergang von Außenwand und Traufe (ein Merkmal, über das in der Region nur besondere Bauten verfügen). Ebenso offensichtlich ist aber auch, dass es gleichzeitig ganz selbstverständlich in die bestehende Dorfstruktur integriert ist. Beispielsweise, weil seine Kubatur und die verputzten Wärmedämmbetonwände dem Erscheinungsbild der Nachbargebäude entsprechen, und weil es zusammen mit dem Schwarzen-Adler-Haus und einer 2006 nach Plänen von Christian Kapeller fertiggestellten Sporthalle einen kleinmaßstäblichen Dorfplatz bildet. Dieser Dorfplatz öffnet sich als neuer Kommunikationsraum im Zentrum Taufers in voller Breite zur Straße und ist dank dreier schmaler Treppen mit dem nach Norden ansteigenden Dorf vernetzt. Eine der Treppen führt über einen glasgedeckten Gang zwischen Sporthalle und Neubau zu dem vom 1. OG der Grundschule erreichbaren Pausenhof.
Vernetzung mit den Nachbargebäuden
So klein der schachbrettartig zum Dorfplatz versetzte und vor Straßenlärm geschützte Pausenhof auch ist, so wichtig ist seine Funktion als Vermittler zwischen den von hier aus erreichbaren alten, neuen, erweiterten bzw. noch zu erweiternden Gebäuden: Ein lang gestreckter Neubau, verknüpft mit dem unteren Geschoss des alten Mehrzweckhauses (hier befinden sich u. a. die Räumlichkeiten der örtlichen Feuerwehr), soll in einem nächsten Bauabschnitt den Kindergarten aufnehmen. In diesem Zusammenhang erhielt die Sporthalle einen zusätzlichen Eingang zum Pausenhof und einen Aufzug, um so die neu über dem Eingangsbereich der Sporthalle eingerichtete Mensa sowie die Sporthalle selbst für die Grundschüler und Kindergartenkinder barrierefrei zugänglich zu machen. Die dreigeschossige Schule öffnet sich zum Hof mit einer großflächigen Holz-Glas-Fassade, hinter der sich ein zweigeschossiger Flurbereich mit einer als Lehrküche dienenden Kinder-Küchenzeile befindet.
Der Haupteingang der Schule liegt unmittelbar am Dorfplatz, die eigentlichen Schulräume befinden sich in den beiden Obergeschossen. Den Großteil der Erdgeschossfläche nimmt eine Bibliothek ein, die sich dank großer Schaufenster in der Straßenfassade deutlich als öffentliche Einrichtung zu erkennen gibt. Als solche bietet sie neben einem umfangreichen Angebot an Büchern, Zeitschriften und Medien auch verschiedene Lesebereiche für Erwachsene und Kinder sowie eine von der Straße abgeschirmte Terrasse unterhalb des Schulgartens. Für die Dorfbevölkerung ist sie über einen eigenen Zugang von der Hauptstraße erreichbar, während Schülern und Lehrern ein Nebeneingang direkt im Eingangsflur der Schule zur Verfügung steht. An diesem zentralen Verteilerbereich liegen überdies der Computerraum und die Werkstatt der Grundschule und ein neu geschaffener interner Verbindungsgang zur Sporthalle. Dieser Gang spielt eine besondere Rolle, da die Halle nicht nur als Mehrzweckhalle und dem Schulsport dient, sondern auch als Ort für Schulveranstaltungen – auf eine eigene Aula wurde im Schulhaus aus Kosten- und Platzgründen verzichtet.
Natürliche Materialien
Der Weg zu den Klassenzimmern führt vom Eingangsflur, an der Bibliothek vorbei, über eine einläufige Treppe ins 1. OG. Ebenso wie der Verbindungsgang zur Sporthalle, die Eingangsbereiche der Gebäude am Dorfplatz und alle anderen Verkehrsflächen des Schulneubaus, verfügt die Treppe über einen Belag aus grauem Luserna-Gneis. Dieser Naturstein aus dem Piemont eignet sich aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit insbesondere sehr gut für fließende Übergänge von außen nach innen, wo in schneereichen Wintern mit einem hohen Wassereintrag zu rechnen ist. Für warme Farbtöne und eine angenehm natürliche Atmosphäre sorgen die im gesamten Gebäude verwendeten Lärchenholz-Paneele, die aus Brandschutzgründen mit einer transparenten Brandschutzbeschichtung versehen werden mussten. Sie finden sich als Wand- und Deckenbekleidung ebenso wieder wie bei Einbaumöbeln, Geländern, Türblättern und -zargen.
Neue pädagogische Konzepte
Trotz des großzügig verglasten Windfangs, trotz Glastür zur Bibliothek und Oberlicht im Gang zur Sporthalle – das EG wirkt unwillkürlich düster und kann es kaum verbergen, zur Hälfte in den Hang eingegraben zu sein. Im Gegensatz hierzu erscheint das 1. OG offen, luftig und hell. Hierzu trägt die Glasfassade zum Pausenhof, der großzügige Flur mit offener Lehrküche, aber auch der große Garderobenbereich an der Westfassade wesentlich bei. In der nordöstlichen Ecke des Gebäudes, mit strategisch günstigem Blick auf den Dorfplatz und den Pausenhof, liegt das Lehrerzimmer, während sich zwei Klassenzimmer an der Südfassade um einen »Ausweichraum« für Intensivierungsstunden gruppieren. Die Unterrichtsräume sind »offene Klassenzimmer«, die sich nicht zuletzt dank der beweglichen, flexibel konfigurierbaren Dreieckstische für offene und kommunikative pädagogische Konzepte eignen. Im 2. OG finden sich drei weitere Klassenräume, die sich von den anderen v. a. durch die sichtbar belassene Kiefernholzkonstruktion des Dachs und den noch eindrucksvolleren Blick in die umliegende Bergwelt unterscheiden.
Egal, ob städtebaulich, architektonisch oder funktional – der Schulneubau zeigt sich aus jeder Perspektive und auf jeder Maßstabsebene als überaus sorgfältig in sein Umfeld integriert, ohne sich diesem jedoch in irgendeiner Form anzubiedern. Gerade dies verleiht dem Gebäude jene Kraft, die den Dorfbewohnern signalisiert, dass ihr Bedürfnis nach qualitätvollen öffentlichen Einrichtungen ernst genommen wird. Man wird in ein paar Jahren an den Einwohner- und Kinderzahlen ablesen können, wie gut das Gesamtkonzept zur Neustrukturierung der öffentlichen Einrichtungen aufgeht. Mit den vernetzten neuen bzw. neu strukturierten Einrichtungen stehen die Chancen sicher nicht schlecht, dass die vor gut zehn Jahren in Angriff genommenen Pläne der Gemeinde aufgehen.db, So., 2015.10.11
11. Oktober 2015 Roland Pawlitschko
Mit Weitblick
(SUBTITLE) Erweiterung eines Weinguts in Völs am Schlern (I
Ein Paarhof am Hang, bestehend aus Wohnhaus und Stadel — ein ortstypisches Bild, das sich das Weingut auch nach der Erweiterung bewahrt hat. Der Neubau ersetzt den »Vorgängerstadel« an der selben Stelle und mit unwesentlich größerer Kubatur, was das Hof-Ensemble aber sehr gut verträgt.
Kommt man Anfang August aus dem brütend heißen Bozener Talkessel ins Eisacktal hinauf Richtung Völs am Schlern zum Weingut »Bessererhof«, versteht man die Bedeutung des Worts Sommerfrische sofort; es überrascht nicht, dass für den deutschsprachigen Raum die besonders frühe Verwendung des Begriffs gerade von hier überliefert ist, wo die Bewohner den heißen Talkessel in den Sommermonaten gen Ritten, St. Konstantin oder eben Völs verlassen: immer noch warm, geht ein angenehmes Lüftchen und die Nächte bringen verlässlich Kühle. Zusammen mit den besonderen Böden, ist es genau diese Kombination, die dem Bessererhof, dem südlichsten Weingut im Eisacktal, seine besonderen Weine beschert.
Das ortstypische Paarhof-Ensemble liegt in imposanter Hanglage inmitten von Weinreben und Apfelplantagen. Mit einer Produktion von 40 000 Flaschen pro Jahr und neun unterschiedlichen Sorten gehört das Weingut zu den mittleren Betrieben Südtirols. Umso erstaunlicher, dass bis zur Einweihung des neuen Wirtschaftsgebäudes mit der Ernte 2014 die gesamte Weinverarbeitung einschließlich kleinerer Verkostungen und der anfallenden Verwaltungs- und Büroarbeit recht beengt im Keller des Wohnhauses der Familie und im Haus selber untergebracht waren. Der Wunsch nach einem gesonderten, großzügigen Produktionskeller entstand, und die Bauherren beauftragten den Architekten Theodor Gallmetzer, von dem sie u. a. den »Weinraum Kobler« in Margreid (s. db 9/11, S. 30) kannten, mit der Planung.
Architektonische und landschaftliche Bezüge
Das neben dem Wohnhaus gelegene, ehemalige Wirtschaftsgebäude aus den 60er Jahren erwies sich als ungeeignet, um es den heutigen Anforderungen anzupassen und entsprechend umzubauen; also entschied man sich für einen Abriss und anschließenden Neubau mit sehr ähnlichen Proportionen an derselben Stelle. Zum einen war es eine Auflage der Gemeinde, das charakteristische Erscheinungsbild als Paarhof zu erhalten, zum anderen auch das Anliegen des Architekten: »Ich wollte ein Gebäude realisieren, das sich nicht zwanghaft vom Bestand und vom Vorgängerbau abhebt, aber auch nicht anbiedernd auftritt. Mein Ziel war es, eine zurückhaltende, dabei aber eigenständige und eindeutig zeitgenössische Sprache zu finden, die ortstypische Architektur-Merkmale aufnimmt, sie aber nicht einfach kopiert.« Und so formuliert und interpretiert das neue Wirtschaftsgebäude gewohnte Architektur-Elemente und Materialien geschickt neu und komplettiert dadurch das Hof-Ensemble.
Als ortstypisch lassen sich im Wesentlichen vier Merkmale ausmachen: die Gliederung des Baukörpers in zwei Bereiche, die ihrerseits in unterschiedlichen Materialien ausgeführt sind – der untere gemauert, der obere in Holz. Außerdem springt das obere Geschoss des zum Haus gehörenden »Stadels« hervor und besitzt einen Balkon. Gallmetzer nimmt die klassische Zweiteilung und die wechselnden Materialien auf, verwendet aber Beton für den Sockel und Streckmetall aus Corten-Stahl als Bekleidung für den in Holzkonstruktion errichteten Aufbau; dieser kragt aus, und die schlanke Balkonkonstruktion ist gleichzeitig seitliche Erschließung, die den Zugang zum Gebäude im ersten Stock ermöglicht. Auf einen zentralen Eingang wurde bewusst verzichtet. Über die großen Glasfenster und -türen werden dem Besucher von dem Erschließungsbalkon aus zudem Einblicke in das Gebäude gewährt, auch wenn die Besitzer nicht vor Ort sind: eine offene und einladende Geste.
Die leichte Rosafärbung des Betonsockels überrascht nur im ersten Moment; beim Blick hinauf zu den Felswänden der Dolomiten wird der Bezug klar: Der mit Eisenoxidpigmenten gefärbte Beton lehnt sich an das Porphyr-Gestein der Berge an. Unterstützt wird die Verwandtschaft noch durch die grobe Körnung und die raue, zerklüftete Oberfläche der vorbetonierten Sichtbetonschale, von der nach der Trocknung mit einem Hochdruck-Wasserstrahl mit ca. 2 000 Bar rund 1,5 cm wieder abgetragen wurden – Gesteinsverwitterung im Zeitraffer. Doch es gibt sogar noch einen weiteren Bezug: Die Textur des Betons erinnert an die Weinstein-Ablagerungen in den Fässern. ›
Wein-Unterwelt
Das Herzstück des Gebäudes ist in gewisser Weise aber der Keller. Schließlich findet hier die Weinproduktion und -lagerung statt. Ein Treppensystem, das um die Hauptmauer herum gebaut ist, erschließt jede Ebene (Lager, Weinproduktion, Anlieferung/Verkostung). Den eigentlichen Weinkeller, der genau genommen im EG liegt, betritt man über eine Art Kanzel; von hier aus lässt sich der große Raum mit seinen Stahl- und einigen Holzfässern wunderbar überblicken. Treppe und Innenwände sind in glattem Sichtbeton ausgeführt und haben dieselbe Pigmentierung wie die Außenwand. Die Deckenleuchten sind sehr sauber in den Beton eingelassen, die Epoxidharzbeschichtung des Bodens ermöglicht ihn hygienisch einwandfrei zu halten. Der Keller schiebt sich in den Hang hinein, wobei ein schönes Detail die Aussparung in der hinteren Wand ist, wodurch der Blick auf den Fels freigegeben wird. Ursprünglich war diese Wand sogar gar nicht vorgesehen, sondern der Fels sollte die Rückwand bilden. Die Tragkraft erwies sich allerdings als nicht ausreichend.
Durch die konstante Temperatur des umgebenden Erdreichs von ca. 12 °C und die zweischalige Betonkonstruktion liegt die Raumtemperatur sommers wie winters um die 15 °C und ist damit optimal für die Weinproduktion. Mit Flaschen- und Weinlager sowie Technikräumen und einem Raum für eine eventuelle Schnapsbrennerei liegt der weitaus größere Teil des Gebäudes unterirdisch. Nur gut 1 000 der insgesamt 4 000 m³ schauen aus der Erde heraus; etwas mehr als beim Vorgängerbau, was das Ensemble aber nicht aus dem Gleichgewicht bringt.
Weinverkostung mit Ausblick
Taucht man aus der Wein-Unterwelt wieder auf, wird man im talseitig gelegenen, angenehm proportionierten Verkostungsraum mit dem grandiosen Blick über das Eisacktal belohnt. Auf dem vorgelagerten, großzügigen Balkon schwebt man über den Weinbergen. Einziger Wermutstropfen ist die nicht unerhebliche Geräuschkulisse der Brennerautobahn, die dem Tal schon ziemlich zusetzt und die sich nur schwerlich ausblenden lässt. Im Verkostungsraum selber bestimmen warme, natürliche Materialien und Farben die Atmosphäre. Zunächst fallen die erlesenen Tischlermöbel auf. Barhocker, Theken und bewegliche Korpora, die sich je nach Bedarf frei anordnen lassen, wurden nach den Entwürfen des Architekten aus Eiche gefertigt. Erst dann entdeckt man den individuellen Fußboden: handwerklich gefertigte, gegossene, dann geschliffene Fliesen wieder aus demselben Beton. Im rötlich-braunen Lehmputz der Wände glitzern feine Glasbeimischungen und über allem schwebt die hölzerne Lamellendecke aus Nussbaum, Eiche und Birke, in die Beleuchtung und Belüftung integriert sind und die akustisch wirksam ist. Ein kleines Labor und das nun endlich adäquate Büro der Winzerin mit einem inszenierten Ausblick nach Schlern und zu den Weinreben der Familie hinauf schließen sich an. In beiden Räumen wurde ein heller, glatt abgezogener Lehmputz verwendet.
Doch selbst ein Besuch der sanitären Anlagen lohnt: Die Wände aus gehobelten Fichtenbrettern sind im Vorraum mit der »Lege« (Rückständen) aus den Weinfässern gestrichen und erhalten davon ihre satte rote Farbe. Von dem kleinen Vorraum aus gelangt man auch zur Anlieferung und zur Abladestation der Trauben auf der Rückseite des Gebäudes. Die Trauben werden hier von den Kämmen befreit und über Schläuche direkt in die darunter liegenden Stahlfässer gefüllt.
Der Erweiterungsbau des Weinguts Bessererhof besticht durch seine gelungene Einbettung in die Landschaft und die überzeugende Interpretation der ortstypischen Bautradition. Die bemerkenswerte Entwurfssorgfalt und die Verarbeitungsqualität der Materialien sind eine Freude.db, So., 2015.10.11
11. Oktober 2015 Ulrike Kunkel
Vermittelnde Zick-Zack-Form
(SUBTITLE) Hauptsitz der Südtiroler Volksbank in Bozen (I)
Die Volksbank Südtirol verfügt über rund 200 Filialen zwischen Brenner und Venedig, die Mehrheit der Mitglieder stammt aus Südtirol und der größte Teil des Kapitals liegt in Südtiroler Händen. So bekennt sich auch der erst im März bezogene neue Hauptsitz der Bank klar zum Standort Bozen, indem er vermittelnd auftritt, sich zur heterogenen Umgebung hin öffnet und damit einen neuen Identifikationspunkt schafft.
Das Umfeld des neuen Hauptsitzes der Südtiroler Volksbank könnte diffuser nicht sein. Im Umkreis von 200 m befinden sich neben Einfamilienhäusern, Geschosswohnungsbauten und Tennisplätzen auch ein Bürohochhaus, ein weiterer Verwaltungsbau, Gewerbehallen und ein Multiplexkino – das Ganze eingeklemmt zwischen einem Rangierbahnhof und einem entlang des Flusses Eisack angelegten Straßengeflecht, das diesen Ort über eine Bundesstraße mit der am anderen Ufer vorbeiführenden Brennerautobahn verknüpft. Die traditionsreiche Bank ließ sich u. a. deshalb in dem von der Innenstadt isolierten Quartier an der Schlachthofstraße nieder, weil sie hier bereits seit 30 Jahren Büros unterhält. Eine eher untergeordnete Rolle für die Standortentscheidung, mit Blick auf die Zukunft aber dennoch nicht ganz unwichtig, spielte die Tatsache, dass es seit dem 2011 durchgeführten Städtebauwettbewerb zum Bahnhofsareal die begründete Hoffnung einer besseren Anbindung an die Stadt gibt.
Da der Vorgängerbau weder hinsichtlich der räumlichen Potenziale noch in Bezug auf die Bausubstanz den heutigen Ansprüchen der Volksbank entsprach, entschloss man sich, diesen abzureißen und an seiner Stelle einen maßgeschneiderten Neubau zu errichten. Hierzu lobte die Bank 2008 einen Planungswettbewerb aus, der es nicht zuletzt ermöglichen sollte, die bislang auf mehrere Standorte verteilten Abteilungen zusammenzulegen. Für Christian Rübbert, den Architekten des Siegerprojekts, war sehr schnell klar, dass »man mit einer herkömmlichen Baukörperdisposition entweder keine innenräumlichen Qualitäten oder zu wenig Bürofläche erzielen würde«. Und so präsentiert sich sein Projekt – anders als die meisten Arbeiten der 62 weiteren Wettbewerbsteilnehmer – nicht als orthogonal gereihte oder mäandrierende Baustruktur, sondern in Zick-Zack-Form. Mit dieser Konfiguration entsteht ein durchgängig schlanker Baukörper mit viel Fassadenfläche und großen zusammenhängenden Geschossebenen, der das lange, schmale Grundstück optimal ausnutzt.
Eigenwilliger, aber integrierender Baukörper
Erscheint die Zick-Zack-Form aus der Vogelperspektive, z. B. von den umliegenden Bergen, recht eigenwillig und extravagant, wirkt der Baukörper aus der Fußgängerperspektive eher zurückhaltend, unprätentiös und wie selbstverständlich in sein Umfeld integriert. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen ist die – mit Ausnahme der Straßenseite – als hinterlüftete Lochfassade ausgebildete Gebäudehülle mit eigens entwickelten Keramikplatten bekleidet, deren anthrazitfarbene und kleinmaßstäblich gefaltete Oberfläche an das Gestein der steil aufragenden Felswände Bozens erinnert. Die matt glasierten Platten sorgen außerdem für ein feingliedriges Erscheinungsbild und lebhafte Reflexionen, die die Fassaden je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung unterschiedlich schimmern lassen. Zum anderen führt die mehrfach geknickte Gebäudeform zur Ausbildung von dreiecksförmigen Außenbereichen, die angenehm unregelmäßige Übergänge zur Nachbarbebauung schaffen. Während auf den Längsseiten klar definierte Freiflächen für eine hauseigene Kindertagesstätte, die Anlieferung und einen Mitarbeiterbereich entstehen, sorgt der asymmetrisch gesetzte Knick in der verglasten Nordfassade für die Aufweitung des Straßenraums. Auf diese Weise entsteht ein kleiner öffentlicher Vorplatz mit Sitzskulpturen, durch den sich der Neubau deutlich von den in der Straßenflucht platzierten Nachbargebäuden abhebt. Dennoch wirkt das Gebäude nicht aufdringlich inszeniert: »Es gibt nichts Auftrumpfendes an dem Projekt, keine Symmetrien, keine Achsen, keine Überhöhungen, keine Erhabenheit, keine großspurigen Gesten, keinen Schnickschnack«, sagt Rübbert, der damit auf das geschäftliche Selbstverständnis der Volksbank Bezug nimmt.
Kommunikationsräume überall
Die räumliche Begrenzung des Vorplatzes übernimmt eine Glasfassade mit vorgelagerter Rahmenstruktur, die dem Neubau Maßstäblichkeit verleiht und ihn gleichermaßen verträglich und selbstbewusst in das heterogene Umfeld integriert. Die Glasfassade dient der Bank darüber hinaus als »Kommunikationsfenster zur Stadt und zur Gesellschaft«, das die im Innern stattfindenden Tätigkeiten sichtbar macht und Kundenfreundlichkeit, Offenheit und Transparenz signalisieren soll. Wer dieser symbolischen Einladung folgt und sich ins Innere begibt, findet sich in einem weitläufigen und frei zugänglichen Eingangsbereich mit großem Empfangstresen, offen gestalteter Bankfiliale, Foyer eines auch extern zu mietenden Veranstaltungsraums sowie Cafeteria wieder. Im rückwärtigen Teil des EG befindet sich ein großer Besprechungsbereich mit unterschiedlich gestalteten und ausgestatteten Konferenzräumen. Hier sind Meetings in großer oder kleiner Runde möglich (in Loungeatmosphäre, im Stehen oder an Konferenztischen) – mit dem Vorteil, dass Gäste weder unerwünschte Einblicke in den Arbeitsalltag erhalten noch die rund 300 Mitarbeiter der oberen Bürogeschosse stören. Das gesamte Innenraumkonzept geht auf das Büro Innocad (Graz) mit bergundtal (Bruneck) zurück.
Dass die als »space4dialogue« bezeichnete kommunikative Offenheit auch in den Arbeitsbereichen der drei nahezu identischen Obergeschosse im Mittelpunkt steht, ist auf den ersten Blick erkennbar. Sämtliche Büroarbeitsplätze – auch jene der Geschäftsführung, der Personal- und Finanzabteilung – befinden sich im Open Space. Die grundsätzlich einzelnen Mitarbeitern fest zugeordneten Schreibtische sind in Vierergruppen entlang der Fassaden aufgereiht – der Eindruck eines unangenehmen Großraums entsteht dabei dennoch von keinem Standpunkt der gut 2000 m² großen, jeweils als ein Brandabschnitt konzipierten Fläche. Visuelle und akustische Privatsphäre entsteht nämlich schon allein durch die Zick-Zack-Form des Gebäudes, die den Grundriss in überschaubare Zonen aufteilt. Hinzu kommen immer wieder zwischen den Arbeitsbereichen für maximal zwölf Mitarbeiter eingeschobene, verglaste Besprechungs- und Rückzugsinseln, das eichenholzfurnierte Ablage-, Raumteilungs- und Akustikmöbel »Bergundtal« sowie die organisch geformten mittigen Kernzonen, die Treppenhäuser, Sanitär-, Kopier- und andere Nebenräume enthalten. Sämtliche Kerne sind von der Künstlerin Esther Stocker mit schwarzen Farbmustern versehen worden, die diesen »tragenden Säulen« des Gebäudes ein einheitliches, inspirierend kreatives, auf Dauer vielleicht aber auch etwas zu lebhaftes Erscheinungsbild verleihen.
Einbeziehung der Mitarbeiter
Trotz anfänglicher allgemeiner Vorbehalte gegenüber Open-Space-Lösungen werden die Büroräume von der Belegschaft heute durchwegs als positiv bewertet. Dies hat v. a. damit zu tun, dass sich bereits zwei Jahre vor dem Umzug 17 »Nutzervertreter« aus den unterschiedlichen Abteilungen zusammengeschlossen haben, um als Ansprechpartner sowohl für die übrigen Mitarbeiter als auch für die Geschäftsführung und die intern am Bau beteiligten zur Verfügung zu stehen. In insgesamt sechs Workshops untersuchte die Gruppe z. B., welche Erwartungen an die zukünftigen Arbeitsplätze bestehen und welche Arbeitskultur mit welchen Spielregeln dort gelebt werden soll. Zusätzlich wurden Umfragen durchgeführt und ein Internetportal eingerichtet, das alle wichtigen Informationen zum Neubau bereithielt. Ein unmittelbares Ergebnis der von den Mitarbeitern vorgetragenen Wünsche ist beispielsweise die Kindertagesstätte im südlichen Teil des EG, die 15 Betreuungsplätze für Kinder bis drei Jahre bietet und Volksbank-Mitarbeitern ebenso offensteht wie Mitarbeitern der umliegenden Unternehmen.
Zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz trägt neben dem partizipativen Ansatz und der Vielfalt an Arbeits- und Rückzugsbereichen (z. B. Cafeteria, Lounges, Besprechungsnischen und -inseln, »Telefonzellen«, Regenerationsräume) auch der Raum selbst bei. Zum einen in Form einer ergonomischen Möblierung und einem zurückhaltenden Farbkonzept, zum anderen mit hellen Innenräumen, einer zonenweise steuerbaren Heiz- und Kühldecke sowie großen Doppelfenstern mit hinterlüfteter Prallscheibe und innenliegendem Sonnenschutz. Durch diese Doppelfenster gelangt bei geöffnetem Innenfester beruhigte Luft in die Büroräume, während der Zwischenraum bei geschlossenem Fenster als sommerlicher und winterlicher Klimapuffer dient. Zusammen mit den gut gedämmten Außenwänden erreicht der nach dem Südtiroler KlimaHaus-A-Standard errichtete Neubau einen Heizwärmebedarf von lediglich 15 kWh/m²a. Ohne mechanische Lüftungsanlage kommt das Gebäude aufgrund der vielen Sonnenstunden und der hohen sommerlichen Temperaturen im Bozener Talkessel allerdings nicht aus. Das Ziel der Bank, einen Ort der Offenheit und Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen zu schaffen, ist ebenso mühelos gelungen wie die Vorgabe, ein identitätsstiftendes und in sein Umfeld integriertes Gebäude zu realisieren.
Dass der neue Hauptsitz der Volksbank das Interesse der Menschen geweckt hat, zeigen die zahlreichen Berichte in den lokalen Medien und die Zugriffe auf die ausführlich über Planung und Realisierung informierende Website, aber auch die Tatsache, dass die immer wieder angebotenen Hausführungen regen Zulauf verzeichnen. Ein Teil dieses Interesses ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass es im insgesamt eher landwirtschaftlich geprägten Südtirol bislang kaum andere beispielhafte Bürogebäude dieser Größe gibt.db, So., 2015.10.11
11. Oktober 2015 Roland Pawlitschko
Unter Brüdern
(SUBTITLE) Rieglerhof in Bozen-Leifers (I)
Vor den Toren Bozens hat Martin Riegler für seinen jüngeren Bruder ein hybrides Zuhause geschaffen. Der Rieglerhof ist Familiendomizil und Wirtschaftsgebäude in einem. Außerdem zeigt sich in dem Debut des jungen Architekten eine unverkrampfte Auffassung von zeitgemäßer Architektursprache.
Was »modern« heute auch immer bedeuten mag, die Rieglerbrothers scheinen es zu sein – jedenfalls nach allem, was man so im Internet über sie herausfinden kann. Demnach gehören die Brüder Martin und Florian Riegler zu den Stars der internationalen Kletterszene. Sie unternahmen waghalsige Erstbegehungen in den Alpen, im Himalaya und in den Rocky Mountains, erhielten diverse Preise für ihre Touren und wirkten 2012 in einem Dokudrama über Reinhold Messner mit. »Always climbing« lautet der Claim, unter dem sich die jungen Draufgänger vermarkten. Cool, smart und erfolgreich: Moderner geht’s nicht. Aber zu welcher Form findet solch jugendlich unbekümmerte Modernität, wenn sie sich architektonisch ausdrückt? Das ist die spannende Frage, die einen während der Fahrt zum Rieglerhof beschäftigt. Um sie zu beantworten, muss man das Wohn- und Wirtschaftsgebäude, das Martin Riegler (35) für seinen Bruder und dessen Familie entworfen hat, freilich erst einmal finden.
Der Bozener Talkessel ist weit und eben. Hier rahmen die Berge das Bild noch, beherrschen es aber nicht mehr. Im weiten Umkreis der Autobahnausfahrt Bozen-Süd ist es die gläsern-metallene Unternehmenszentrale des Funktionsbekleidungsherstellers Salewa, die das Bild prägt; weiter geht es in Richtung Schloss Sigmundskron, das stolz auf einem Ausläufer des Mittlerbergs thront. Aber der Weg führt letztlich nicht in die Berge hinauf, sondern mitten hinein ins Reich von Gala, Pink Lady, Jazz, Fuji und Braeburn. So heißen die Apfelsorten, die auf den Plantagen am flachen Ufer der Etsch angebaut werden. Die insgesamt riesige Anbaufläche ist unterteilt in lange, schmale Streifen, und einige davon bewirtschaftet der Obstbauer und Winzer Florian Riegler. Auch sein Domizil steht auf einer dieser kleinbäuerlichen Parzellen.
Vom Berg zum Bau
Von der Straße aus sieht man den Neubau nicht, weil er von einem alten Bauernhof verdeckt wird: Martin Rieglers Elternhaus, in dem er mit Frau und Tochter wohnt und sein Architekturbüro areum betreibt. Studiert hat er in Graz und Barcelona, seine Staatsprüfung legte er 2013 in Venedig ab, der Rieglerhof ist sein Debut als Architekt. »Gleich nach dem Examen sind wir zu einer Klettertour nach Pakistan aufgebrochen, wo wir die Baupläne für das Haus meines Bruders erörtert haben«, sagt Martin, das Töchterchen Aurelia auf dem Arm. Ein moderner Vater, allem Anschein nach. Cool, smart und darüber hinaus ungemein sympathisch.
Nach der Rückkehr aus Pakistan im November habe man die letzten Äpfel gepflückt und danach die Bäume auf dem Bauplatz gefällt, erzählt er. Bereits im August 2014 konnten Florian und Juliane Riegler mit ihren Kindern Noah und Laura das neues Heim beziehen. Die Familie wohnt im OG des Gebäudes.
Im EG wird das zentral gelegene Treppenhaus von Garagen für Autos und Traktoren, Stellplätzen für landwirtschaftliche Geräte, einer Werkstatt und Lagerräumen flankiert. Die Verteilung der Funktionen hat der Architekt durch unterschiedliche Bauweisen und Materialien verdeutlicht. Der Wirtschaftshof ist ein Massivbau aus Stahlbeton, der Aufbau eine mit Lärchenbrettern bekleidete Holzrahmenkonstruktion. Der Ortbeton des Unterbaus wurde bewusst roh und rau belassen. »Putz braucht es hier nicht«, sagt Martin Riegler und ergänzt: »Was ich nicht brauche, ist hässlich.«
Form follows function
Warum er Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus übereinander gestapelt hat? Der Boden sei wertvoll, sagt er und macht eine weit ausholende Handbewegung. Überall stehen Apfelbäume. Sie drängen sich rechts und links bis an die Grundstücksgrenzen. Und den Platz hinterm Haus besetzen sie auch. Von wegen weites Land! Tatsächlich ist der Boden hier knapp. Die Sache mit dem Stapeln versteht sich so gesehen von selbst.
Auch die geometrischen Eigenheiten des Entwurfs leuchten schnell ein, weil alle formalen Entscheidungen aus funktionalen Erwägungen heraus getroffen wurden. Aus zwei Gründen hat Martin Riegler z. B. den Holzbau über den Betonbau hinaus nach Norden zurückversetzt: Auf diese Weise entstand im Norden ein dringend benötigtes Vordach, unter dem Wagen und Geräte Platz finden; im Süden ließ sich die durch die Verschiebung gewonnene Dachfläche als Terrasse nutzen. Auch die schräge Südfassade des Aufbaus ist alles andere als ein formaler Gag: Das hinter der angewinkelten Front gelegene Wohnzimmer öffnet sich mit einer raumbreiten Fensterfläche nach Sigmundskron zur Sonne.
Bürgerliches Schauspiel
Den Übergang von der Welt der Arbeit zum Reich der Familie hat der Architekt unspektakulär, aber prägnant in Szene gesetzt. Eingangsflur und Treppenhaus gehören vom Ausdruck her noch ganz zum Wirtschaftsgebäude. Unterstrichen wird der raue Charakter durch die Stahlgitterroste der zweiläufigen U-Treppe, die zum OG hinaufführt. Die hölzerne Wohnungstür markiert die Grenze. Dahinter liegt eine helle, geräumige Wohnung, die bestens auf die Bedürfnisse der vierköpfigen Familie zugeschnitten ist. Die Fensterrahmen aus Lärchenholz und ein durchgängiger Eichenboden sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Der offene Wohnbereich mit Küche, Essplatz und dem Freisitz davor bietet reichlich Platz für gemeinsame Aktivitäten. Alles stimmt, sogar die Energiebilanz und die Perspektive: Martin Riegler hat ein Klimahaus der Klasse A errichtet, dessen begrüntes Flachdach eine spätere Aufstockung des Gebäudes erlaubt. Und die Extravaganz? Soll man sich darüber beschweren, dass dem brutalistisch rauen Vorspiel im Unterbau ein eher bürgerlich braves Schauspiel auf der Wohnbühne folgt? Ach was. Das Hybride am Rieglerhof macht gerade den Reiz dieser Architektur aus. Expressiver Überschwang, zweckrationale Beherrschung und pragmatische Kompromissbereitschaft fügen sich hier zu einem adäquaten Ausdruck unserer seltsam zerrissenen Zeit. Und was soll »modern« auch anderes bedeuten als zeitgemäß?db, So., 2015.10.11
11. Oktober 2015 Klaus Meyer