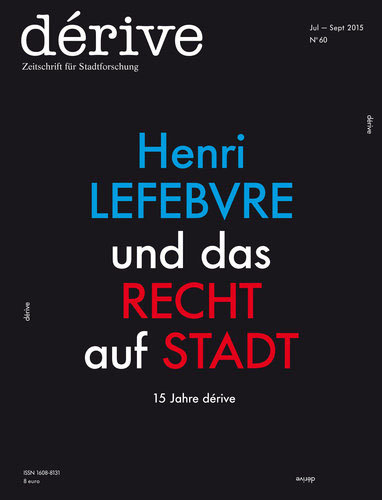Editorial
15 Jahre dérive wären ein würdiger Anlass, einen Blick zurückzuwerfen und sich die Entwicklung unserer Arbeit vor Augen zu führen. Schließlich war es ein weiter Weg von der Idee, unserem in den 1990er Jahren in einer Mini-Auflage erschienenen Fanzine, eine Edition IWI Heavy Stuff beizustellen, bis zur heutigen Zeitschrift für Stadtforschung, die internationale Anerkennung genießt und u.a. von der Bibliothek der Princeton University oder der Architectural Association in London abonniert wird.
Geblieben ist unsere Leidenschaft für die Stadt als Œuvre und die Überzeugung, dass es mehr denn je kritische Auseinandersetzung braucht. Deswegen verzichten wir an dieser Stelle auf nostalgische Rückblicke und beschäftigen uns lieber mit unseren aktuellen Projekten.
Jubiläumsausgaben verlangen nach besonderen Themen, was der Redaktion erfahrungsgemäß Kopfzerbrechen bereitet: In der 10 Jahre-Ausgabe widmeten wir uns der Stadtforschung selbst, das 50. Heft trug den Titel Straße und in dieser 60. Ausgabe stehen Henri Lefebvre und das Recht auf Stadt im Mittelpunkt. Das in den 1960ern entwickelte Recht auf Stadt genießt aufgrund der aktuellen Verhältnisse ungebrochene Aktualität und gerade in den letzten Jahren wurde vieles dazu publiziert. So gut allerdings Recht auf Stadt als Slogan funktioniert, weil er offen ist und Spielraum für Interpretationen lässt, so wenig ist – abseits der akademischen Beschäftigung – über den genaueren Zusammenhang mit Henri Lefebvre bekannt und damit über den Ursprung von Recht auf Stadt als (Auf-)Schrei und Verlangen (»comme appel, comme exigence«). Das liegt sicher auch daran, dass Lefebvres Text Le droit à la ville niemals ins Deutsche übersetzt wurde und sich sein Werk grundsätzlich einer Lektüre versperrt, die auf der Suche nach Rezepten ist.
Der Schwerpunkt Henri Lefebvre und das Recht auf Stadt präsentiert – gemeinsam mit Manfred Russos Serie zur Geschichte der Urbanität – sechs Einblicke, Interpretationen und Inspirationen zu Lefebvres Recht auf Stadt. Die Beiträge behandeln unterschiedliche Aspekte, kreuzen sich aber an bestimmten Stellen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie den umfassenden gesellschaftlichen Anspruch von Recht auf Stadt darlegen, der sich nicht in einzelnen Forderungen erschöpft.
Den Anfang macht Anne Vogelpohl, die in ihrem Beitrag die Bedeutung der Begriffe Stadt und Urbanisierung bei Lefebvre erklärt, deren Verständnis für Recht auf Stadt grundlegend ist. Darüber hinaus erläutert sie den Begriff des Wohnens, der bei Lefebvre »eine spezifische Form des Zusammenlebens in der Stadt und des Alltagslebens insgesamt« einschließt.
Andy Merrifield, der 2006 eine sehr lesenswerte und kritische Einführung in Lefebvres Gesamtwerk (Henri Lefebvre: A Critical Introduction) veröffentlicht hat, nimmt Lefebvres Satz »The right to the city implies nothing less than a revolutionary conception of citizenship« als Ausgangspunkt, um darüber zu philosophieren, was diese citizenship heute bedeuten könnte.
Klaus Ronneberger, dérive-LeserInnen und urbanize!-Festival-BesucherInnen im Zusammenhang mit Lefebvre wohl bekannt, legt in seinem Text die gesellschaftliche Situation im Nachkriegsfrankreich dar, in der Lefebvre – der lange Jahre als Agrarsoziologe tätig war – begann, über das Urbane zu forschen und nachzudenken. Lefebvres Forderung nach einem Recht auf Zentralität steht damit in unmittelbarem Zusammenhang. Von Klaus Ronneberger ist jüngst der sehr empfehlenswerte Essay Peripherie und Ungleichzeitigkeit erschienen, der Lefebvre gemeinsam mit Pier Paolo Pasolini und Jacques Tati als Kritiker des fordistischen Alltags analysiert.
Christian Schmid, dessen Lefebvre-Buch Stadt, Raum und Gesellschaft all jenen wärmstens ans Herz gelegt sei, welche die Zusammenhänge von Lefebvres Denken verstehen lernen wollen, zeichnet die unterschiedlichen Phasen der Rezeption von Lefebvres Werk nach und zeigt wie es für die gegenwärtige Stadtforschung fruchtbar gemacht werden kann, während Mark Purcell Recht auf Stadt verwendet, um über die Potenziale und Bedeutung von Demokratie nachzudenken.
Manfred Russo schließlich erklärt Lefebvres Bezugnahme auf die Pariser Commune, die Rolle der Efferveszenz und Lefebvres wunderbarer These von der Stadt als Œuvre.
Jan Zychlinskis Portrait von Jerewan ergänzt den Schwerpunkt um einen exemplarischen Einblick in die harte Realität von Kämpfen um das Recht auf Stadt: Unter dem Titel Is it a beginning …? zeigt er die zerstörerische städtische Machtpolitik in der armenischen Hauptstadt und portraitiert eine Initiative, die dagegen ankämpft.
Das Kunstinsert Geraldton goes Wajarri von Pia Lanzinger macht auf die verschwindenden Sprachen der Aboriginal in Westaustralien aufmerksam und will das Bewusstsein für kulturellen Reichtum stärken. Auch hier könnte man mit Recht auf Differenz einen Bezug zu Lefebvre herstellen – aber irgendwann reicht es dann auch wieder.
Wovon wir aber gar nicht genug bekommen können, sind ihre Rückmeldungen zu dérive: Wir wünschen uns zum Jubiläum Lob, Kritik und Geschichten: Warum lesen Sie dérive? Was bringt Ihnen die Lektüre? Was freut, was nervt? In welchem Kontext haben Sie Bekanntschaft mit dérive geschlossen? Hat dérive ihr Denken und Schaffen beeinflusst, zu Aktionen, Interventionen, Publikationen, Forschungen angeregt? Was verbinden Sie mit der Zeitschrift für Stadtforschung? Wortspenden werden unter jubel@derive.at dankend entgegen genommen.
Ach ja – falls Sie es noch nicht wissen: Von 2. – 11. Oktober steigt zum 6. Mal unser urbanize!-Festival. Unter dem Motto Do It Together eröffnen wir ein Labor für kollaborativen Urbanismus, erproben Alternativen des Zusammen und hinterfragen Chancen und Fallstricke gemeinsamer Stadtproduktion. Rege Beteiligung ist herzlichst erwünscht!
Bis dahin einen extra-feinen Sommer; nehmen Sie sich ihr Recht auf Stadt.
Christoph Laimer und Elke Rauth