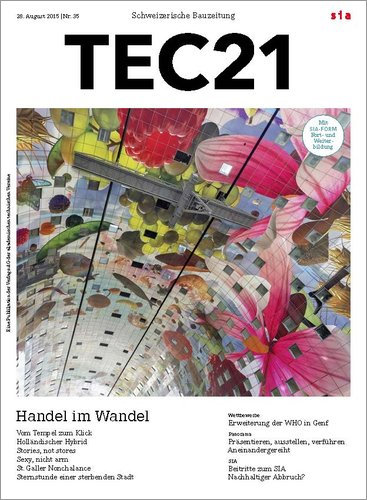Editorial
Shoppen ist unsere Freizeitbeschäftigung Nr. 1. Samstag für Samstag füllen sich die Innenstädte und Einkaufszentren mit Konsumwilligen – trotz der aktuellen Frankenstärke auch (noch) in der Schweiz.
Wer sich vergangenen Juli auf dem dreijährlich stattfindenden Branchentreff, der Düsseldorfer Messe EuroShop, umhörte, erfuhr allerdings, dass die Branche vor einem Paradigmenwechsel stehe: Der Onlinehandel mit seinem grenzüberschreitenden Auftritt und den vergleichsweise niedrigen Fixkosten macht dem traditionellen Detailhandel schwer zu schaffen. In China kauft bereits heute jeder zweite Konsument seine Lebensmittel nur noch online ein. Das auch hierzulande bekannte Phänomen bedingt weitläufige Lagerflächen, mit Vorliebe an der Peripherie. Welche Auswirkungen hat das für Innenstädte und Verkehr?
Fakt ist, die neuen Technologien machen auch Angst: Die Konkurrenz wird global, der Preisdruck steigt.
Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten: Auch die Kundschaft kann weltweit angesprochen werden. Und mit der Verknüpfung von analogem Verkauf (Beratung, Haptik, Erlebnis) und digitalen Technologien (Information, Vergleich, Verfügbarkeit) lässt sich das Beste aus beiden Welten zu einem interessanten Mix verknüpfen. Im Idealfall entsteht ein Mehrwert – für Anbieter und Konsumenten, aber auch für die Städte. Dieses Heft stellt einige Lösungsansätze vor.
Tina Cieslik