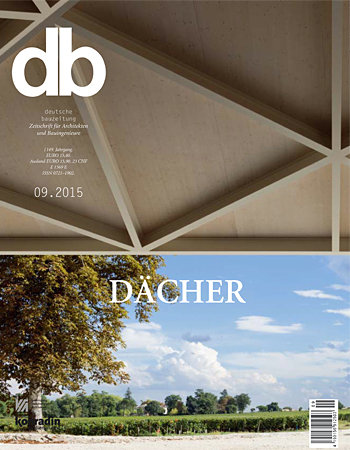Editorial
Die vorrangige Aufgabe, die ein Dach zu erfüllen hat, ist, die Trockenheit des darunter liegenden Raums zu gewährleisten. Geneigte wie flache Dachkonstruktionen funktionieren jedoch nur bei sorgfältiger Detaillierung und Ausführung. Die Abhängigkeit zwischen Deckungsmaterial und Mindestneigung hat sich über die Jahre zunehmend verringert, was – wenn auch nicht immer gelungen eingesetzt – die Gestaltungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Auch die endlose Diskussion, ob ein Flachdach überhaupt zuverlässig abgedichtet werden könne, gehört nun allmählich der Vergangenheit an, da Bautechnik und Materialien entsprechend weiterentwickelt wurden. In dieser Ausgabe betrachten wir Projekte, deren Typologie, Materialeinsatz und Detaillierung die Möglichkeiten des Bauteils Dach in gelungener Weise interpretieren und ausschöpfen. | Martin Höchst
Edles Dach für edlen Tropfen
(SUBTITLE) Kellereigebäude in Margaux (F)
Eine feingliedrige Stahlkonstruktion mit zwölf organisch geformten Baumstützen trägt das Ziegeldach des neuen Kellereigebäudes auf dem Weingut Château Margaux. Ebenso ästhetisch überzeugend und mit Liebe zum Detail durchgeplant zeigt sich der darunter liegende Quader, der jene zurückhaltende Noblesse ausstrahlt, die seit Hunderten von Jahren auch die Weine der Kellerei prägt.
Rund um den kleinen Ort Margaux, 30 km nördlich von Bordeaux mitten im Haut-Médoc, reichen die Weinreben in allen Himmelsrichtungen bis an den Horizont. Unterbrochen wird das grüne Blättermeer lediglich von vereinzelten Waldstücken und prachtvollen alten Châteaus, die von einer lange währenden Weinbautradition zeugen. Das Weingut Château Margaux zählt zu den weltweit renommiertesten und trägt aufgrund der herausragenden Qualität seiner Weine seit 1855 den Titel »Premier Grand Cru Classé«. Wie begehrt selbst die relativ jungen, nach eigenen Angaben aber bisweilen mehr als 100 Jahre lagerfähigen Rotweine sind, zeigt eine im Oktober 2013 für 195 000 Dollar verkaufte 12-Liter-Flasche »Balthazar 2009«.
Die heutige bauliche Form des gut 500 Jahre alten Weinguts entstand um 1815 und blieb seitdem nahezu unverändert: im Wesentlichen prägen das klassizistische Hauptgebäude, die südlich darum herum gruppierten Wirtschaftstrakte sowie die in einem weitläufigen Park situierte Orangerie das Bild. Ergänzt wurde vor 30 Jahren lediglich ein neuer unterirdischer Weinkeller für die Eichenfässer der drei hier erzeugten Rotweine. In den drei Qualitätsabstufungen »Château Margaux«, »Pavillon Rouge du Château Margaux« und »Margaux du Château Margaux« werden jährlich insgesamt 285 000 Flaschen abgefüllt. Weißweine werden im Vergleich hierzu in wesentlich geringerem Umfang erzeugt. ›
Behutsam neustrukturiert
Um das teilweise unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble und die Weinproduktion besser an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts anpassen und dadurch die besondere Güte des Weinguts festigen zu können, entschied sich die Eigentümerin, Corinne Mentzelopoulos, im Jahr 2009 für eine umfassende und doch sehr behutsame Neustrukturierung. Persönliche Kontakte führten schließlich zur Direktbeauftragung von Sir Norman Foster, der sich die Konzeption und bauliche Umsetzung eines entsprechenden Masterplans zur eigenen Aufgabe machte – zahlreiche seiner Skizzen, Pläne und Arbeitsmodelle sind nun in einem Besucherbereich zu besichtigen. Ziel war die Renovierung und Modernisierung der eingeschossigen Wirtschaftsgebäude und der Orangerie, aber auch der Umzug der bestehenden Vinothek in einen unterirdischen Neubau. Die mit Abstand wichtigste Baumaßnahme bildete jedoch die Errichtung eines neuen Kellereigebäudes (Nouveau Chai), dem ersten und bislang auch einzigen oberirdischen Neubau seit 200 Jahren. Hier sollte insbesondere die auf mehrere Geländestandorte verteilte Produktion der 12 000 Flaschen Weißwein »Pavillon Blanc du Château Margaux« zusammengeführt werden. Darüber hinaus waren noch ein ebenerdiger Weinkeller, ein Forschungslabor, ein intern genutzter Verkostungsbereich sowie das Büro des Kellermeisters unterzubringen.
So wie Corinne Mentzelopoulos den Kellermeister dazu anhält, durch die perfekte Zusammensetzung der vier separat vinifizierten Rebsorten (Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot und Cabernet Franc) jedes Jahr aufs Neue großartige und lang lagerfähige Rotweine zu komponieren, so erwartete sie von Foster einen Entwurf, der funktional und ästhetisch auch in Jahrzehnten noch Bestand haben würde. Hinzu kam der Wunsch nach einer Architektur, die sich zurückhaltend, aber selbstbewusst in das historische Gebäudeensemble einfügt und sich zugleich flexibel an leicht veränderte Nutzungen anpassen lässt. Weitreichende Umstrukturierungen – wie z. B. die Vervielfachung der Lagerkapazitäten oder gar weitere Ergänzungsbauten – standen dabei zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, da sich das Weingut seit jeher nicht für Expansion, sondern eher für die Optimierung des Status quo interessiert.
Markthalle
Dank des einfachen Walmdachs mit farblich unregelmäßiger Deckung aus neuen und gebrauchten Mönch- und Nonnenziegeln und der sorgfältigen Bezugnahme auf die Firsthöhen der Altbauten, harmoniert das direkt neben dem Wirtschaftstrakt als Solitär platzierte neue Kellereigebäude ganz selbstverständlich mit der bestehenden Dachlandschaft. Dennoch wird auf den ersten Blick deutlich, dass es darüber hinaus keinerlei bauliche Verwandtschaften gibt. So ist sofort klar erkennbar, dass das aus großer Entfernung noch eher schwer wirkende Dach nicht auf einem Massivbau ruht, sondern von im Verhältnis absurd schlank aussehenden Baumstützen emporgehoben wird. Je weiter man sich dem Neubau nähert, desto deutlicher wird, dass die Dachflächen kein abgeschlossenes DG umschließen. Vielmehr legen sie sich als dünne Schicht über einen abgeschlossenen Hallenraum, der sich – umgeben von einer Holz-Stahl-Fassade mit darüber liegender Glaswand – wie die Cella eines griechischen Tempels zwischen den im Freien platzierten Baumstützen befindet. In dieser umlaufenden Freifläche werden zur Erntezeit Trauben zwischengelagert, gepresst, gefiltert und der Traubensaft zur Abfüllung in die innenliegenden Edelstahltanks vorbereitet. Dass diese Raumkonfiguration an eine Markthalle erinnert, unter deren Dach sich die Nutzungen frei anordnen lassen, ist kein Zufall: Der Gebäudetypus war eine der Inspirationsquellen für Fosters Entwurf – in Bezug auf Erscheinungsbild und Flexibilität, aber auch hinsichtlich der eleganten Konstruktion.
Wie aus einem Guss
Dass die – unterhalb der Dachuntersicht aus weiß lasierten Sperrholzplatten offen sichtbare – Stahlkonstruktion so grazil erscheint, liegt v. a. daran, dass die im Querschnitt rautenförmigen »Stämme« der zwölf identischen Baumstützen trotz des komplexen Verbindungsknotens vollkommen nahtlos in die I-Profile der jeweils vier »Äste« übergehen. So wirkt der gesamte Stahlbau wie aus einem Guss. Um diesen Effekt zu erreichen, verwendeten die Stahlbauer für die Äste keine herkömmlichen Walzprofile, sondern unterschiedlich große, unterschiedlich dicke und unterschiedlich gebogene Stahlbleche, die nach Vorgabe eines eigens erstellten 3D-Modells passgenau zusammengeschweißt wurden. Die Herausforderung lag dabei keineswegs nur in der Herstellung der einzelnen Formstücke, sondern auch in der Zugänglichkeit und Präzision der Schweißnähte sowie in der Verwendung der je nach Lage und statischen Anforderungen unterschiedlichen Blechdicken. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Innere der Stützen nicht einfach nur hohl, sondern voller aussteifender Stegplatten ist, und dass die Äste – anders als gewöhnliche I-Profile – über zwei Stege und einen in der Mitte liegenden Hohlraum verfügen.
Das Schneiden und Biegen der Bleche erfolgte unter geschützten Bedingungen in einer Werkstatt im tschechischen Pilsen, wo die gesamte Tragkonstruktion – auf dem Kopf liegend – vormontiert, mithilfe von Schablonen geschliffen und nachgefräst, anschließend gespachtelt und dann in Hellbeige deckbeschichtet wurde. Danach zerlegten die Stahlbauer das Ganze in kleinere Segmente, die schließlich per Lastwagen nach Margaux gelangten. Dort wurden die Teile fest verschweißt, die Nahtstellen ausgebessert und die ganze Konstruktion mit einer finalen Farbschicht überzogen – da es keine Brandschutzanforderungen gab, konnte auf unschöne Schutzanstriche verzichtet werden.
Sein statt Schein
Wie bei der Dachkonstruktion so ist auch jedes Detail des Innenraums von großer Sorgfalt geprägt. Im vorderen, nicht klimatisierten Südteil befinden sich jene linear aufgereihten Edelstahltanks, in denen der Traubensaft zur ersten Reifung eingefüllt wird. Von hier führt eine filigrane, geschwungene Edelstahlwendeltreppe nach oben auf einen Gitterrost über den Tanks bzw. auf die Fläche über Forschungslabor und Weinkeller, wo der vorvergorene Traubensaft in Eichenfässern zum Wein reift. Während das EG eher von antiseptischer Sauberkeit und weitgehend geschlossenen Außenwänden geprägt ist, bietet das OG des hinteren Bereichs flächenbündige Einbaumöbel und Böden in warmen Holztönen sowie fantastische Ausblicke auf die umliegenden Weinberge. Hier liegt, direkt unter dreieckigen Oberlichtern, der lichtdurchflutete Verkostungsbereich, in dem die jungen Weine beurteilt und deren spätere Zusammensetzungen festgelegt werden.
So gut sich die nördlich anschließende Terrasse, der sowohl der Park als auch das Hauptgebäude zu Füßen liegen, für rauschend Feste und eindrucksvolle Erinnerungsfotos eignen würde – für Besucher und Publikumsverkehr ist dieser Bereich tabu. Führungen (z. B. durch Weinkeller, Vinothek und auch das EG des neuen Kellereigebäudes) sind zwar grundsätzlich möglich, jedoch nur wochentags, nur in Kleingruppen und nur nach vorheriger Anmeldung. Im Gegensatz zu dem, was die Gäste von vielen anderen Weingütern der Region an Eventkultur und Architekturspektakel rund um das Thema Wein geboten bekommen, ist das Angebot des Château Margaux eher klein – hinzu kommt, dass Wein nicht hier, sondern ausschließlich bei ausgesuchten Weinhändlern gekauft werden kann. Der extravagant auf das Wesentliche reduzierte und dezidiert zeitgenössische Neubau fügt sich vielleicht gerade deshalb so gut in das historische Gebäudeensemble ein, weil er nichts anderes darstellen muss, als das, worum es hier im innersten Kern geht: die Fortsetzung einer von großer Sorgfalt und hoher Qualität geprägten Tradition der Weinherstellung.db, Di., 2015.09.01
01. September 2015 Roland Pawlitschko
Geometrische Landschaft
(SUBTITLE) Kindergarten in Lugano (CH)
Die von den Nachbargebäuden ringsum gut sichtbare Dachaufsicht des Kindergartens in Lugano zeigt sich konsequent detailliert. Die Architekten schenkten ihr ebenso viel Aufmerksamkeit wie den anderen gut durchdachten Komponenten des Modulholzbaus. So konnte das Konzept einer »kleinen Stadt in der Stadt« mit wohldosiert anregenden Innen- wie Außenräumen gelingen.
Auf dem Weg von Norden über den Gotthard ins Tessin passiert man in Pollegio, umgeben von Alpengipfeln und Verkehrsbauten auch das Eisenbahnstellwerk »AlpTransit« (2014) der Architekten Bruno Fioretti Marquez aus Berlin. Die gelungene Einbettung dieser skulpturalen Landmarke in die unwirkliche Szenerie weckt bereits hohe Erwartungen an das ganz anders geartete Bauwerk eines fünfgruppigen Kindergartens derselben Planer im städtischen Kontext von Lugano.
In der größten Stadt des Tessins vor der imposanten Bergkulisse angekommen, ist die genussvolle Lebensart des nahen Italiens in den Straßen der Innenstadt überall präsent. Neben touristischer Attraktivität strahlt Lugano als drittgrößter Bankenstandort der Schweiz, nach Zürich und Genf, sowie als Universitätsstadt auch eine Atmosphäre geschäftigen Treibens aus.
Östlich des historischen Zentrums schließt sich der Stadtteil Cassarate an. Geprägt von großmaßstäblichen Wohnungsbauten aus den 30er bis 70er Jahren, macht die Nähe zum Ufer des Luganer Sees das Viertel als Wohnstandort attraktiv und teuer. Und so wird hier an jeder Stelle das Vermarktungspotenzial ausgeschöpft und nachverdichtet. Der öffentliche Raum im Viertel beschränkt sich zumeist auf die großzügig angelegten Straßen. Vor diesem Hintergrund überrascht der neue Stadtbaustein des Kindergartens der Architekten Bruno Fioretti Marquez zwischen bestehender Grundschule und Sporthalle mit seiner weitgehend eingeschossigen Bauweise umso mehr. Die Architekten gewannen 2007 den Wettbewerb v. a. auch wegen der städtebaulichen Qualität ihres Entwurfs, der mit seinem niedrigen und großflächigen Bauvolumen sowohl stadträumlich wirksame Kanten schafft als auch in seiner kindgerechten Maßstäblichkeit auf die Hauptnutzer eingeht. Vor Ort lässt sich dies am fast unverändert realisierten Wettbewerbsentwurf, der anstelle eines maroden Vorgängergebäudes entstand, gut nachvollziehen.
In die neue Großform sind umschlossene Höfe integriert, die den fünf Gruppen des Kindergartens jeweils als geschützter Außenraum dienen. Weitere, das Gebäude flankierende Freiflächen sind eingezäunt jedoch über Tore zu entkoppeln und so wahlweise auch öffentlich zugänglich. Sowohl das neue fußläufige Wegesystem zwischen den Gebäuden und den Freiräumen als auch der befestigte Vorplatz von Schule und Kindergarten laden mit ihrer schlichten und wertigen Gestaltung die Quartiersbewohner zur Aneignung ein.
Holz in Bewegung
Im steinernen städtischen Kontext nimmt die Holzfassade des Neubaus eine Sonderstellung ein. Zu deren Unverwechselbarkeit trägt sowohl die vertikale Faltung als auch die ringsum an- und absteigende Oberkante bei. Dies wirkt am Standort in keiner Weise deplatziert, vielmehr strahlt die Gebäudehülle dank präziser Detaillierung und angenehmer Proportionen eine hohe Wertigkeit aus. Ein steinerner Sockel hebt das Gebäude über das Straßenniveau und unterstreicht die seiner Nutzung angemessene Solidität. Die Verwendung von Holz geht bei dem Neubau über die Bekleidung der Fassaden mit profilierten Brettern aus Thermoaspe hinaus: Beim Blick aus einer der oberen Etagen der benachbarten Grundschule wird deutlich, dass sich sowohl die Bewegtheit als auch die Materialität der Fassaden auf dem Dach fortsetzen. Trapezförmige Holzroste (Thermoesche) werden von Betonauflagern auf Abstand zu den foliengedichteten und trittfest gedämmten Dachflächen darunter gehalten und zeichnen diese nach. Aufsteigend und wieder abfallend formen die Roste Grate oder Kehlen und gleichen in ihrer Gesamtheit einer bewegten geometrischen Landschaft. Diese ist als attraktive fünfte Fassade von den mehrgeschossigen Häusern ringsum gut zu sehen und betont durch die Verwendung des Fassadenmaterials das Volumen des Gebäudes. Die Fugen zwischen den hölzernen Dachelementen verweisen indes auf den additiven Charakter der Gebäudekonstruktion in Holzmodulbauweise. Ein hohes Maß an Vorfertigung war nötig, um die Bauarbeiten im laufenden Betrieb des Vorgängerbaus kurz zu halten. Der so entstandene Neubau wurde in einem zweiten Bauabschnitt nach Abriss des Altbaus mit den Räumlichkeiten für zwei weitere Gruppen ergänzt und damit vervollständigt.
Konische Addition
Ein trapezförmiges, geschosshohes Raummodul mit geneigter Dachfläche diente als Entwurfsbaustein. Es wurde geometrisch untersucht und die zahlreich daraus entwickelten Varianten schließlich aus Brettsperrholz CNC-gefräst. Weitgehend vorgefertigt fand schließlich deren Fügung in einem Geviert von sieben auf acht Modulen zusammen. Dadurch ergibt sich typologisch ein Kindergarten, der beinahe gänzlich ohne reine Erschließungsflächen auskommt. Lediglich der Treppenraum zu den Personalräumen im OG neben dem Haupteingang hat keine weitere Nutzung.
Die fünf Gruppenräume mit ihren Nebenräumen sind in unterschiedlichen Grundrissanordnungen innerhalb jeweils fünf trapezförmigen Modulen organisiert und einem der eingeschnittenen Höfe zugeordnet. Weitere Module sind mit Küche, Verwaltung und zwei Bewegungsräumen belegt. Die zentrale Erschließung erfolgt über einen Eingangshof und eine zentrale, überdachte aber unbeheizte Raumspange, die als gemeinschaftlicher Spielbereich dient, aber auch für Quartiersveranstaltungen zur Verfügung steht. Hier wie in den angelagerten Höfen findet sich die Holzbekleidung der zur Stadt gewandten Fassade wieder. Entlang der internen Freiflächen wirkt sie in ihrer Überlagerung und in Kombination mit den zahllosen Durchblicken wie eine Abfolge kleiner Stadtausschnitte. Ob beim Blick in die Höfe mit Pflanztrögen und unterschiedlichen Obstbäumen oder in die benachbarten Räume und von da wiederum bis in den Straßenraum oder aber über eine bewegte Dachsilhouette hinweg bis zu den Bergen, beim Gang durch die kleine Stadt lassen sich immer wieder neue Details entdecken, und sicherlich auch beim Spielen.
Über und Unter dem Horizont
Wie bei der Gebäudehülle, so haben sich die Architekten auch bei den Innenräumen für ein äußerst konsequentes Oberflächenkonzept entschieden, um die sich weitenden und verjüngenden Raumkonstellationen in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu rücken. Ihnen gelingt dies, indem sie die außen gedämmten raumbildenden Holzmodule sowie die in unterschiedliche Richtungen geneigten Deckenuntersichten mit den schlanken Trägern (60 x 400 mm) sichtbar belassen. Eine gebrochen weiße Lasur lässt zudem das Brettschichtholz homogen wirken. Zwischen den Trägern sorgen sowohl unauffällig platzierte, lange Dachverglasungen für Tageslicht als auch dezente stabförmige Leuchten für Kunstlicht. In gut zwei Metern Höhe verläuft entlang sämtlicher Wände in allen Räumen ein »Horizont« in Form einer Fuge bzw. Kante. Sämtliche Öffnungen, Türblätter, Fensterlaibungen, Akustikpaneele usw. wurden mit hohem Aufwand detailliert, um sie mit dieser gemeinsamen Oberkante auszustatten. Das hat sich gelohnt, in der heiteren räumlichen Bewegtheit sorgt der Horizont für das nötige Maß an Halt und Ruhe. Die stärker strapazierten Oberflächen des unteren Bereichs wurden zudem mehrfach lasiert, »...die kann man bei Bedarf wieder neu streichen«, erläutert Architekt Piero Bruno ganz entspannt.
Um im Holzgebäude kein »Barackenklima« aufkommen zu lassen, mildert die Speichermasse des steinernen Sockels Temperaturspitzen. Wie schon der Zementestrich im Außenbereich, so zeigen sich auch bei den Innenräumen die Böden mineralisch, sind jedoch mit einem etwas weicheren Belag aus »Hartsteinholz« ausgestattet. Mehrere dezentral angeordnete Wärmepumpen zur Versorgung der Fußbodenheizung sowie eine kontrollierte Lüftung lassen das Gebäude den Minergie P Standard erreichen. Dies kann jedoch am hochsommerlichen Tag des Besuchs nicht verhindern, dass es recht warm im Gebäude wird – trotz des automatisch gesteuerten textilen innenliegenden Sonnenschutzes der Dachverglasungen und den außenliegenden Fensterstoren. Der Kindergarten macht alljährlich allerdings eine ausgedehnte Sommerpause und so müssen die kleinen Nutzer wohl nicht zu sehr schwitzen ...
Die Erwartungen, die sich beim Anblick des Stellwerks in den Bergen von Bruno Fioretti Marquez an den Kindergarten in Lugano aufgebaut hatten, waren zwar hoch, wurden vor Ort jedoch keineswegs enttäuscht. Wie in Pollegio beweisen die Planer auch am Luganer See ihre Stärke, indem sie das Wesen der Bauaufgabe und des Orts mit unnachgiebiger Konsequenz abgleichen. So kann daraus etwas eigenständiges entstehen, dass dem Kontext standhält und ihm sogar zu einer neuen Lesart verhilft. Dass ein Gestaltungskonzept dabei derart kompromisslos umgesetzt wird – einschließlich der anspruchsvollen Gestaltung einer Dachaufsicht – dazu braucht es einen willigen Bauherrn und sehr viel Engagement der Planer.db, Di., 2015.09.01
01. September 2015 Bruno Fioretti Marquez
Ausflug aufs Museumsdach
(SUBTITLE) Moesgaard Museum in Aarhus (DK)
Das Moesgaard Museum für Archäologie und Ethnologie ist ein markantes und dennoch eher unauffälliges Gebäude. Dazu trägt besonders das begehbare und begrünte Dach bei, das im Sommer zum Picknick und im Winter zum Rodeln einlädt.
Die Landschaft in Højbjerg südlich von Aarhus – der dänischen Hafenstadt an der Ostsee – ist bergiger als man es vermuten würde. Mit der Geländeformation der norddeutschen Tiefebene ist sie jedenfalls nicht zu vergleichen. Was bei dem einen oder anderen Radfahrer vielleicht zu Irritationen führt, mag Spaziergängern und Wanderern besonders reizvoll erscheinen. Schließlich ergeben sich schöne Blicke aufs Meer und die hier noch vorzufindende Mischung aus Wiesen, Wäldern, landwirtschaftlich genutzten Flächen und Alleen. Seine landschaftlichen Reize machen das Gebiet um das Landgut Moesgaard mit dem barocken Park und der engen Verbindung zum Ostseestrand zu einem Ausflugsziel par excellence. Der historische Gebäudekomplex diente bislang als Museum und Forschungsinstitut. Diese Funktionen hat im Wesentlichen nun der Neubau übernommen. Das Gut bleibt aber weiterhin Forschungs- und v. a. Lehreinrichtung.
2005 konnten Henning Larsen Architekten mit der Landschaftsarchitektin Kristine Jensens den Wettbewerb für das neue Museum gegen große internationale Konkurrenz – darunter die Büros von Snøhetta und Tadao Ando – für sich entscheiden. Ihre Ortskenntnis mag ein Vorteil gewesen sein, denn der sensible Umgang mit der Landschaft war eine der Hauptvorgaben. Der Bau sollte die Attraktivität der Landschaft steigern, nicht schmälern. Henning Larsens architektonisches Konzept zielte deshalb darauf ab, das Museum weitgehend einzugraben. Das hat zudem energetische Vorteile, da so dessen starken Temperaturschwankungen ausgesetzte Außenflächen minimiert werden. Durch die Neigung nach Südosten sowohl des Geländes als auch des Dachs, ergibt sich ein nur geringer solarer Energieeintrag. Außerdem wollte das Museum für seine Ausstellungen aus konservatorischen Gründen auf Tageslicht verzichten. Das tragende Stahlbetondach wurde mit einem intensiven Gründachaufbau von fast 70 cm - inklusive Dämmung - versehen, mit einer Mischung aus Gräsern und Mosen begrünt und konnte so der Wiese zurückgegeben werden. Diese Art der Zurückhaltung führt aber keineswegs zum Verschwinden der Architektur. Im Gegenteil: Das Dach ist um über 10 m aus dem Erdreich herausgehoben. Die Nordwestfassade macht die Größe der Baumasse mit ihren fast 16 000 m² Nutzfläche deutlich. Doch von Südosten gesehen relativiert die aus der Landschaft beinahe ansatzlos ansteigende Dachfläche diesen Eindruck. Bis zum höchsten Punkt begehbar, ergeben sich so vom Dach des Museums wunderbare Ausblicke in die Landschaft, aufs Meer und die Insel Samsø. Auf dem Technikraum für die Aufzugsanlage über dem Treppenhaus ist deshalb auch eine Art Aussichtsplattform eingerichtet worden. An einigen Stellen sind Terrassen in das Dach eingeschnitten, die aus den Büros der Museumsmitarbeiter zugänglich sind. Die zentrale Terrasse gehört aber zum Restaurant, das so gleichzeitig zum Ausflugslokal wird.
Unter einem Dach
Das Dach schützt also nicht nur die Schätze archäologischer Forschung, es bereichert auch das Freizeitangebot der Gegend und lockt zusätzliche Gäste in die Museumsgastronomie. Dem Museum sind diese Gäste hoch willkommen, weil ganz nebenbei Schwellenängste gesenkt werden. Das Museumspersonal öffnet an Regentagen die eigentlich für Schulklassen vorgesehenen Aufenthaltsräume auch für das Picknick der Wanderer.
Das Restaurant liegt auf der Eingangsebene und ist auch vom Foyer aus zugänglich, das im Kern des keilförmigen Gebäudes liegt. Es bietet Überblick über den Eingang, den Kassentresen, den Museumsshop und das Restaurant sowie über die drei Ausstellungsflächen. Diese sind über die große »Treppe der Evolution« erschlossen, die auf der Foyerebene und im OG in Wechselausstellungen und im UG in die Dauerausstellungen führt. Gerade dieser offene Verteilerbereich verschafft dem Gebäude Transparenz und Großzügigkeit. Vollflächig verglaste Fassaden – begleitet von durchgängig detaillierten Deckenuntersichten drinnen wie draußen – stellen hier stets den Bezug zur Umgebung her. Von dieser freundlichen Atmosphäre umfangen tritt man dann den Auf- bzw. Abstieg in die Ausstellungsräume an. Auch dies trägt dazu bei, potenzielle Vorbehalte gegenüber dem Besuch eines Museums für Archäologie und Ethnologie zu mindern. Die massive Außenwirkung, die v. a. das große Dach mit seinen mächtigen Sichtbetonbrüstungen aber auch die tragenden Elemente der Stahlbetonkonstruktion im Innern vermitteln, wird dadurch geschickt konterkariert.
Ausstellungsbegleiter
Die einladende Geste der Architektur stärkt das intelligente Ausstellungsdesign, das von hausinternen Gestaltern entwickelt und gepflegt wird. Davon ist im Eingangsbereich nur die »Treppe der Evolution« zu sehen, die mit täuschend echten Wachsfiguren die Geschichte der Menschheit erzählt. Fernglasähnliche Projektionsgeräte versetzen die Figuren illustrativ in ihre historische Umgebung und wieder in das Museum zurück. Manche jüngere Besucher haben die Figuren so ins Herz geschlossen, dass sie sie spontan umarmen oder ihnen die Haare flechten. Das ist zwar nicht ganz im Sinne der Museumspädagogik, zeigt aber, dass das Konzept Anknüpfungspunkte zur präsentierten Geschichte bietet. Die Figuren weisen die Besucher dezent auf die Welt hin, die sie auf den Ausstellungsflächen im UG erwartet. Hier herrscht dann dunkle Abgeschiedenheit, die die bedeutsamen Funde – immerhin drei gut erhaltene Leichen aus der Bronzezeit und den »Grauballe Mann«, eine Moorleiche aus der Eisenzeit – konserviert und die Konzentration der Besucher erhöht. In der Ausstellung über das Leben der Wikinger in Aros (dem frühmittelalterlichen Aarhus) helfen Protagonisten des Zeitgeschehens als Wachsfiguren, die die Besucher als virtuelle Begleiter auswählen können, um die historischen Lebenswelten besser zu verstehen. Auch diese Figuren sind so lebensecht nachgebildet, dass man sich vor Verwechselungen hüten muss. Die Ausstellungen sind anregend und durch den Einsatz unterschiedlicher und vielfältiger Medien sinnlich so intensiv erfahrbar. Das lässt einen mit der Zeit trotz aller Bgeisterung ermüden. Aber auch hierfür haben Ausstellungsmacher und Architekten vorgesorgt. Aus allen Ausstellungsbereichen sind Pausenräume zu erreichen, die einen angenehmen Wechsel zum Tageslicht und wunderbare Ausblicke in die Umgebung ermöglichen. Sie sind mit Sesseln und Sofas ausgestattet, sodass sich herrlich pausieren lässt.
Schlüsselelement
Auch wenn das große Gründach wie ein Wikingerschild über dem Moesgaard Museum liegt, vermittelt es keine abwehrende Haltung. Im Gegenteil: Das Foyer ist transparent, hell und übersichtlich gestaltet und der Außenraum fast überall präsent und wenn das kontemplative Dunkel der Ausstellungsräume zu intensiv wird, bieten die Pausenräume Rückzugsorte.
Das Museum ist durch seine Verschränkung mit der Landschaft zu einer komplexen Freizeiteinrichtung geworden, von der die Kultur, aber auch die Natur profitieren. Man könnte fast vergessen, dass es sich auch um einen Arbeitsplatz handelt. Insgesamt arbeiten etwa 200 Angestellte hier und auf dem angrenzenden Gut. Sie betreiben archäologische oder ethnologische Forschungen in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Universität, verwalten die Sammlung und pflegen oder bereiten die Ausstellungen vor. Im Haus werden also auch Büroarbeitsplätze, Studios und Werkstätten benötigt. Diese Räume sind im nordwestlich gelegenen Bereich mit großen Fensterfronten untergebracht. In diesem Bereich des Gebäudes finden sich auch Konferenz- und Tagungsbereiche sowie Gästewohnungen, die sogar von der Dänischen Königin genutzt werden, wenn sie Moesgaard besucht.
Museum plus
Das Moesgard Museum ist eine klassische Forschungs- und Bildungseinrichtung, ein Institut, das auf höchstem Niveau sammelt, forscht und Wissen vermittelt. Die Architektur des neuen Hauses trägt ihren Teil dazu bei, indem sie den Besuchern zu einer guten und intensiven Raumerfahrung verhilft und ihnen Orientierung gibt. Das Raum- und Nutzungskonzept ist aus einer vorausschauenden Analyse heraus entwickelt worden, deren Annahmen offensichtlich zutreffen: Die Besucher stehen schon vor Eröffnung Schlange, kommen von weit her oder einfach zum Picknick auf dem Dach vorbei. Die Architektur ist eine gut funktionierende räumliche Dienstleistung geworden, auch im Hinblick auf die sinnliche Wahrnehmung der Umgebung. Bei allem Erfolg spielt das Dach eine Schlüsselrolle: Es schützt nicht nur vor dem Unbill des Klimas, es eröffnet ungewohnte Perspektiven auf Natur und Kultur zugleich. Man steht im wahrsten Sinne über den Dingen und kann dabei den weiten Ausblick genießen.db, Di., 2015.09.01
01. September 2015 Olaf Bartels
verknüpfte Bauwerke
Moesgaard Museum