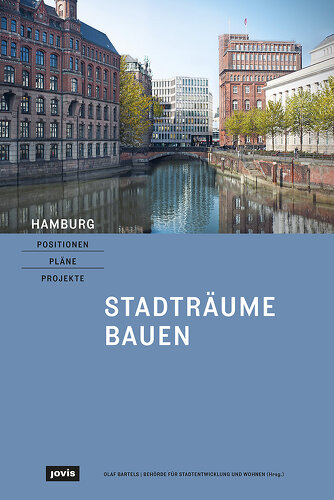Das Moesgaard Museum für Archäologie und Ethnologie ist ein markantes und dennoch eher unauffälliges Gebäude. Dazu trägt besonders das begehbare und begrünte Dach bei, das im Sommer zum Picknick und im Winter zum Rodeln einlädt.
Das Moesgaard Museum für Archäologie und Ethnologie ist ein markantes und dennoch eher unauffälliges Gebäude. Dazu trägt besonders das begehbare und begrünte Dach bei, das im Sommer zum Picknick und im Winter zum Rodeln einlädt.
Die Landschaft in Højbjerg südlich von Aarhus – der dänischen Hafenstadt an der Ostsee – ist bergiger als man es vermuten würde. Mit der Geländeformation der norddeutschen Tiefebene ist sie jedenfalls nicht zu vergleichen. Was bei dem einen oder anderen Radfahrer vielleicht zu Irritationen führt, mag Spaziergängern und Wanderern besonders reizvoll erscheinen. Schließlich ergeben sich schöne Blicke aufs Meer und die hier noch vorzufindende Mischung aus Wiesen, Wäldern, landwirtschaftlich genutzten Flächen und Alleen. Seine landschaftlichen Reize machen das Gebiet um das Landgut Moesgaard mit dem barocken Park und der engen Verbindung zum Ostseestrand zu einem Ausflugsziel par excellence. Der historische Gebäudekomplex diente bislang als Museum und Forschungsinstitut. Diese Funktionen hat im Wesentlichen nun der Neubau übernommen. Das Gut bleibt aber weiterhin Forschungs- und v. a. Lehreinrichtung.
2005 konnten Henning Larsen Architekten mit der Landschaftsarchitektin Kristine Jensens den Wettbewerb für das neue Museum gegen große internationale Konkurrenz – darunter die Büros von Snøhetta und Tadao Ando – für sich entscheiden. Ihre Ortskenntnis mag ein Vorteil gewesen sein, denn der sensible Umgang mit der Landschaft war eine der Hauptvorgaben. Der Bau sollte die Attraktivität der Landschaft steigern, nicht schmälern. Henning Larsens architektonisches Konzept zielte deshalb darauf ab, das Museum weitgehend einzugraben. Das hat zudem energetische Vorteile, da so dessen starken Temperaturschwankungen ausgesetzte Außenflächen minimiert werden. Durch die Neigung nach Südosten sowohl des Geländes als auch des Dachs, ergibt sich ein nur geringer solarer Energieeintrag. Außerdem wollte das Museum für seine Ausstellungen aus konservatorischen Gründen auf Tageslicht verzichten. Das tragende Stahlbetondach wurde mit einem intensiven Gründachaufbau von fast 70 cm - inklusive Dämmung - versehen, mit einer Mischung aus Gräsern und Mosen begrünt und konnte so der Wiese zurückgegeben werden. Diese Art der Zurückhaltung führt aber keineswegs zum Verschwinden der Architektur. Im Gegenteil: Das Dach ist um über 10 m aus dem Erdreich herausgehoben. Die Nordwestfassade macht die Größe der Baumasse mit ihren fast 16 000 m² Nutzfläche deutlich. Doch von Südosten gesehen relativiert die aus der Landschaft beinahe ansatzlos ansteigende Dachfläche diesen Eindruck. Bis zum höchsten Punkt begehbar, ergeben sich so vom Dach des Museums wunderbare Ausblicke in die Landschaft, aufs Meer und die Insel Samsø. Auf dem Technikraum für die Aufzugsanlage über dem Treppenhaus ist deshalb auch eine Art Aussichtsplattform eingerichtet worden. An einigen Stellen sind Terrassen in das Dach eingeschnitten, die aus den Büros der Museumsmitarbeiter zugänglich sind. Die zentrale Terrasse gehört aber zum Restaurant, das so gleichzeitig zum Ausflugslokal wird.
Unter einem Dach
Das Dach schützt also nicht nur die Schätze archäologischer Forschung, es bereichert auch das Freizeitangebot der Gegend und lockt zusätzliche Gäste in die Museumsgastronomie. Dem Museum sind diese Gäste hoch willkommen, weil ganz nebenbei Schwellenängste gesenkt werden. Das Museumspersonal öffnet an Regentagen die eigentlich für Schulklassen vorgesehenen Aufenthaltsräume auch für das Picknick der Wanderer.
Das Restaurant liegt auf der Eingangsebene und ist auch vom Foyer aus zugänglich, das im Kern des keilförmigen Gebäudes liegt. Es bietet Überblick über den Eingang, den Kassentresen, den Museumsshop und das Restaurant sowie über die drei Ausstellungsflächen. Diese sind über die große »Treppe der Evolution« erschlossen, die auf der Foyerebene und im OG in Wechselausstellungen und im UG in die Dauerausstellungen führt. Gerade dieser offene Verteilerbereich verschafft dem Gebäude Transparenz und Großzügigkeit. Vollflächig verglaste Fassaden – begleitet von durchgängig detaillierten Deckenuntersichten drinnen wie draußen – stellen hier stets den Bezug zur Umgebung her. Von dieser freundlichen Atmosphäre umfangen tritt man dann den Auf- bzw. Abstieg in die Ausstellungsräume an. Auch dies trägt dazu bei, potenzielle Vorbehalte gegenüber dem Besuch eines Museums für Archäologie und Ethnologie zu mindern. Die massive Außenwirkung, die v. a. das große Dach mit seinen mächtigen Sichtbetonbrüstungen aber auch die tragenden Elemente der Stahlbetonkonstruktion im Innern vermitteln, wird dadurch geschickt konterkariert.
Ausstellungsbegleiter
Die einladende Geste der Architektur stärkt das intelligente Ausstellungsdesign, das von hausinternen Gestaltern entwickelt und gepflegt wird. Davon ist im Eingangsbereich nur die »Treppe der Evolution« zu sehen, die mit täuschend echten Wachsfiguren die Geschichte der Menschheit erzählt. Fernglasähnliche Projektionsgeräte versetzen die Figuren illustrativ in ihre historische Umgebung und wieder in das Museum zurück. Manche jüngere Besucher haben die Figuren so ins Herz geschlossen, dass sie sie spontan umarmen oder ihnen die Haare flechten. Das ist zwar nicht ganz im Sinne der Museumspädagogik, zeigt aber, dass das Konzept Anknüpfungspunkte zur präsentierten Geschichte bietet. Die Figuren weisen die Besucher dezent auf die Welt hin, die sie auf den Ausstellungsflächen im UG erwartet. Hier herrscht dann dunkle Abgeschiedenheit, die die bedeutsamen Funde – immerhin drei gut erhaltene Leichen aus der Bronzezeit und den »Grauballe Mann«, eine Moorleiche aus der Eisenzeit – konserviert und die Konzentration der Besucher erhöht. In der Ausstellung über das Leben der Wikinger in Aros (dem frühmittelalterlichen Aarhus) helfen Protagonisten des Zeitgeschehens als Wachsfiguren, die die Besucher als virtuelle Begleiter auswählen können, um die historischen Lebenswelten besser zu verstehen. Auch diese Figuren sind so lebensecht nachgebildet, dass man sich vor Verwechselungen hüten muss. Die Ausstellungen sind anregend und durch den Einsatz unterschiedlicher und vielfältiger Medien sinnlich so intensiv erfahrbar. Das lässt einen mit der Zeit trotz aller Bgeisterung ermüden. Aber auch hierfür haben Ausstellungsmacher und Architekten vorgesorgt. Aus allen Ausstellungsbereichen sind Pausenräume zu erreichen, die einen angenehmen Wechsel zum Tageslicht und wunderbare Ausblicke in die Umgebung ermöglichen. Sie sind mit Sesseln und Sofas ausgestattet, sodass sich herrlich pausieren lässt.
Schlüsselelement
Auch wenn das große Gründach wie ein Wikingerschild über dem Moesgaard Museum liegt, vermittelt es keine abwehrende Haltung. Im Gegenteil: Das Foyer ist transparent, hell und übersichtlich gestaltet und der Außenraum fast überall präsent und wenn das kontemplative Dunkel der Ausstellungsräume zu intensiv wird, bieten die Pausenräume Rückzugsorte.
Das Museum ist durch seine Verschränkung mit der Landschaft zu einer komplexen Freizeiteinrichtung geworden, von der die Kultur, aber auch die Natur profitieren. Man könnte fast vergessen, dass es sich auch um einen Arbeitsplatz handelt. Insgesamt arbeiten etwa 200 Angestellte hier und auf dem angrenzenden Gut. Sie betreiben archäologische oder ethnologische Forschungen in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Universität, verwalten die Sammlung und pflegen oder bereiten die Ausstellungen vor. Im Haus werden also auch Büroarbeitsplätze, Studios und Werkstätten benötigt. Diese Räume sind im nordwestlich gelegenen Bereich mit großen Fensterfronten untergebracht. In diesem Bereich des Gebäudes finden sich auch Konferenz- und Tagungsbereiche sowie Gästewohnungen, die sogar von der Dänischen Königin genutzt werden, wenn sie Moesgaard besucht.
Museum plus
Das Moesgard Museum ist eine klassische Forschungs- und Bildungseinrichtung, ein Institut, das auf höchstem Niveau sammelt, forscht und Wissen vermittelt. Die Architektur des neuen Hauses trägt ihren Teil dazu bei, indem sie den Besuchern zu einer guten und intensiven Raumerfahrung verhilft und ihnen Orientierung gibt. Das Raum- und Nutzungskonzept ist aus einer vorausschauenden Analyse heraus entwickelt worden, deren Annahmen offensichtlich zutreffen: Die Besucher stehen schon vor Eröffnung Schlange, kommen von weit her oder einfach zum Picknick auf dem Dach vorbei. Die Architektur ist eine gut funktionierende räumliche Dienstleistung geworden, auch im Hinblick auf die sinnliche Wahrnehmung der Umgebung. Bei allem Erfolg spielt das Dach eine Schlüsselrolle: Es schützt nicht nur vor dem Unbill des Klimas, es eröffnet ungewohnte Perspektiven auf Natur und Kultur zugleich. Man steht im wahrsten Sinne über den Dingen und kann dabei den weiten Ausblick genießen.
db, Di., 2015.09.01
verknüpfte BauwerkeMoesgaard Museum
verknüpfte Zeitschriftendb 2015|09 Dächer
![]()