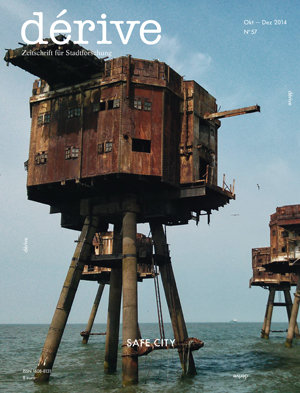Editorial
Sicherheit ist eines der Themen, das uns bei dérive von Beginn an beschäftigt hat und seither nicht mehr verlässt. Bereits in Heft 1 schrieb Michael Zinganel, der auch in dieser Ausgabe vertreten ist, über die Diffusion angloamerikanischer Sicherheitsdiskurse durch frauengerechte Stadtplanung, der Schwerpunkt in Heft 12 war dem Thema Angst gewidmet und dérive 24 trägt den Titel Sicherheit: Ideologie und Ware. Obwohl wir also seit Jahren gegen die überbordende Sicherheitspolitik in unseren Städten anschreiben und damit auch alles andere als alleine sind, schreitet die Überwachung im öffentlichen Raum ebenso munter voran wie die Aufrüstung der Polizei, die Einrichtung von Gefahrenzonen oder das Aufkommen privater Sicherheitsdienste. Anlass genug wieder einmal zu fragen, wie viel Sicherheit die Stadt eigentlich verträgt. Der Erkundung dieser Fragestellung widmen wir das urbanize! Festival 2014, das heuer bereits zum 5. Mal in Wien stattfindet, und diese Ausgabe von dérive, die als Begleitheft und Erweiterung des Festivaldiskurses zu verstehen ist. Der gemeinsame Titel: Safe City.
»If men define situations as real, they are real in their consequences« lautet das so genannte Thomas-Theorem, das sehr gut zum Paradox des subjektiven Sicherheitsgefühls passt, welches Thema des ersten Schwerpunktbeitrags Sicherheit beginnt im Kopf ist. Das subjektive Sicherheitsgefühl vermutet Gefahren an Orten – vornehmlich im öffentlichen Raum –, die faktisch eher ungefährlich sind. Dieses objektive Wissen ändert jedoch nichts daran, dass diese Orte behandelt werden, als wären sie tatsächlich gefährlich. Die Folge sind verstärkte Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle, die für Nutzer und Nutzerinnen wiederum den Nachweis der Gefährlichkeit liefern – wieso sonst sollten diese Maßnahmen notwendig sein? Insgesamt eine vertrackte Angelegenheit, von der in erster Linie die Sicherheitsindustrie profitiert und für die es neue Lösungen braucht. Einige Ansätze dazu behandelt dieses Schwerpunktheft.
Das Gespräch zwischen der Koryphäe der Kriminalsoziologie Fritz Sack und dem Architektur-und-Verbrechen-Experten Michael Zinganel spiegelt die enorme Bandbreite des Sicherheitsthemas im urbanen Raum: Die beiden räsonieren über die Geschichte der Kriminalsoziologie, den Bedeutungsanstieg des Themas Sicherheit, die Verbetriebswirtschaftlichung der Gesellschaft, Kriminalität und Raum, den punitive turn und noch so einiges mehr. Jens Kastner startet den nicht ganz einfachen Versuch, in seinem Text Mit Sicherheit der Freiheit entgegen Thesen von Zygmunt Bauman mit jenen von Michel Foucault sowie Luc Boltanski und Ève Chiapello – und vice versa – zu konfrontieren.
Johanna Rolshoven fragt anstatt darüber nachzudenken, wie die Stadt zur Abwehr von Gefahr und Kriminalität weiter überwacht und abgeriegelt werden kann, nach den Voraussetzungen für eine offene Stadt und kommt zum schönen Schluss: »Eine offene Stadt zu postulieren manifestiert ein Ideal, das bei näherem Hinschauen keineswegs realitäts- oder realisierungsfern ist.« Das Konzept der Offenen Stadt sieht sie als eines der »kulturdynamischen und stadtpolitisch wirksamen Öffnungsdiskurse und Gegenreden« zur aktuellen Sicherheitsdebatte.
Die verstärkte Einbeziehung von Bewohnern und Bewohnerinnen in städtische Prozesse untersucht Alexa Färber in ihrem Beitrag Teilhaben und Sparen: Zwei simulative Wege zur urbanen Sicherheit, mit der inhaltlich weniger schönen Conclusio »Selbstorganisation und Teilhabe in der Stadtentwicklung von unten müssen in dieser zugespitzten Sichtweise als systemstützende Verfahren gewertet werden.«
Wollen wir das verhindern und neue Wege finden, sollten wir uns mit dieser Problematik auseinandersetzen – mehr darüber ab Seite 27. Aktueller denn je zeigt sich der Beitrag von Stephen Graham über das Phänomen military urbanism, das die strategische Kriegsführung in Städten und die Stadt als zentralen Schauplatz von politischer Gewalt thematisiert. Den Abschluss des Schwerpunkts bildet ein Kommentar des griechischen Architekten und Aktivisten Stavros Stavrides über Segregation, Abschottung und urban thresholds.
Das Thema Sicherheit verfolgt auch der Künstler Elvedin Klacar immer wieder in seinen Arbeiten. Einige davon, die uns Klacar dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, sind im Schwerpunkt abgebildet: Protected, Catching Big Birds, Burn Your Neighbor und Attention Mines. Details dazu gibt es auf unserer Website www.derive.at.
Das Kunstinsert in der Mitte des Heftes stammt diesmal von Martin Osterider. Rasches Displacement sind Fotografien, die auf Reisen durch verschiedene Metropolen entstanden sind und auf »ephemere Sets verweisen, die wiederum aus unbeabsichtigten räumlichen Konstellationen entstanden sind«, wie die Kunstinsert-KuratorInnen Barbara Holub und Paul Rajakovics in ihrem Text zur Arbeit schreiben. Im Long-Player Geschichte der Urbanität startet Manfred Russo eine neue Sub-Serie innerhalb seiner Serie. Im Mittelpunkt: Henri Lefebvre als »Wegbereiter der urbanen Performativität«. Mehr über Lefebvre gibt es in den den nächsten Folgen der Serie zu lesen. Da hilft wohl nur dérive zu abonnieren, um keine Folge versäumen!
Wer auch ganz praktisch und vor Ort in das Phänomen Sicherheit eintauchen will, besucht am besten das urbanize! Festival zwischen 3. und 12. Oktober. In facettenreichen Annäherungen zwischen tatsächlichem Sicherheitsbedarf, Überwachungsideologie und solidarischen Gesellschaftsentwürfen beleuchtet das Festival die rasante Entwicklung von Überwachung und Kontrolle, erörtert Möglichkeiten der Förderung sozialer Sicherheit in Zeiten der Krise und erforscht potenzielle Chancen für ein Erstarken der Stadtgesellschaft durch Bottom-up-Initiativen und solidarisches Handeln. Die Festivalzentrale schlagen wir im Herzen der Stadt in der Containerarchitektur des Mobilen Stadtlabors des TU future.labs auf dem Wiener Karlsplatz auf, der selbst als einstmals gefährlicher Ort eine umfassende sicherheitspolitische Transformation durchlaufen hat. Alle Informationen gibt’s auf www.urbanize.at.
Vielleicht also bis demnächst, Christoph Laimer und Elke Rauth
Inhalt
Editorial
Christoph Laimer, Elke Rauth
Schwerpunkt
Safe City
Sicherheit beginnt im Kopf
Christoph Laimer
Maximum Security
Über Konstruktionen von Bedrohung
Fritz Sack, Michael Zinganel
Mit Sicherheit der Freiheit entgegen
Jens Kastner
Die Sicherheiten einer Offenen Stadt
Johanna Rolshoven
Teilhaben und Sparen
Zwei simulative Wege zur urbanen Sicherheit
Alexa Färber
Kunstinsert
Martin Osterider
Rasches Displacement
Belagerte Städte
Die Militarisierung des Urbanen
Stephen Graham
A Potential City of Thresholds?
Stavros Stavrides
Serie: Geschichte der Urbanität, Teil 45
Stadt-Handeln. Performative Strategien
Teil 2. Henri Lefebvre
Manfred Russo
Besprechungen
Schauplatz Wohnen
Der neue transnationale Bewegungszyklus
Wächterhäuser: Schönheit an Schienen
Eine offene Straße
Musikstadt, Musikökonomie
Wie produzieren wir unsere Stadt?
Der öffentliche Raum in Zeiten der Veränderung
Impressum
A Potential City of Thresholds?
In contemporary urban theory the city of enclaves represents a concrete tendency of partitioning urban space (Marcuse 1995, Marcuse/Van Kempen 2002). It is not only differentiations in terms of culture, race or ethnicity that are regulated and spatially imposed in the city of enclaves. It is also differences in income and status (and therefore power), that are made effective. Space does not simply express these differentiations. Space co-produces them by giving ground to situated experiences of displacement, of secure sheltering in fortified enclaves, of regulated movement, of limited accessibility and so on. Space regulates and instructs people, enforcing an experienced taxonomy of power.
Every city today is explicitly or implicitly divided. Every city is defined by spatial enclaves that constitute an urban archipelago. Borders are not just between states; borders are everywhere in the world’s cities, operating as discriminating spatial regulators. Discriminating is above all a matter of spatial form. Apartheid architects and planners were pioneers in searching for urban forms appropriate for social segregation. It is not so surprising that they have adopted the utopian models of Robert Owen and Ebenezer Howard, in creating separated, enclosed »urban villages«, with each race group having its own residential area (Bremner 2005, p. 123). Complete urban separation is indeed a utopian project based on the rhetoric of efficiency and avoidance of conflict. What these utopias share with the early socialist utopias is the belief that an imposed taxonomy of people will guarantee an eternal social order.
We need to reject the organizing principles of the city of enclaves as well as the urban imaginary that legitimates these principles. We need to go beyond any idea of planning a partitioned and separated city in order to control populations that are supposedly predisposed to conflict (ethnic, racial or otherwise). And since enclaves are defined by controlled perimeters and recognizable checkpoints, we need to go beyond any discussion aiming at a just or sustainable definition of borders. It is true, as Etienne Balibar suggests, that a kind of borderless world utopia can only turn out to be the nightmare of a world controlled by multinational enterprises (Balibar 2002, p.83). We can, however, replace borders by passages. We can conceive of urban fabric as constructed by those in-between areas that we can call urban thresholds: places that separate while connecting and connect while separating (Simmel 1997, p. 66–69).
Urban thresholds are not urban parentheses. Urban thresholds are neither buffer zones, nor a no-man’s land located between separated urban areas. Urban thresholds are more like bridges to otherness. They constitute the spatial equivalent of differentiation through comparison rather than through separation. Urban thresholds can thus become a form of spatiality that can help different people live together, communicate and construct where, when and the way they want their common life, without reducing their different cultures to an imposed homogeneity.
We need to go beyond the image of an ideal city envisioned as a just and peaceful enclave, a kind of self-enclosed humanitarian utopia. A porous urban perimeter is absolutely necessary for a city to be able to survive. Urban thresholds can indeed define the character of these city »pores« (a word meaning passage in ancient Greek).
Henri Lefebvre has prophetically claimed that the right to the city is the right of rights, the sum of human rights collectively practiced (Lefebvre 1996, p. 158). For him the city has been once and should be again a collective work of art (ibid. p. 173–174). To achieve this, equality, though absolutely necessary, is not enough. People must have the opportunity to create their own cities through direct involvement and mutual awareness. Urban thresholds can be those social spatial artifacts that can be created through use. Thresholds exist to be crossed. Thresholds exist when crossed. Moreover, thresholds, as potentialities, can express the meaning of human interaction, exchange, communication, the meaning of offering (Stavrides 2010). Urban thresholds may thus become those everyday symbolic sites where everyday creative coexistence is made prominent while being performed.
[Stavros Stavrides, architect, is associate professor at the School of Architecture, National Technical University of Athens, Greece, where he teaches on (social) housing design and the meaning of metropolitan experience. His research is currently focused on forms of emancipating spatial practices and urban commoning (characteristically developed in his forthcoming book Common Space to be published by Zed Books). Latest Books: Suspended Spaces of Alterity (Athens 2010); Towards the City of Thresholds (Trento 2010).]
References:
Balibar, Etienne (2002): Politics and the Other Scene. London: Verso.
Bremner, Lindsay (2005): Border/Skin. In: Sorkin, Michael (ed.): Against the Wall. New York: The New Press.
Lefebvre, Henri (1996): Right to the City. In: Kofman, Eleonore & Lebas, Elizabeth (eds.): Writings on Cities, Henri Lefebvre. London: Blackwell.
Marcuse, Peter (1995): Not Chaos, but Walls: Postmodernism and the Partitioned City. In: Watson,Sophie & Gibson, Katherine(eds.): Postmodern Cities and Spaces. Oxford: Blackwell.
Marcuse, Peter & Van Kempen, Ronald (eds.) (2002): Of States and Cities. The Partitioning of Urban Space. Oxford: Oxford University Press.
Simmel, Georg (1997): Bridge and Door. In: Leach, Neil (ed.): Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory. London: Routledge.
Stavrides, Stavros (2010): Towards the City of Thresholds. Trento: Professionaldreamers. Available at www.professionaldreamers.net/_prowp/wp-content/uploads/978-88-904295-3-8.pdfdérive, Mo., 2015.02.02
02. Februar 2015 Stavros Stavrides