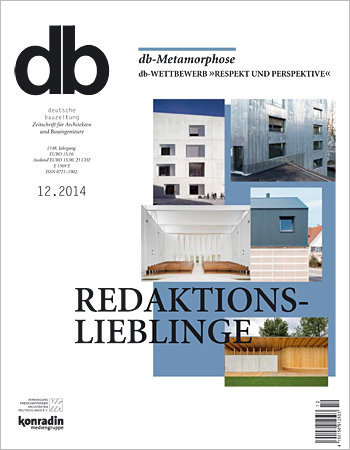Editorial
Das Jahresabschlussheft der db ist wieder den Lieblingsbauten der Redakteure gewidmet. Die Auswahl der vorgestellten und wie gewohnt kritisch betrachteten Projekte bildet diesmal eine Entdeckungsreise durch den Südwesten des deutschsprachigen Raums. Dabei ist ein Naturbad im Schweizer Örtchen Riehen, das sich Ulrike Kunkel angeschaut hat, eine 50er-Jahre-Kirche in Stuttgart, von deren qualitätvoller Sanierung sich Achim Geissinger überzeugte, ein in jeglicher Hinsicht minimalistisches Privathaus, das Martin Höchst bei Tübingen entdeckte, ein »Gürteltier« an einem ausgesprochenen Unort im schweizerischen Wil, welchen Dagmar Ruhnau aufzusuchen auf sich nahm, und die Kita »KinderUniversum« in Karlsruhe, deren Betonoberflächen db-Metamorphose-Redakteur Christian Schönwetter auf sich wirken ließ. | Redaktion
Pack die Badehose ein
(SUBTITLE) Naturbad in Riehen (CH)
Am Rande der Baseler Vorortgemeinde Riehen, unmittelbar an der deutschen Grenze, wurde mit der Badesaison 2014 eine neue Schwimmanlage eröffnet: das Naturbad Riehen. Rutschentürme in Pink oder Sprungturmstaffeln sucht man hier vergebens: Moderat und bescheiden fügt sich die Anlage in die Umgebung ein, die von der Schwemmlandaue des Flüsschens Wiese und dem Abhang des Tüllinger Hügels, der südlichsten Spitze des Schwarzwalds, geprägt wird.
Das charmante Projekt ist vom Baseler Büro Herzog & de Meuron, das andernorts derzeit vornehmlich durch Großprojekte von sich reden macht: durch die Hochhausprojekte für Roche, die Elbphilharmonie in Hamburg, durch Museen in Kalkutta und Hongkong. Das zurückhaltende, alles andere als spektakuläre Holzgebäude des Naturbads spricht eine andere Sprache. Es knüpft an historische Badearchitekturen an und erinnert so an das Frühwerk der Architekten, das um die Auseinandersetzung mit dem Ort und der alltäglichen Architektur kreist.
Die Schweiz ist nicht nur ein Land der Berge, sondern auch eines der Quellen, Flüsse und Seen. Das Wasser war nicht nur der Motor der frühen Industrialisierung; auch seine heilende Wirkung wurde frühzeitig erkannt. Einer der ersten Kurorte war Pfäfers bei Bad Ragaz, wo Kranke schon seit dem 13. Jahrhundert – an Seilen herabgelassen – im warmen Wasser der Taminaschlucht badeten. Ihre Blüte erlebten Kurorte allerdings im 19. Jahrhundert; der Tourismus blieb nicht mehr auf die überschaubaren Kreise der Machteliten beschränkt, sondern erreichte breitere Kreise der sich ausbildenden bürgerlichen Gesellschaft. Von der medizinischen Anwendung zum Sport- und Freizeitnutzen bedurfte es noch eines längeren Wegs. Der Hygienediskurs der Lebensreformer um 1900 legte Grundlagen, auf welche auch die Protagonisten des Neuen Bauens zurückgreifen konnten. Zum Pionier der Freibadarchitektur in der Schweiz wurde der Bauingenieur Beda Hefti, der stilistisch im Neoklassizismus begann und in den 30er Jahren auf die Moderne einschwenkte. Doch auch für andere Architekten war das Thema des Schwimmbads attraktiv: Marc Piccard realisierte 1934-37 das Bad Bellerive-Plage in Lausanne-Ouchy, Max Ernst Haefeli, Werner Moser und der Landschaftsarchitekt Gustav Ammann realisierten 1938/39 das Freibad Allenmoos in Zürich, und Max Frisch konnte in seiner Zeit als Architekt 1947-49 das Bad Letzigraben in Zürich bauen. Handelt es sich bei diesen Bauten zumeist um Ikonen des Neuen Bauens, so entstanden daneben seit dem späten 19. Jahrhundert einfache hölzerne Badeanlagen an Seen und Flüssen. Sie zeigen sich aus Gründen des Sichtschutzes nach außen geschlossen, während die an die Umfriedung angebauten Garderoben- und Funktionsbereiche mit vorgelagerten Stegen und Liegeterrassen sich zum Wasser hin öffnen. Diese Typologie bildete die Referenz für das neue Naturbad in Riehen.
Ganz am Anfang verfolgten die Architekten jedoch eine andere Strategie. Denn mit einem Bad in Riehen setzten sich Herzog & de Meuron schon zum Beginn ihrer Karriere auseinander. 1979 gewannen sie einen Wettbewerb für ein Frei- und Hallenbad am Mühlenteich in Riehen, das ungefähr dort entstanden wäre, wo heute die Fondation Beyeler steht. Auch wenn eine Veranda mit Holzlamellen gestisch bewusst einfach gehalten war, entsprach die Kombination aus Frei- und Hallenbad noch ganz dem Denken und den scheinbar grenzenlosen Budgets der 70er Jahre. Das Projekt wurde bis 1982 verfolgt, dann jedoch verworfen. Vier Jahre später legten die Architekten ein neues Projekt vor, nunmehr deutlich redimensioniert und auf ein reines Freibad beschränkt. Wie große Wannen aus Beton hätten die Schwimmbecken in der Landschaft gestanden, doch aus Gründen des Grundwasserschutzes nahm man auch von diesem Konzept Abstand. Obwohl über ein Bad in Riehen weiterhin diskutiert wurde, startete man einen neuen und schließlich erfolgreichen Anlauf erst 20 Jahre später, im Jahr 2007. Der neue Standort liegt etwa 500 m nordwestlich des ursprünglich avisierten und wird auf zwei Seiten von der hier im Knick geführten Weilstraße, die Riehen und Weil am Rhein verbindet, sowie auf der südöstlichen Langseite vom Flusslauf der Wiese begrenzt. Eine hölzerne Umfassungswand in der Tradition der historischen Schweizer »Badis« umschließt das trapezoide Grundstück mit seinen rund 6 000 m² auf drei Seiten. Zur Wiese und ihrer Auenlandschaft hin bildet eine Hecke die Begrenzung, ohne für die Besucher des Bads den Blick in die Weite zu behindern.
Konzeptionell stellt das neue Bad das Gegenmodell zum Projekt aus den Jahren 1986/87 dar: Inszenierten Herzog & de Meuron seinerzeit mit ihren Betonskulpturen den Gegensatz von Architektur und Natur, forcierten also den künstlichen Charakter der Intervention, so ist das Ziel jetzt gewissermaßen minimalinvasiv: Das Bad fügt sich ganz bewusst in die landschaftliche Umgebung ein. Dies lässt sich nicht nur an der hölzernen Architektur festmachen; auch der Gedanke eines »Naturbads« folgt einem gewandelten Verständnis von einer Badeanstalt. Das Wasser wird nicht gechlort und chemisch aufbereitet, sondern biologisch regeneriert. Hierzu dienen nicht nur die mit Pflanzen bewachsenen Uferzonen, sondern mit Pflanzen bewachsene Filterkörper auf der anderen Seite der Straße. In diese Anlage, die an gestaffelte Reisterrassen erinnert, wird das gebrauchte Wasser gepumpt, bevor es im Sinne eines kontinuierlichen Kreislaufs wieder in die Becken gelangt. Ein großer, von flachen, mit Wasserpflanzen bewachsenen Kiesufern eingefasster Badesee, durch hölzerne Plattformen und Stege erschlossen und gegliedert, bildet das Zentrum des Naturbads. Der Badesee teilt sich in unterschiedliche Zonen: ein Nichtschwimmerbecken, ein 25-Meter-Becken mit vier Bahnen sowie ein Sprungbecken mit 1-Meter-Brett und 3-Meter-Plattform. Lediglich das flache Planschbecken für Kleinkinder ist separat angelegt.
Die das gesamte Areal dreiseitig umgebende Bretterwand aus Lärchenholz übernimmt sämtliche anderen Funktionen. Auf der nördlichen Schmalseite ist sie raumhaltig ausgebildet: Garderobenräume, Toiletten und ein kleines Café flankieren den Eingang, eine Treppe führt hinauf auf das als Terrasse ausgebildete Oberdeck. An den übrigen beiden Seiten wird die Wand durch eine pultartige Dachkonstruktion überfangen. Die schrägen Dachsparren, welche weit über die die Wand begleitenden Liegepodien auskragen, werden auf der Außenseite durch eine Holzzangenkonstruktion gehalten. Drei Ausbuchtungen gewähren Platz für die als Massivkonstruktionen erstellten Duschbereiche.
In Zeiten, da Ökologie als ein Megatrend verstanden werden kann, repräsentiert das Naturbad Riehen ein neues Verständnis eines Schwimmbads. Diesem Konzept entsprechen Herzog & de Meuron mit einer architektonischen Lösung, die angesichts der sonstigen Projekte des Büros durch eine angemessene Bescheidenheit und Selbstverständlichkeit überzeugt.db, So., 2014.11.30
30. November 2014 Ulrike Kunkel
Wehrhaft und durchlässig
(SUBTITLE) Büro- und Wohnturm in Wil (CH
Richtig idyllisch ist die Schweiz in den Landstrichen am Bodensee nicht. Viele Gewerbebetriebe zeugen vom industriellen Fleiß der Bewohner. Der Ort Wil-Rickenbach im Kanton St. Gallen macht hier keine Ausnahme, doch die Nachbarschaft und die Lage des Büro- und Wohnturms sind selbst in dieser Gegend sehr speziell.
Der Neubau steht an einer von Gewerbebauten gesäumten Straße, die aus Wil herausführt: Autohäuser, Einrichtungsmärkte und Bürobauten in unregelmäßiger Größe und Anordnung prägen die Umgebung. Hinter einer Mauer aus betongefüllten Stahlkassetten erstrecken sich Wiesen, auf denen Pflöcke künftige Einfamilienhausgrundstücke markieren. Diese Flächen gehörten zum Besitz von Eberle Mühlen, dem Bauherrn unseres Neubaus. Die Ausfallstraße führt recht schnell in die Landschaft, rechts und links öffnen sich plötzlich Blicke auf Berge und weite hügelige Wiesen. Den größten Kontrast bietet allerdings die unmittelbare vertikale Umgebung des Gebäudes: Während sich an seinem Fuß mit dem Mühleweiher eine kleine Idylle eröffnet – wenn auch v. a. optisch –, brettern sechs Geschosse weiter oben Lkw und Autos über den Viadukt einer überregionalen Hauptstraße.
»Dieser Ort hat uns natürlich sehr gereizt«, sagt Patric Furrer, einer der beiden Inhaber des 2008 gegründeten Zürcher Architekturbüros Furrer Jud. Der Auftrag war erst der dritte für die jungen Architekten und kam durch Vermittlung der Tochter des Bauherrn zustande, nachdem drei andere Büros unbefriedigende Entwürfe geliefert hatten. Die Planung erstreckte sich über ca. drei Jahre; dabei entstanden rund 50 Volumenmodelle des Baus – und ein intensives und vertrauensvolles Verhältnis mit dem Bauherrn, der zunächst lieber einen »normalen«, d. h. rechtwinkligen Grundriss zwecks Flächenmaximierung gehabt hätte statt des minutiös ans Gelände und an den Bestand angepassten Gebäudes.
Gedreht und gewendet
Ursprünglich stand an dieser Stelle ein 25 m hoher Betonturm als Getreidesilo, fast zeitgleich mit der Hochstraße in den 60er Jahren für die Mühlengesellschaft errichtet. Dessen Grundmauern im Hang erhielten die Architekten und erweiterten sie in zwei Richtungen, die Eckpunkte nahmen sie auf und führten sie als wahrnehmbare Knicke in der Fassade und im Grundriss nach oben. Im Gegensatz zu dem vormals fast fensterlosen, sich rigide nach oben streckenden Turm wollten sie jedoch in intensiven Dialog mit der Umgebung treten. Das ist ihnen gelungen – jedes Geschoss reagiert auf eigene Weise auf die Einflüsse sowohl aus der horizontalen Richtung als auch aus der Vertikalen, woraus sich ein differenzierter Baukörper entwickelt hat. Umhüllt sind die Volumina mit einer Fassade aus Titanzinkblechen auf einer Unterkonstruktion aus Trapezblech. Die beabsichtigte (und erreichte) Wirkung war die eines Panzers gegenüber der unwirtlichen Umgebung. Doch es ist viel mehr: Landmarke, abwechslungsreiche Architektur, vielleicht Initialzündung. Immerhin gab es eine rege Nachfrage von Mietinteressenten sowohl für die Wohnung als auch für die Büros. Die ca. 2,5 x 0,36 m großen Bleche glänzen zwar nicht mehr wie zu Anfang, doch bilden sie bei Sonnenschein immer noch eine edel wirkende, leicht bewegte Hülle. Sie passen sich in ihrer Farbigkeit exzellent ihrer Umgebung an – sei es an die horizontal gegliederten Bleche des Autohauses, sei es an die hellgraue Faserzementverkleidung des Nachbargebäudes oder sogar an das ruppig-schmutzige Wellblech der Postumschlagbasis noch ein Grundstück weiter. »Unser Ziel war ein industrielles Gebäude in einer industriellen Umgebung«, erläutert Patric Furrer. Und mit der Umsetzung sind die Architekten auch nach einem Dreivierteljahr noch »sehr zufrieden«. Ein Aspekt allerdings könnte durchaus weniger »umfeldorientiert« sein: Die großflächige, geschlossene Seitenwand des Turms Richtung Hochstraße hätte gern leer bleiben können und würde damit mehr Zeichenwirkung entfalten als jetzt, da sie ihrer Bestimmung gemäß mit großen Werbebannern verhängt ist.
Zwischen industriell und gediegen
Die Staffelung des Baukörpers ergab sich auch aus den vorgeschriebenen Höhenbegrenzungen, die sich in den unterschiedlichen Raumhöhen widerspiegelt: Die oberirdischen Büros sind 2,35 m hoch, die UGs und die Wohnung 2,6 m. Die beiden UGs, genutzt als kleinere Büroeinheiten, orientieren sich zum Weiher; ganz unten kann man sogar heraustreten und hat einen kleinen Sitzplatz direkt am Wasser – den Verkehr auf der Brücke weit oben über einem nimmt man tatsächlich kaum wahr. Über diesen beiden Geschossen folgen, erschlossen von der Straßenebene, drei Bürogeschosse, die die gesamte Fläche des Grundstücks einnehmen und (mit wenigen Ausnahmen) durch Knicke auch dessen Grenzen nachzeichnen. Das Treppenhaus ist in einer Ecke des ehemaligen Umrisses angeordnet und trägt dazu bei, die Büros jeweils in eine vordere, zur Straße orientierte, und eine hintere, zum Weiher gerichtete Fläche zu gliedern. Hier bewirkt die Aussicht ins Grün eine ruhige Atmosphäre, bei Sonnenlicht zeigen sich sogar Reflexe vom Wasser an der Decke.
Die Ausstattung ist nüchtern und robust, mit einem Hartbetonboden, weiß gestrichenen Wänden und einfachen weißen Schränken im Eingangsbereich, die als Garderobe, Teeküche und Serverplatz dienen.
Das EG-Büro ist direkt von der Straße zugänglich, alle anderen sind vom Treppenhaus aus zu erreichen, das noch einen separaten, seitlichen Eingang im 1. UG besitzt. Das Treppenhaus führt bis ins 4. OG und bietet hier eine Art Hintereingang für das Highlight des Baus: Die Wohnung sitzt als schlanker, viergeschossiger Turm auf der breiten Basis und ruft den Vorgängerbau in Erinnerung. Mehr als eine Wohnung war im Gewerbegebiet übrigens nicht erlaubt. Der eigentliche Zugang befindet sich im 6. OG, direkt erreichbar mit dem Aufzug. So gelangt man mitten in die Wohnung, ins oberste Wohngeschoss – von hier aus geht es in die eine Richtung nach unten in die privateren Räume, in die andere nach oben auf die Dachterrasse. Interne Verbindung ist eine schöne geschlossene und parkettbelegte Treppe entlang einer Außenwand. Wie es in einem Turm eben so ist, nimmt die Erschließung viel Platz ein, doch andererseits bilden Treppe und Flur einen selbstbewusst großzügigen Bereich. Ein Kern, der Aufzug, Bad und WCs aufnimmt – Letztere mal von der einen, mal von der anderen oder auch von beiden Seiten zugänglich – trennt den Flur vom Wohnbereich und ermöglicht »Rundum-Wohnen«, was der durchgängig verlegte dunkle Parkettboden unterstreicht. Insgesamt ist die Ausstattung der Wohnung minimalistisch, aber gediegen und mit Blick auf heimische Materialien gewählt – die Fensterlaibungen etwa wurden mit Schweizer Lärche ausgekleidet. Im 5. OG, quasi das 1. OG des Wohnturms, dann ein gezielt gesetzter Kontrast: Durch das große Fenster im Flur geht der Blick direkt auf die Brücke, auf der die Lkw vorbeirauschen – die Brüstungshöhe so, dass man sich auf einem Sessel davor setzen und geradezu kontemplativ dem Verkehr zusehen könnte, zu hören ist er nämlich kaum. Die Bewohner fühlen sich durch die Nähe des Verkehrs nicht gestört, im Gegenteil: »Wir haben schon gern, dass etwas los ist, wo wir wohnen«, kommentieren sie die Frage. Das ist insbesondere im Geschoss darüber der Fall: Zwei gegenüberliegende Fenster holen auf der einen Seite die Hochstraße und auf der anderen die riesigen Leuchtbuchstaben des Autohändlers ins Wohnzimmer – und dahinter gleich die weite Landschaft. Die eine weitere Etage höher tatsächlich die Atmosphäre bestimmt: Denn die Dachterrasse haben die Architekten weg von der lauten Straße und hin zur Aussicht gedreht. Ein Übriges tun die hohen Gräser, mit denen die Bewohner, selbst Landschaftsgärtner, die Terrasse bepflanzt haben. Die Vertikalen der Dachterrasse sollten ursprünglich wie die restliche Fassade mit Titanzinkblech gestaltet werden, doch entschieden sich die Architekten dann doch lieber für grau gestrichenes Holz – einerseits ist es wärmer und einladender, insbesondere auf der Überfahrt des Aufzugs, die hier als Sonnenbank ausgebildet ist, andererseits bietet es in diesem Bereich noch einmal eine neue, andere Materialqualität.db, So., 2014.11.30
30. November 2014 Dagmar Ruhnau
Einfach ausdiskutiert
(SUBTITLE) Umbau der Rosenbergkirche in Stuttgart
Die Gemeinde musste auf ihrem Kirchengrundstück enger zusammenrücken und hat mit klug überlegten Eingriffen ein Kulturdenkmal der 50er Jahre nicht nur erhalten, sondern für sich selbst deutlich besser nutzbar machen können. In beharrlichen Debatten haben alle Beteiligten die jeweils beste Lösung erstritten.
Jährlich tritt in Deutschland etwa eine Viertelmillion Menschen aus den christlichen Kirchen aus. Viele traditionelle Gemeinden spüren das deutlich und sehen sich zur Reorganisation von Strukturen und Angeboten gezwungen.
So auch die Rosenberggemeinde mitten im dichtbesiedelten Stuttgarter Westen, welche die 800 Sitzplätze in ihrer Kirche allenfalls noch zu Weihnachten brauchte; im regulären Gottesdienst sitzt nur noch ein versprengtes Grüppchen. Die Gemeindearbeit hat derweil kaum an Bedeutung verloren; Jugendgruppen, Musikangebote, Seniorenrunden und andere Gemeinschaftserlebnisse erfahren Zulauf, wie auch die diakonischen Aufgaben nicht weniger werden. Die seit einiger Zeit mit einer weiteren evangelischen Nachbargemeinde vereinigte Rosenberggemeinde hat sich gut überlegt, wie sie mit ihren nun zwei Standorten umgehen will. Mit dem Verkauf ihres wenig attraktiven Gemeindehauses aus den 30er Jahren hat sie einen Gutteil der Kosten für Sanierung und Umbau der unter Denkmalschutz stehenden Rosenbergkirche finanziert.
Der Haltung folgend, dass Kirchen nicht nur gestalterisch das Stadtbild prägen, sondern auch in ihrer Funktion als Orte des sozialen und spirituellen Austauschs, wurde das Raumprogramm gestrafft und der Standort attraktiver gemacht.
Während man in Frankreich oder Benelux keinerlei Manschetten hat, Kirchen zu Kinos, Handelskammern, Buchläden oder Restaurants umzunutzen, geben sich die Gemeinden in Deutschland redlich Mühe, den sakralen und auch räumlichen Charakter ihrer Gotteshäuser nach Kräften zu erhalten. Bei der Rosenbergkirche lohnte das besonders, stuft sie der Denkmalschutz doch als Gesamtkunstwerk ein und als bedeutenden Repräsentanten des Organischen Bauens der 50er Jahre in Württemberg. Erwin Rohrberg hat sie zwischen 1954 und 1956 auf der Fläche einer zerstörten ehemaligen Wanderkirche erbaut und dabei Elemente des Industriebaus mit räumlichen Konzepten, wie er sie bereits im Kinobau eingesetzt hatte, zu einem heiteren und zugleich stimmungsvollen Ensemble zusammengebunden. Genau hierin lag aber ein Problem, mit dem die Gemeinde nie ihren Frieden gemacht hat: Rohrberg hatte die abweisende Eingangsfront komplett geschlossen, den ganzen Kirchenraum allein über den Obergaden beleuchtet und somit das Foyer unter der Empore in dramatische Düsternis getaucht, aus der heraus das Kirchenschiff und die über ein Oberlicht à la Corbusier erhellte Chorwand umso heller erstrahlte – per aspera ad astra.
Explizit war daher im Auswahlverfahren nach Öffnung des Ensembles gefragt und die Aufgabenstellung recht frei formuliert worden, man stellte sogar die Möglichkeit von Teilabrissen in Aussicht. Siegreich war schließlich das Konzept von Kamm Architekten, das mit seinen minimalen Eingriffen und der Umnutzung einzelner Raumabschnitte sowohl den Begehrlichkeiten des Denkmalschutzes als auch der klammen Finanzsituation der Bauherrschaft gerecht wurde. Die Verbesserungen beginnen im Außenraum, den Rohrberg damals als abgeschlossenen, eingefriedeten Kirchhof definiert und auf das in der Tiefe des Grundstücks gelegene Gemeindehaus ausgerichtet hatte. Die rote Sandsteinwand, die den Vorplatz von der Straße abtrennt, durchbrachen die Architekten mit zwei schmalen Treppenläufen, die nun, begleitet von farbig gefassten Stahlwangen, den direkten Zugang ermöglichen, dabei zunächst ein Gefühl der Enge erzeugen, welches, oben angekommen, die Qualität des Freiraums inmitten der dichten Blockstruktur des Quartiers aber umso deutlicher erlebbar macht. Ein Kniff, der umso nötiger erschien, als die neue Nachbarbebauung auf dem veräußerten Grundstücksteil nebenan ziemlich dicht herangerückt ist und damit die einladende Geste der seitlich geführten Haupttreppe ad absurdum führt.
Hochkant in die Kirchenfassade geschnittene Fensteröffnungen und -türen signalisieren die gewünschte Offenheit und geben dem Foyer endlich die ersehnte Helligkeit. Es wird zu gesellschaftlichen Anlässen genutzt – die regelmäßige Bespielung als Bistro-Café mit Außenterrasse wird erprobt.
Die eigentliche Heldentat besteht aber darin, durch den Einbau einer Trennwand die selten belegte Empore in einen gut proportionierten, gern genutzten Saal transformiert und das Kirchenschiff um zwei Joche verkürzt zu haben. Der Proportion des Kultraums schadet dies erstaunlicherweise keineswegs, im Gegenteil: Die Gemeinde sitzt nun dichter beisammen und näher am Geschehen. Der Altarraum, der zuvor mit den wandnah platzierten Elementen Kanzel, Pult, Altar übermöbliert wirkte, wurde in den Raum hinein um so viel ausgeweitet, dass nun ein ganzes Orchester Platz findet. Für die Farbfassung der Wände hat man sich auf ein gedecktes Weiß geeinigt, das die Farbigkeit der Wandgestaltung hinter dem Altar hervorhebt und den vordem grau gestrichenen Raum in eine helle Feierhalle verwandelte.
Die neue Trennwand führt mit ihrer akustisch wirksamen Faltung und gläsernen Durchbrüchen ein neues Formenvokabular ein, wirkt aber keineswegs wie ein Fremdkörper. Eher präsentiert sie sich wie ein Einbaumöbel, als das sie im Grunde auch konzipiert ist: eine jederzeit ohne nennenswerte Eingriffe in die Substanz wieder rückbaubare Stahlkonstruktion. Der mechanisch belüftete Saal auf der Empore ist als energetisch getrennter Raum im Raum eingebaut und mit Küche und Sanitäreinrichtungen versehen. Der Brandschutz – es greifen die Regeln der Versammlungsstättenverordnung – verlangte u. a. ein separates (durchaus sehenswertes) Fluchttreppenhaus.
Das knappe Budget der Gemeinde ist verschiedenen Sitzmöbeln und Gerätschaften anzusehen, die zu den großen Festen gebraucht werden und für die es einen Stauraum nicht mehr gereicht hat. Die Architekten waren gezwungen, mit wenigen, einfachen und preiswerten Mitteln zu arbeiten und viele Diskussionen mit allen Beteiligten darüber zu führen, was möglich, sinnvoll und v. a. bezahlbar ist. Im sogenannten Konfirmandenhaus, einem kleinen, zur Straße hin verschlossenen, zum Vorplatz hin geöffneten Anbau mit drei Geschossen, fallen die weißen, sauber gearbeiteten Einbaumöbel eben gerade nicht auf. Die hellen Gruppenräume und das Gemeindebüro bieten einen protestantisch-sachlichen aber auch freundlichen Rahmen. So freut sich der Architekt – und auch der geneigte Besucher – umso mehr über »Extras« wie das Thekenmöbel und Sanitärausstattungen aus Mineralwerkstoff und die Wendeflügel der neuen Fenster, die man aus energetischen Gründen nicht mit den schmalen Profilen der 50er Jahre ausstatten konnte, sondern dem Standardsortiment entnehmen musste. Irritiert mag man die unterschiedliche Anmutung der original erhaltenen Treppenhausverglasung und der neuen Profile vergleichen; als klare Aussage über Alt und Neu darf man die Entscheidung der Architekten aber anerkennen, ebenso wie die Farbauswahl, über welche sich die neuen Rahmen in den Duktus der gesamten Fassade einfügen. Das ganze Haus wurde in enger Abstimmung mit den Denkmalbehörden mit neuer Heizungstechnik ausgestattet, mit einem Innendämmputz und neuen Bodenbelägen versehen, über einen gemeinsamen Aufzug barrierefrei erschlossen, und auch der Dachhohlraum wurde ausgedämmt. Keine der Maßnahmen rückt dem Denkmal zu dicht auf die Pelle, vielmehr hat man sich viel Mühe gegeben, seinen Wert zu stärken. Alle Einbauten und Veränderungen sind additiv konzipiert und reversibel. Und auch wenn so manche Detaillösung in den zahllosen Diskussionen nicht über das Stadium eines guten Kompromisses hinauskommen konnte, darf das gesamte Projekt doch als Paradebeispiel dafür gelten, dass die Beteiligung vieler Köche den Brei nicht zwangsläufig verderben muss. Dem Durchhaltevermögen der Architekten sei Dank, wie auch dem ambitionierten Mitwirken einzelner Gemeindemitglieder und der kompetenten Bauherrschaft. Es ist zu spüren, wie viel Gedankenarbeit in das Projekt geflossen ist und dass der Spaß am Austüfteln guter Lösungen dabei nicht zu kurz kam.db, So., 2014.11.30
30. November 2014 Achim Geissinger