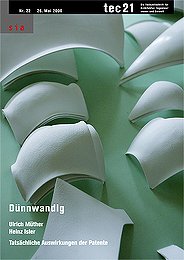Editorial
Die Zukunft der Schalen
Schalen sind effiziente Tragwerke mit vergleichsweise geringem Gewicht. Die Natur hat Schalenformen mit faszinierenden Makro- und Mikroeigenschaften geschaffen, zum Beispiel Eier, Schneckenhäuser oder die grossen Blätter der Seerose Victoria Regia. Architekten und Ingenieure setzen Schalentragwerke ein, wenn Festigkeit, Steifigkeit, Gewichtsersparnis und Funktionalität wichtig sind: für Dächer mit grosser Spannweite, Staudämme, Notunterkünfte, in der Luft- und der Raumfahrt und im Schiffbau.
In den letzten Jahrzehnten sind einige Schalenbauwerke zu architektonischen Denkmälern geworden. Dank neuartigen Werkstoffen, beispielsweise Verbundmaterialien aus glasfaser- und kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen, sind die Einsatzmöglichkeiten von Schalenstrukturen im Leichtbauwesen gewachsen. Auf der Ingenieurseite sind neue Auslegungs- und Dimensionierungsverfahren für die Festigkeits- und Stabilitätsanalyse und die Optimierung der Schalen entwickelt worden sowie neue Verfahren für die Herstellung von Bauteilen im Werk und vor Ort. Die Fortschritte im Bereich intelligenter Werkstoffsysteme bieten auch den adaptiven Schalenbauteilen grosses Potenzial. Vorstellbar ist die Entwicklung von intelligenten multifunktionellen, hochwertigen Bauteilen aus grossen Schalenstrukturen, die mit Sensoren und Aktuatoren ausgerüstet sind.
Trotz ihrer technischen und ästhetischen Vorteile sind Schalenbauten nicht weit verbreitet. Grund dafür könnten neben den anfallenden Kosten auch ungenügende Kenntnisse in den Entscheidungsgremien und bei den planenden Stellen sein. Es ist darum sehr wichtig, die Fachkreise im Rahmen von Forschungsarbeiten, Seminaren, Fortbildungsveranstaltungen und Veröffentlichungen zu informieren: über die unzähligen Einsatzmöglichkeiten, die neuartigen Baustoffe sowie die Dimensionsverfahren und Ausführungsmethoden. Bauingenieure und Architekten können hier einen wertvollen Beitrag an die Gesellschaft leisten, indem sie die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten der Technik mit traditionellen Schalenbauweisen verbinden und eine nützliche Synthese von Materie und Form schaffen.
Prof. Dr. Mehdi Farshad
Empa – Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologie
Inhalt
Müthers Freilichtmuseum
Katinka Corts
Der Ingenieur Ulrich Müther war der wichtigste Betonschalenbauer in der DDR. Gaststätten, Schwimmbäder und Sportbauten plante er im eigenen Land, seine Planetarien wurden zu Exportschlagern. Heute sind auf Rügen viele seiner Bauwerke dem Verfall preisgegeben.
Siebenfüssler und andere Naturformen
Ivo Bösch
Am 26.Juli wird Heinz Isler 80 Jahre alt. Mehr als 1000 Schalen hat er bis heute gebaut. Gründe genug für einen Besuch in seiner Schalenwelt bei Burgdorf. In seinem Büro und Garten stehen faszinierende Modelle, die vom lebenslangen Forschen an der Schale zeugen.
Tatsächliche Auswirkungen der Patente
Urs Hess-Odoni
Aus konkretem Anlass der Patenteintragung von «pile up» werden die Grenzen des Immaterialgüterrechtschutzes im Architekturbereich und die Auswirkungen aufgezeigt. Dabei stellt sich heraus, dass letztlich die freie Berufs-tätigkeit stärker geschützt wird als befürchtet wurde.
Blickpunkt Wettbewerb
Neue Ausschreibungen und Preise / Eine Kernzone umgestalten: Zentrum Hitzkirch / Volkspark in Volketswil
Magazin
Publikation: Virtuos in vielen Disziplinen - Heinz Hossdorf / Gute Luft auf Schweizer Baustellen / Prix Evenir an Rapsöl-Blockheizkraftwerk / Leserbrief / Wettbewerbskommission für bildende Kunst
Aus dem SIA
Schwerpunkte der Direktionsarbeit für 2006/07 / Neue Postadresse / Beträchtliche Stromsparmöglichkeiten bei Aufzügen
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Müthers Freilichtmuseum
Der Ingenieur Ulrich Müther war der wichtigste Betonschalenbauer der DDR. Die Fussbebauung des Berliner Fernsehturms, die Bobbahn in Oberhof und das Restaurant „Teepott“ in Rostock werden heute noch genutzt. Abseits der grossen Städte aber verfallen Müthers Gebäude. Dabei könnten die Betonkonstruktionen zu Pilgerstätten für Architektur- und Ingenieurtouristen werden.
Seiner Heimat ist Ulrich Müther treu geblieben. Er lebt wie eh und je in Binz auf Rügen an der Ostsee. Er nennt sich gern „Landbaumeister von Rügen“, denn von hier aus entwarf er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Architekten von 1963 bis Ende der 1990er-Jahre weit über 70 Gebäude mit Betonschalendächern. Dazu gehören kleine Buswartehallen und Sportgebäude, Gaststätten und Schwimmbäder, aber auch Rennschlittenbahnen und Grossplanetarien. In allen Bauten finden sich dünne Betonschalen als Dach- oder Wandkonstruktion - sei es als Pilz-, Buckel-, Schirm-, Zylinder- oder Hyparschale. Müthers Schalenkonstruktionen waren zu DDR-Zeiten als Prestigebauten sehr begehrt. Viele, die Müthers Betongebäude kennen, sehen sie als moderne Klassiker.
Von der Tonne zur Schale
Ulrich Müther blieb das Abitur verwehrt, da er aus einer „studierten Familie“ kam, was damals nicht förderlich war. Sein Vater war Architekt und betrieb seit 1922 ein Bauunternehmen auf Rügen. Nach einer Lehre zum Zimmermann war Müther ein Jahr lang Geselle und studierte dann Bauingenieurwesen in Neustrelitz. Als Anfang der 1950er-Jahre bei der „Aktion Rose“ viele Pensionsbesitzer und Privatfirmen der Ostseeküste wegen „Spekulantentums“ enteignet wurden, verloren auch die Müthers ihr Unternehmen. Nach den Arbeiter-unruhen im Juni 1953 erhielten sie die Firma zurück.
In den folgenden Jahren wurde das Unternehmen nochmals durch den Staat umgestaltet: erst zur Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH), dann zum Volkseigenen Betrieb (VEB). Ulrich Müther hatte inzwischen mehrere Jahre in der Bauplanung gearbeitet, ein Bauingenieur-Fernstudium an der TU Dresden aufgenommen und war 1958 Technischer Leiter des Familienunternehmens geworden. „Tagsüber war ich in der Baufirma, nach Feierabend haben meine Frau und ich Projekte gezeichnet. So konnten wir Schalen aus der Schublade ziehen, sobald es eine Anfrage gab.“ Müther konnte die Sonderstellung des Unternehmens ausserhalb eines Kombinates stärken, indem er es immer weiter in Richtung Spezialbetonarbeiten ausbaute. „Für den Schalenbau war in der DDR vieles möglich. Der Staat zeigte gern Neues und war in Bezug auf Bauen nicht so konservativ“, sagt Müther.
Doch wie kam er eigentlich auf die Schalen? Schon vor seinem Studium hatte sich Müther mit Tonnenschalen und ihrer Konstruktion beschäftigt, jedoch konnte der Verlauf von Kräften und Spannungen in mehrfach gekrümmten Schalen noch nicht genau berechnet werden. Müther bekam die Möglichkeit, an einem neuen Lehrstuhl in Berlin zu arbeiten. Nach vielen Modellen und Berechnungen konnte er seine Diplomarbeit über eine gekrümmte Spritzbetonplatte, die als Terrassen-überdachung für ein Binzer Ferienheim (1963) geplant war, fertig stellen und auch ausführen. Sein Professor an der TU Dresden, Hermann Rühle, sass im Nationalen Komitee der IASS (International Association for Shell&Spatial Structures), die 1959 von Eduardo Torroja gegründet worden war. Dank dessen Kontakten konnte Müther 1966 zur Bauausstellung nach Budapest reisen. Dort lernte er wichtige Schalenbauer wie Jörg Schlaich (*1934), Josef Eibl (*1936), Stefan Polónyi (*1930) und Heinz Isler (*1926) kennen. Das Gesehene faszinierte Müther, und er entwickelte in der Folge mit kleinmassstäblichen Versuchsschalen immer neue Schalenformen. Inspiriert wurde er dabei vom traditionellen Schiffbau und seinen Erfahrungen als Segler. Für Modelle verwendete er Segeltuch, für Gussformen Sandhügel.
Eine Versuchsschale wurde früher als Buswartehäuschen genutzt und steht heute noch in Binz (Bild 4). An diesem 7u7 m grossen Vorläuferbau für die Mehrzweckhalle in Rostock Lütten-Klein (1968) konnte Müther messen, wie sich die Schale später bei der Mehrzweckhalle verhalten würde. Müthers liebste Form wurde mit den Jahren das hyperbolische Paraboloid. Die Schale besteht aus einem System gerader Linien, wodurch die statischen Kräfte genau berechnet werden können. So entstehen doppelt gekrümmte Flächen, die mit geraden Brettern geschalt werden können - „Rechenwerk und keine organisch gewachsene Kunst“, wie Müther sagt. Zudem kann die Hyparschale auf jeder Neigung und auf Erdschalung gespritzt werden. Mit seiner weiter-
entwickelten Spritzbetontechnik konnte er dann ohne Schalung bauen, der Beton wurde auf gewölbten Bewehrungsstahl und „Kaninchendraht“ aufgespritzt und blieb daran hängen.
Prestigebauten für den Sozialismus. Seine Bauten machten Müther bekannt und brachten ihm weitere Aufträge. Als in Rostock-Schutow 1966 eine Messehalle gebaut werden sollte, schlug Müther zwei gegeneinander versetzte, 7cm dicke Hyparschalen von je 20u20 m vor. Bei der Einweihung lernte Müther Vertreter der Rostocker Konsumgenossenschaft kennen, die ihn mit dem Bau eines Konsum-Pavillons beauftragten. Gleichzeitig wollte auch die Handelsorganisation (HO), der staatliche Einzelhandel, einen Neubau haben. So baute Müther 1966 das Strandrestaurant „Inselparadies“ in Baabe für die HO (Bilder 6-7) und für den Konsum in Rostock-Warnemünde das Restaurant „Teepott“ (Bild 9), das 1968 in Zusammenarbeit mit den Architekten Kaufmann, Pastor und Fleischhauer fertig gestellt wurde. Für das zweigeschossige „Inselparadies“ plante Müther im Erdgeschoss eine Essensausgabe für Strandgänger, im Inneren führte eine Treppe rund um die Stütze der mächtigen Pilzschale (16.8u16.8 m) ins Obergeschoss. Hier konnten die Gäste im Restaurant sitzen und beim Essen über die Ostsee schauen, auch Tanzveranstaltungen fanden hier statt. Heute sind die Betonkonstruktion und die filigranen Stahlrahmen der Fassade noch erhalten, das Gebäude aber findet keinen Nutzer. Gegen die herrliche Lage in einem Ostseeort, direkt am Strand, steht der touristische Nutzen: Die Hauptferienzeit für die Ostsee ist von April bis August, mit acht Monaten „Winterpause“ sind nur wenige Gebäude in den grossen Kurorten wirtschaftlich zu betreiben.
Lange Zeit stand auch der Warnemünder „Teepott“, ein von drei Hyparschalen überdachtes Gebäude, nach der Wende leer, obwohl die Lage an der Strandpromenade und neben der Westmole touristisch höchst attraktiv ist. Erst 2002 konnte er saniert werden, heute finden sich hier verschiedene Restaurants und kleinere Geschäfte. Für diese Aufteilung wurde allerdings der weite, durchgehende Raum geopfert, der früher das „Teepott“-Res-taurant im Obergeschoss ausmachte. Heute hat man im Inneren das Gefühl, das Dach liege auf den eingezogenen Zwischenwänden auf, obwohl es eine frei tragende Konstruktion ist. Die Sanierung bringt, wie Müther sagt, jetzt erst einmal Geld, später könne man die Leichtbauwände ja wieder entfernen. Der Erfolg gibt ihm Recht. Der Bau konnte durch die Nutzung vor dem Verfall gerettet werden.
In den 1980er-Jahren schaffte Müther es, seine Bauten als Devisen exportfähig zu machen. Für den VEB Carl Zeiss Jena, dessen optische Geräte sozialistische Exportschlager waren, baute Müther im Ausland Kuppeln: zunächst ein Raumfahrtzentrum und Planetarium in Tripolis, dafür gab es Öl aus Libyen. Für die Ausführung der Bauten nahm Müther sein bewährtes Team aus der DDR mit. Der Aufwand lohnte sich, es folgten Planetarien für Kolumbien (1982) und Kuwait (1984), eine Moschee in Jordanien (1984) und das Universarium Vantaa in Finnland (1987). Auch die Bundesrepublik erhielt in Wolfsburg eine Zeiss-Sternwarte. Als Komensationsgeschäft lieferte Volkswagen 10000 Golf an die DDR.
Mit dem Ende der DDR wurde es schwerer für Müther, sich gegen die internationale Konkurrenz auf dem Baumarkt zu behaupten. Zudem waren die Kosten für Baustoffe im Verhältnis zu den erfolderlichen Lohnkosten stark gesunken. Die aufwändige Bauweise wurde bis in die späten 1990er-Jahre nur noch vereinzelt eingesetzt, zum Beispiel für ein Planetarium in Algier (1990), eine Kirche in Hannover (1992) und zwei Radrennbahnen für Eisenhüttenstadt und Cottbus. Diese Aufträge in den ersten Nach-Wende-Jahren konnten aber nicht verhindern, dass Müther 1999 den Konkurs seiner Baufirma anmelden musste.
Neue Nutzung gesucht
Heute versucht der Schalenbauer von damals seine Bauten zu retten, beteiligt sich an Sanierungsplanungen oder legt selbst Hand an. Die Schalen stehen noch, und ihre Konstruktion ist statisch unbeschadet. Weil der Schutz seitens der Denkmalbehörden fehlt, verfallen die Fassaden, der Ausbau wird durch Vandalismus zerstört. Zum akuten Verfall seiner Bauten sagt Müther sarkastisch: „Immerhin ein Härtetest, den die Schalen trotz jahrelangen Leerstands ohne substanziellen Schaden bestanden haben.“ Im Jahr 2000 protestierten renommierte Baufachleute und Historiker gegen den Abriss des völlig intakten Berliner Restaurants „Ahornblatt“. Das Interesse wurde damit sogar in der Tagespresse wieder auf Müthers Bauten gelenkt, der Abriss konnte aber nicht verhindert werden. Jetzt muss der Investor, der das denkmalgeschützte Gebäude zu Gunsten einer klobigen und unattraktiven Blockrandbebauung abgerissen hat, die Aufarbeitung der Baugeschichte leisten und eine Dokumentation über das „Ahornblatt“ finanzieren.
Andere Beispiele zeigen aber, dass auch eine Sanierung und Neunutzung der Schalen möglich ist. In Dresden wurde das ehemalige Ruderzentrum zu einer Sporthalle ausgebaut, die Bauten am Fuss des Berliner Fernsehturms werden für Gastronomie genutzt, der „Teepott“ ist wieder eine Touristenattraktion, und der Strandwachturm in Binz (Bild 10) ist in den Händen seines Erbauers, der ihn liebevoll saniert hat. Die 1968 gebaute Rettungsstation wurde nicht mehr zur Strandsicherung gebraucht. Müther nutzt sie heute als Büro und Vortragsraum, empfängt hier auch spontan Gäste und gibt Interviews. Und der heute 71-Jährige hat immer wieder neue Ideen und Pläne: Im Strandturm gibt es genug Platz für Vorträge, die grossen Fenster können als Projektionsfläche für Filme genutzt werden - die Zuschauer sitzen dann in Strandkörben -, und bald erwartet er die Zulassung zur Standesamt-Aussenstelle für den Strandwachturm.
Müthers Architektur ist ein Kind ihrer Zeit. Die geringe Überbauungsdichte in fantastischen Lagen und die aufwändige Bauweise der Schalen würden sich heute nur schwer rechtfertigen lassen. Umso mehr sollten deshalb die wenigen erhaltenen Exemplare aus der DDR-Nachkriegsmoderne geschützt werden.TEC21, Di., 2006.05.30
Literatur/Anmerkung:
[1] Filmbeitrag „Für den Schwung sind Sie zuständig“. D 2003, 58 Min., vhs@fuerdenschwung.de
[2] Wilfried Dechau (Hrsg.): Kühne Solitäre. Ulrich Müther - Schalenbaumeister der DDR. Buchreihe der Zeitschrift db - deutsche bauzeitung. Deutsche Verlags-Anstalt GmbH 2000 (derzeit vergriffen).
30. Mai 2006 Katinka Corts-Münzner
Siebenfüssler und andere Naturformen
Am 26. Juli wird Heinz Isler 80 Jahre alt. Er hat Hunderte von Schalen gebaut und weltweit Hunderte von Vorträgen gehalten. Seine Welt ist die der Schalen. Deren Möglichkeiten und Grenzen hat er sein Leben lang ausgelotet. Zu Besuch in Islers Schalenwelt, in seinem Büro und Garten.
Islers Welt ist die der Betonschale, der er sein ganzes Berufsleben gewidmet hat. Deshalb erzählt er schon in der ersten Viertelstunde der Begegnung vom wunderbaren Baustoff Beton. Von der Natur, von der Geologie, vom Kies, der unter der Landschaft liegt, durch die er uns auf dem Weg fährt.
Formsuche
Statt uns direkt in sein Büro zu führen, zeigt er eine seiner über 1000 gebauten Schalen, genauer gesagt zehn Schalen, die für eine Gewerbehalle in der Nähe von Burgdorf aneinander gestellt wurden. Das Grundelement besteht aus Islers weit verbreiteter „Industrieschale“, einer 1954 entwickelten Buckelschale. Zuvor hatte Isler sich an der ETH in Zürich zum Bauingenieur ausgebildet. Schon für seine Diplomarbeit entwarf er ein Schalentragwerk. Danach besuchte er für neun Monate die Kunstgewerbeschule, kehrte aber dann zum Ingenieurberuf zurück. Der kurze Umweg zeigt, wie wichtig für Isler ein gesamtheitlicher Blick ist. Stets interessierte er sich für die schöne Form. In der Eingangshalle seines Büros sehen wir später ein selbst gemaltes Bild: Durch den Nebel, der die Themse einhüllt, dringen gleissende Sonnenstrahlen. Ein Licht, das ihn so faszinierte, dass er zum Malkasten griff. So erstaunt nicht, dass er sich mit den Formen der Schalen nicht zufrieden gab, die er als junger Ingenieur kennen lernte.
1995 schrieb er, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts zahlreiche Bauten mit Schalendächern entstanden, aber dass sich „die Schalenformen auf wenige Formtypen beschränkten: Zylinderdächer, zylindrische Schalensheds, Kegelausschnitte, Kugelausschnitte und Hyperboloide“.1 Diese der elementaren Geometrie entlehnten Formen gefielen Isler nicht. Ihre Tragkraft war beschränkt, und sie enthielten meistens Zonen mit Zugspannungen, sodass der Beton Risse erhält und mit einem Dachbelag abgedichtet werden muss. Besonders störten Isler die Geraden. Ein liegender Halbzylinder weise zum Beispiel in der einen Richtung eine Kreisform auf, in der anderen hingegen eine Gerade, also einen Bogen mit unendlichem Krümmungsradius, und es sei bekannt, dass die Krümmungsradien wesentlich über die Qualität einer Schale entscheiden würden. Während seiner zweieinhalb Jahre als Assistent bei Professor Pierre Lardy hatte er den Wert von Modellen für statische Untersuchungen kennen gelernt. 1954 inspirierte ihn sein Kopfkissen zum Bau eines „technischen Kissens“. Er spannte eine Gummimembran in einen rechteckigen Holzrahmen und blies sie auf. Das war seine erste Methode zur Formfindung. Die entstandene Buckelschale war äusserst leistungsfähig. „Damit war der Ausbruch aus den engen Grenzen rein geometrischer Formen geschafft.“
Auf der Buckelschale
Neben solch einer Schale stehen wir nun, und ehe der zurückhaltende Ingenieur viel erklärt, steigt er die Metallstufen am senkrechten Schacht hoch. Das Dach der Gewerbehalle besteht aus einer ruhigen Betonlandschaft (Bild 1). Isler zeigt, dass die 22u22 m überspannenden Schalen am besten über die Diagonale bestiegen werden. Wir sind fast 8 m über Boden, nur 8cm Beton tragen uns. Isler erzählt, wie er die ersten Oberlichter, die später zum Markenzeichen der Industrieschale wurden, eigenhändig habe giessen müssen. Die glasfaserverstärkten Polyesterschalen mit einem Durchmesser von 5 m wurden später in grossen Mengen in Lizenz produziert. Hier oben erklärt uns Isler auch, wie seine anfänglich weissen Betonschalen mit der Zeit grau und schwarz werden „wie Felsen“. Danach heften sich Moos und Flechten an den Beton. Nie dringen sie in die Schale ein, denn diese habe eben keine Risse. Und tatsächlich lässt sich auf diesen nackten Betonkuppeln kein einziger Riss finden. 44 Jahre haben die Schalen auf dem Buckel, und man glaubt Isler gern, dass sie auch noch weitere Jahrzehnte mühelos überdauern werden. Dann führt uns der 80-jährige Schalenbaumeister den „Stampftest“ vor. Er weiss, an welcher Stelle er aufspringen muss, damit die ganze Schale zu vibrieren und zu tönen beginnt. Diesen Test habe er bei jeder Schale gemacht, nachdem man die Holzschalung zuerst 5cm gesenkt hatte und die Schale sich nach dem Betonieren zum ersten Mal selbst trug.
Im Modellgarten
Wir sind „im Schachen“ zwischen Burgdorf und Kirchberg, wo Isler 1964 sein einstöckiges Bürohaus errichtete. Am dreiflügligen, flach gedeckten Bau wandte Isler das gleiche Konstruktionsprinzip an wie bei den Schalen. Die Decke, die sonst durchhängen würde, ist vorgespannt. Durch diesen Druck können an der Aussenfläche keine Risse entstehen. Auch hier bildet nur der Beton die Dachhaut. Inzwischen ist das Flachdach ganz eingewachsen, es musste noch nie saniert werden.
Das Land um sein abseits gelegenes Büro war immer auch ein Testgelände. Hier stehen Kunststoffschalen im Gras wie Skulpturen in einem Park. Man findet beispielsweise ein 1:1-Modell für erdbebensichere Bauten im Iran (1977), die zusammen mit dem Architekten Justus Dahinden entwickelt wurden (Bild 3). Das „Bubble House“ - so würde man es heute nennen - sollte mit einem aufgeblasenen Ballon als wiederverwendbare Schalung gebaut werden. Der Sturz des Schahs setzte dem Projekt ein Ende. Daneben steht das 1:10-Modell der Schale für die Migros in Bellinzona (1964). An diesem 3.40u3.40 m grossen Modell erkennt auch ein in statischen Stärken Ungeschulter die hohe Tragfähigkeit einer Schale: Man getraut sich kaum, die knapp 1cm dünne Zementschale zu berühren, und fürchet, dass sie zerbrechen könnte. Doch die Schale ist hier seit mehr als 40 Jahren unbeschadet Frost, Wind und Wetter ausgesetzt (Bild 4).
Freie Formen
Vorbei an einem Vogelhaus aus einer Kunststoffschale, einem Modell einer Tennisschale, die Isler Ende der 1970er-Jahre entwickelte, betreten wir sein Büro (Bild 2). Zu den besten Zeiten arbeiteten hier 40 Personen, heute begrüsst Isler nur noch Herrn Glanzmann, seinen „Assistenten“, der ihn seit 40 Jahren begleitet. Dieser hat im Hausdienst begonnen, baute Modelle, kontrollierte Armierungen und bildete sich nach und nach zum Ingenieur weiter. Seit Isler einen neuen Beruf hat - er pflegt seine erkrankte Frau fast rund um die Uhr -, ist er nur noch selten im Büro anzutreffen. Deshalb leitet Glanzmann die anstehenden Arbeiten. Letztes Jahr waren das acht neue Industrieschalen in Bubendorf (BL). Trotzdem scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Man kann sich gut vorstellen, wie hier die Ingenieure in den 1960er- und 1970er-Jahren in weissen Kitteln intensiv und gleichzeitig in Keller und Garten an den heute noch vereinzelt herumstehenden Modellen gearbeitet haben.
In den Gängen hängen Bilder von Islers wichtigen Projekten. Er zeigt uns das Gartenzentrum Wyss in Solothurn. Es war 1962 seine erste „freie Form“ - so nennt Isler die Schalen, die er mit seiner zweiten Methode zur Formfindung entwickelte. Die berühmten „Hängeformen“ gehen auf eine Beobachtung auf einer Baustelle zurück: Auf einem Armierungsnetz lag ein Stück Sacktuch. Nass von der vergangenen Nacht, zeigte es die schöne Gestalt der hängenden Form. Bei den folgenden Versuchen „fror“ er jeweils die Formen ein und drehte sie um. „Dabei wechseln die Spannungen das Vorzeichen. Sie gehen vom reinen Zug zum reinen Druck über.“ Später sollte Isler noch an einer dritten Methode arbeiten, an der Fliessmethode. Ziel dabei ist, dass das Material seine eigene Form findet: „selbstwerdende“ Formen, die man nur „richtig starten“ muss.
Isler zeigt uns die Kirche im solothurnischen Lommiswil (1967) und die Autobahnraststätte Deitingen (1968), die vom Abbruch bedroht war und heute geschützt ist. Er erzählt von seiner Mitarbeit an den Sportbauten für die Olympischen Spiele in München (1967-68), von seinem „Siebenfüssler“ für die Fabrikhalle Sicli in Genf (1970), von seinen Dutzenden von Gartencentern, die er in der Schweiz und in Frankreich bauen konnte, und von seiner grössten 54u58 m messenden Buckelschale für das Coop-Verteilzentrum in Wangen bei Olten (1960). Sie überspannt, in der Diagonale und in der Krümmung gemessen, 90 m - mit einer Stärke von 15 cm Beton. „Ist doch verrückt“, sagt Isler selbst.
Modellforschung
In einzelnen Büroräumen stapeln sich Archiv- und Planschachteln. Sie sollen dem Architekturmuseum in München übergeben werden. Was mit Büro und Garten geschieht, ist noch offen. Die Modelle im Keller sollen aber auch in die Pinakothek der Moderne transportiert werden, sobald dort Lagerplatz gefunden ist. Ja, die Modelle: Monatelang wurde an ihnen gearbeitet. Isler blüht auf, wenn er durch den Keller führt, auf die Plexiglasscheiben drückt, um die Wirkung einer Schale zu erläuten, an den unzähligen zusammengehängten Gewichten zieht.
Was hier verspielt aussieht, war jahrelange seriöse Forschung mit eigenen Mitteln. Isler konnte sich bei seinen Neuheiten keinen Fehler leisten. Die grossen Modelle, die ihn bis zu 100000 Franken gekostet haben, dienten dazu, die Grenzen der Schalen kennen zu lernen. Sie zeugen von Islers Gründlichkeit, aber auch von seiner Experimentierfreudigkeit, und sie machen deutlich, dass Isler kein fantastischer Entwerfer, sondern stets auch Baumeister war. Eberhard Schunk redet von der baumeisterlichen Einheit bei Isler.[2] Tatsächlich spricht selbst Isler von einem System. Sie hätten keine Einzelidee entwickelt, sondern sich immer auch mit der Witterung oder etwa mit der Betonmischung beschäftigt. Isler beurteilte die Schalen und kontrollierte die Ausführung. Dafür baute er ein ganzes Netz von Firmen und Zulieferern auf. Er bedauert, dass dieses Know-how langsam verloren geht. Der Architekt Pius Flury zitierte Alberti für Islers Bauwerke: „Eine Figur oder Form ist dann vollkommen, wenn sie ein einheitliches Ganzes bildet, dem man nichts mehr hinzufügen und dem man nichts mehr wegnehmen kann.“[3] Sein Assistent, Herr Glanzmann, fährt uns an den Bahnhof in Burgdorf zurück.TEC21, Di., 2006.05.30
Anmerkungen
[1] Heinz Isler: Schalen der neuen Generation. In NZZ, 8. Februar 1995.
[2] Ekkehard Ramm und Eberhard Schunk: Heinz Isler - Schalen. Ausstellungskatalog, 3. ergänzte Auflage, Zürich, 2002.
[3] Pius Flury: Die Suche nach der perfekten Schale. In: tec21, 49-50/2002.
30. Mai 2006 Ivo Bösch