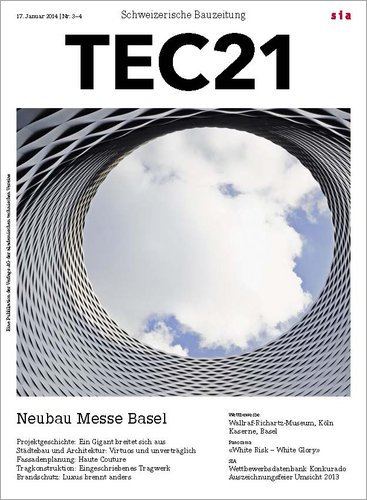Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Wir feiern das 140-jährige Bestehen unserer Zeitschrift, die 1874 unter dem Namen «Die Eisenbahn» das Licht der Welt erblickt hat und seither als «Schweizerische Bauzeitung», «si a» und schliesslich «TEC21» über das Baugeschehen in der Schweiz berichtet. Wir sind stolz, eine solche Tradition weiterführen zu dürfen!
Trotz beachtlicher Ahnengalerie hat sich TEC21 stets erneuert. Wir haben den runden Geburtstag zum Anlass genommen, um die Lehren aus der letztjährigen Leserbefragung und unserer kritischen Selbstbetrachtung umzusetzen. Ab dieser Ausgabe präsentiert sich TEC21 grafisch und inhaltlich aufgefrischt. Unter «Aktuell» sind alle Rubriken mit Nachrichtencharakter versammelt: die Wettbewerbe, das Panorama mit Neuigkeiten aus der Baubranche, die SIA-Seiten, die Vitrine mit News aus der Bauindustrie und der Veranstaltungskalender. Im zweiten Teil des Hefts finden Sie ausführliche Artikel zu einem Thema, das der jeweiligen Ausgabe den Titel gibt. Den Ausklang bilden der Stellenmarkt und die neue Rubrik «Unvorhergesehenes», ein persönlicher Schlusspunkt der Redaktorinnen und Redaktoren.
TEC21 bleibt eine interdisziplinäre Fachzeitschrift für Architektur, Ingenieurwesen und Umwelt – von Fachleuten für Fachleute geschrieben, zeitgemäss und seriös. Etwas pointierter wird sie dennoch. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Entdecken und freuen uns auf Ihre Reaktionen!