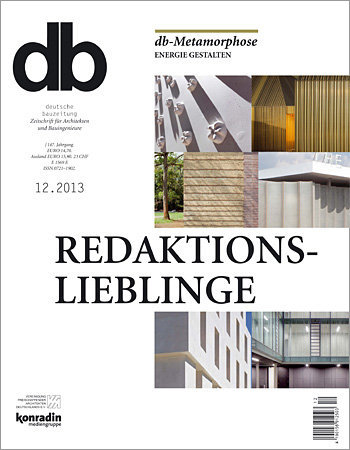Editorial
Oberursel?! Dieter Zetsche ging aufs dortig Gymnasium. Mit ihrem klar strukturierten Neubau wird diese Anstalt sicher noch ganz andere Geister hervorbringen. (S. 42) | Achim Geissinger
London, my love! Zwischen vielen Karbunkeln finden sich dort doch immer wieder kleine Schätze. (S. 50) | Dagmar Ruhnau
In Anbetracht der durchdachten Details und der ausgewählten Materialien meines diesjährigen Schweizer Lieblings bleibt mir gar nichts anderes übrig als in die Kamera zu strahlen. (S. 30) | Martin Höchst
Christine hat mir zwar mein Lieblingsprojekt weggeschnappt, wenige Kilometer davon entfernt fand ich aber ein noch viel schöneres. (S. 36) | Barbara Mäurle
Volker Staabs »Museumsdorf« in Ahrenshoop war auf jeden Fall die weite Reise in die raue Küstenregion am anderen Ende der Republik wert. (S. 22) | Ulrike Kunkel
Es hat sich gelohnt, den Bau des Vorarlberg Museums so lange mitzuverfolgen, Curkrowicz Nachbauer Architekten können nicht nur schöne Holzschachteln. (S. 56) | Christine Fritzenwallner
Gut gerüstet
(SUBTITLE) Erweiterung des Gymnasiums Oberursel
Auf den ersten Blick erweckt der Erweiterungsbau mit seinen klaren Linien und langen Achsen den Eindruck einer strengen Bildungsanstalt nach altem Muster. Im Detail bietet das Gebäude aber eine Vielzahl von Anreizen, die auf subtile Weise dazu verführen, die Wahrnehmung zu schärfen und sich die unterschiedlichen Raumsituationen anzueignen.
Man sieht es diesem Gebäude an, dass ein verständiger Bauherr mit viel Herzblut und Sachinteresse Entwurf und Bauprozess begleitet hat. Die viel gescholtene öffentliche Hand kann so etwas durchaus leisten, und sogar architektonisch unbeleckte Laien: Als es um die Zusammenlegung der drei Standorte des über die Jahre stetig gewachsenen Gymnasiums Oberursel ging, setzte der damalige Schulleiter einen »Arbeitskreis Schulneubau« ein, der Bedürfnisse und Wünsche bündelte und durch die kontinuierliche Begleitung des Bauvorhabens zum kompetenten Partner des Landkreises, des eigentlichen Bauherrn, heranwachsen konnte. Ein kluger Schritt, wollte die Schule doch dezidiert ihre eigenen Schwerpunkte ausbauen, sich gegenüber neuen Strukturen öffnen und sich dabei nicht von Standardlösungen einschränken lassen. Jens Frowerk, ein Mitglied des Lehrerkollegiums, leitet diesen Bauausschuss seit 2006 und lobt die Kreisverwaltung vollmundig als aufgeschlossenes und kooperatives Gegenüber. Und ihm sprüht die Begeisterung aus den Augen, wenn er vom Bauen und vom Ringen um die beste Lösung erzählt. Auch die Architekten sind froh, dass sie innerhalb des klar begrenzten Kostenrahmens (der eingehalten wurde!) zwar nicht in die Vollen gehen, trotzdem aber auf hohem ästhetischen Niveau arbeiten konnten.
Aufgelockerte Strenge
Zur Straßenbahnlinie hin tritt der Neubaukomplex recht unbescheiden mit einem durchgehenden Riegel für die Fachräume auf. Die klare, in eine relativ dunkle »Schutzhaut« aus Glasfaserbetonplatten gekleidete, massiv wirkende Großform erschien so manchem Gemüt allzu beherrschend für die von lockerer Villenbebauung geprägte Umgebung und bedurfte der Erklärung. In Gesprächen über die Vorzüge des Neubaus machten die Vorbehalte aber schnell der Anerkennung Platz. Mit seiner Länge und Ausgestaltung reagiert der drei Geschosse hohe naturwissenschaftliche Trakt sinnfällig auf die Verkehrssituation, betont den Status als Sonderbau und begeht nicht den Fehler, sich wegducken zu wollen. Das hatte der stark untergliederte Altbau von 1913 noch versucht – eine veritable »Penne«, die gestalterisch einen schwer lastenden Heimatschutzstil mit tief herabgezogenen Walmdächern bemüht. Klare Linien setzte Anfang der 90er Jahre ein Erweiterungsbau dagegen; nach außen hin kommt er dem Klischee einer Ortskrankenkasse nahe, erfreut innen aber mit hellen Räumen und einigem zeittypischen Kolorit.
Durch die Investition von insgesamt mehr als 57 Mio. Euro entstand nun, nach dem Abriss verschiedener Pavillonbauten aus den 60er Jahren, ein weiterer Neubau, dessen einzelne Elemente sich nach dem Prinzip einer Stadt in der Stadt um einen annähernd quadratischen, auffallend angenehm proportionierten Hof als zentralem Platz herum gruppieren. Ein aufgeständerter Gang erschließt im Ringschluss alle Bauteile und bildet mit seiner spiegelnden Glasfassade den Gegenpart zu den opaken Ansichten, die den Komplex zur Nachbarbebauung hin abgrenzen. Die bedruckten Scheiben mit ihrem kühlen Minz-Ton lassen den Hof weit und den Himmel darüber besonders groß erscheinen. Teils innen, teils außen aufgedruckte Linien dienen dem Sonnenschutz, ihr Muster erscheint wie ein feiner Vorhang und ergibt beim Vorbeigehen einen lebendigen Rhythmus. Das tut den reichlich streng gestalteten, durch ihren bis zum Maximum geführten Außenbezug aber geräumig wirkenden Erschließungsbereichen gut. Sie sind als Straßen definiert und mit dem Begriff »robust« assoziiert; dazu passt die erfreulich hohe, aber nicht allzu perfekte Sichtbetonqualität von Wänden und Decken.
Zur angrenzenden Einfamilienhausbebauung hin ist die Baumasse in einzelne U-förmige Klassenhäuser mit je einem Innenhof aufgelöst. Die nach unterschiedlichen Themen gestalteten Gartenhöfe bieten Identifikation und ermöglichen Unterricht im Freien.
Innen geht es privat zu: Helle, durch Linoleum, Holzfurnier und einzelne Farbflächen akzentuierte Klassenräume bilden »Gute Stuben«. Zum Flur gibt es wenig, zum Garten hin dafür umso mehr Außenbezug über durchgehende Fensterflächen, deren tiefe Laibung Sitzgelegenheiten bietet.
Zwischen den Fluren tun sich großzügige Ausweitungen auf, die offiziell als Arbeits- und Recherchezonen definiert sind, sich aber am besten als »Quartiersplatz« eignen, zum Sehen, Gesehenwerden, Abhängen, Beobachten, vielleicht auch Lernen, … ganz wunderbare Aufenthaltsbereiche für die Heranwachsenden.
Zu den Materialtönen Weiß, Anthrazit und Wildbirne suchten die Architekten noch fünf gängige Grüntöne für Sonderflächen und Möbel aus, die sich als Leitfarben im gesamten Gebäude wiederfinden und die den Bauausschuss-Leiter Frowerk dazu inspirierten, ein zufällig wirkendes Verteilungsmuster für die Schließfächertüren selbst zu entwerfen – es stellte sich heraus: Gute Gestaltung ist harte Arbeit.
Die unter dem Schulhof tief eingegrabene Dreifeldsporthalle zeichnet sich nach außen nur durch mattierte Glasscheiben und Entrauchungsgitter im Boden ab. Die Oberlichter erscheinen spärlich gesät, lassen bei Sonnenschein aber die ganze Halle tatsächlich auch ohne Kunstlicht taghell werden. Überspannt wird sie von einer Verbundkonstruktion aus ca. 1,5 m hohen Stahlträgern und 16 cm dicken Stahlbetondecken. Ihr Hauptzugang führt entlang der in Trapezblech gehüllten Giebelseite des Verwaltungstrakts (Bestand) in die Tiefe und offenbart mit der bis aufs Äußerste reduzierten Formensprache ein Spezifikum des Oberurseler Gymnasiums: Klare Raumkanten, oberflächenbehandelter Sichtbeton, anthrazitfarbene Geländer, schnörkellose Details und eine beneidenswerte räumliche Großzügigkeit erzeugen einen Eindruck von Erhabenheit, der den hohen Anspruch der schulischen Ausbildung spürbar macht. Von Einschüchterungsarchitektur kann keine Rede sein, den Duft einer höheren Bildungseinrichtung, eine Aura von Bedeutsamkeit verströmen diese Räume dennoch, was sicher auch nicht ohne Einfluss auf die Schüler bleibt.
Eine Steigerung ins fast schon Monumentale lässt sich im sogenannten Musikfoyer erleben, wo die nämlichen Elemente sich zur Galerie mit Ausstellungsvitrinen formen, wo sich der matt-unbestimmte Schein satinierten Glases in den von Hand eingearbeiteten Rillen der Betonwand verliert, in die wiederum mit größter Präzision schmale Türzargen bündig eingelassen sind. Der gestalterische Minimalismus ist hier nicht teuer erkauft, sondern beruht schlicht auf einem sicheren Gespür dafür, mit den zur Verfügung stehenden Elementen richtig umzugehen. Weder die Deckenleuchten noch die zur Schallminderung eingesetzten Lochblech-Baffel machen für sich genommen viel her – zu langen Bahnen zwischen den Betonunterzügen zusammengefasst unterstützt das Gesamtbild aber den festlich-strengen Rahmen, der auf die angrenzende Aula einstimmt. Hier nun spätestens beginnt das Staunen.
Gänzlich in einen gefalteten Paravent aus lasierten Holzplatten gekleidet breitet sich ein gewaltiger Festsaal aus. Er fasst 1000 Personen und damit sogar mehr als die örtliche Stadthalle. Mutig betonten die Architekten seine Hauptdimension, die Horizontale. Von der Glasfassade mit zweiflügeligen Drehtüren kaum gebremst schweift der Blick hinaus auf den Hof, es ergibt sich der Eindruck einer weiten Ebene. Gegenüber öffnet sich ein Bühnenportal, das manches professionelle Theater unbedeutend erscheinen lässt – ganz abgesehen von der allerneuesten Bühnentechnik, die vom Förderforum (Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Oberursel) gesponsert wurde, um dem zertifizierten Status als »Schule mit Schwerpunkt Musik« gerecht zu werden – es kommen vorwiegend Musicals zur Aufführung. Gestalterisch greift auch hier wieder das Phänomen kleiner Kniffe mit großem Effekt: Die leichte Faltung der vorwiegend der Akustik dienenden Holzpaneele macht aus einer Schuhschachtel ein Schatzkästlein, aus dem orthogonalen Raster herausgedrehte Rohrleuchten erzeugen ein Lichtballett. Sicher hätten die zunächst vorgeschlagenen, grünen Stühle noch mehr Lebendigkeit hereingebracht; nach einer Sitzprobe wurde die Wahl der Architekten aber verworfen und durch ein bequemeres Modell in Anthrazit ersetzt. Der Saal wirkt jetzt umso gediegener, was der Zweitnutzung des Raums ein wenig zuwiderläuft: Zur Mittagszeit nehmen hier die Schüler ihre Mahlzeit ein, die – verschließbare – Essenausgabe befindet sich im angrenzenden Flur. Die Doppelbelegung schonte das Budget wie auch der weitgehende Verzicht auf High-End-Produkte. Fassaden und Türen sind guter Standard, so manches Element des Innenausbaus lässt das ästhetische Auge zwar unbefriedigt, wird aber durch den durchdachten Umgang mit Details an anderer Stelle aufgewogen, wie z. B. die Decken-Akustikelemente, die durch ihre exzessive Reihung einen eigenen Raumcharakter und im gesamten Gebäude eine gestalterische Einheitlichkeit hervorbringen.
Einheitlich geregelt ist auch die mechanische Belüftung aller Unterrichtsräume über zentrale Haustechnikanlagen in den UGs, Luft-Erdwärmetauscher und Geothermie liefern Energie, die aktivierten Betondecken lassen sich als Heiz- wie auch als Kühlflächen nutzen, als Richtschnur galt der Passivhausstandard, Regenwasser wird gesammelt, die Flachdächer sind extensiv begrünt.
Zuversicht
Auch wenn die beiden Kernstücke Aula und Musikfoyer nach außen hin erstaunlich wenig in Erscheinung treten, präsentiert sich das gesamte Gebäude nach allen Seiten doch mit einigem Selbstbewusstsein und spiegelt damit den Stolz der Schule selbst wider, der auch in einer dicken Festschrift zum hundertjährigen Bestehen zum Ausdruck kommt. Eine solcherart ausgestattete Lernumgebung würde man Schülern auch andernorts wünschen, wo kein Förderforum mit ehrenamtlicher Hilfe und erklecklichen Summen bereitsteht. Man muss aber sehen, dass das Gymnasium Oberursel nicht nur den Sprösslingen der teuren Wohnlagen am Fuß des Taunus' zur Verfügung steht, sondern auch begabten Schülern aus der ganzen Umgegend bis hinunter nach Frankfurt. Auf dessen Bankentürme können die Schüler beim Erklimmen der Boulderwand hinabschauen und darüber nachsinnen, ob der musische Schwerpunkt, den sie wählten, nicht vielleicht einen Ausweg aus unserem ungleichgewichtigen Wirtschaftssystem weisen kann.db, Mo., 2013.12.02
02. Dezember 2013 Achim Geissinger
Lichtblick
(SUBTITLE) Temporäres Restaurant in London (GB)
Unter dem Dach einer ehemaligen Tankstelle platziert, bietet »The Filling Station« Raum für Gastronomie und Kultur mit Blick aufs Wasser. Material und Konstruktion sind preisgünstig und einfach, schaffen aber dennoch einen poetischen Ort inmitten der wüsten Baustellenlandschaft von King's Cross.
Auf dem Gelände hinter King's Cross, einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Londons, entstehen zurzeit auf 27 ha ehemaliger Gleis- und Schuppenflächen neue Einkaufsstraßen, Bürogebäude und Wohnblocks. Das ehemals verrufene Bahn- und Industrieareal am Kreuzungspunkt von Eisenbahn, Straßen und Wasserwegen (das im 18. Jahrhundert noch ein verträumter Badeort war) wandelt sich zu einem Stück Stadt des 21. Jahrhunderts: sauber, glatt, effizient, mit einem Hauch Nostalgie durch umgebaute Lagerhäuser. Bis 2020 sollen hier 45 000 Menschen leben, arbeiten und studieren. Doch noch steht Kran neben Kran, kaum etwas ist fertig und überall guckt noch das Alte hervor. Am östlichen Rand des Geländes steht ein kleines Gebäude, eingezwängt auf einem dreieckigen Grundstück zwischen zwei breiten Straßen und dem Regent's Canal, der sich erst langsam wieder zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität entwickelt.
Das Gebäude ist tagsüber kaum wahrnehmbar und geht auch bei Dunkelheit trotz Beleuchtung neben der lichtüberfluteten Baustelle und anderen schreienden Lichtinstallationen ziemlich unter. Und doch fällt es auf, indem es den zumeist banalen und plumpen Großbauten eine feine Eleganz entgegensetzt. Die Hülle besteht aus geschwungenen Kunststoffelementen, die in Bögen ungefähr die Form des Grundstücks nachzeichnen. Bei bedecktem Himmel wirkt der Bau rätselhaft, grau wie der alte Straßenbelag und wie eine undurchdringliche Wand. Der weiße Schriftzug »The Filling Station« ist kaum zu lesen und hilft auch nicht weiter, denn hier handelt es sich erkennbar nicht um eine Tankstelle. Doch bei Sonne erscheint auf der Fassade ein zauberhaftes Spitzenmuster; und fällt das Licht von hinten gegen die Elemente, zeigt sich ihre Transluzenz: Unterkonstruktion und Teile der Einrichtung werden als abstrakte Muster sichtbar. Nachts sind die Elemente effektvoll illuminiert, der Schriftzug leuchtet grün. Das Gebäude wird noch zarter und durchlässiger – ganz wie die leuchtende Laterne, die die Architekten beim Entwurf vor Augen hatten.
Verkehrsbau wird Idyll
»The Filling Station« steht tatsächlich auf einem ehemaligen Tankstellengrundstück. Für die Zeit, bis hier Wohnungen entstehen, verwandelte es das Architektenduo Carmody Groarke für die Eventgastronomen von Bistrotheque, bekannt für temporäre Restaurants (s. auch db 9/2010, S. 24), in eine »heiße« Adresse für hippe Londoner. Über dem durch das wechselnde Erscheinungsbild nicht ganz fassbaren, 4 m hohen und 200 m langen Baukörper schwebt das alte Tankstellendach, doch statt der üblichen gerundeten, viel zu dicken Verkleidung zeigt sich nun eine klare weiße, wohlproportionierte Scheibe. Das Grün der Leuchtschrift erinnert an die ehemalige Nutzung durch einen britischen Ölkonzern, dessen alte Tanks sich noch im Boden befinden. Auch das Tankstellengebäude blieb erhalten, mitsamt Ver- und Entsorgungsleitungen. Hier wurde die Küche eingerichtet, im ehemaligen Verkaufsraum bieten weiß eingedeckte Tische Platz für 50 Personen. Um dieses und ein weiteres kleines Gebäude am gegenüberliegenden Ende des Grundstücks entwickeln sich die GFK-Elemente und bilden dazwischen einen kleinen Hof aus, der sich zum Kanal öffnet. Hier wird im Sommer auf Bierbänken gesessen, gegrillt und getrunken, auch kulturelle Veranstaltungen gibt es. Sobald man unter den beiden riesigen Nadelbäumen um die Ecke biegt, vergisst man fast, dass man in London ist. Die Großbaustelle von King's Cross leuchtet zwar durch die Kunststoffpaneele hindurch, doch der Blick geht auf den ruhigen Kanal mit seinen Hausbooten und auf »The Granary«, ein ehemaliges Lagerhaus, das für die University of the Arts um- und ausgebaut wurde (Architekten: Stanton Williams).
Einfachheit mit grosser Wirkung
So raffiniert und vielschichtig die Architekten den Ausdruck und die Wirkung der kleinen »Laterne« gestaltet haben, so einfach und zurückhaltend ist die Konstruktion. Zwischen den GFK-Elementen ist jeweils ein Sperrholz-Schwert angeordnet, die Verbindung erfolgt über Bolzen durch jeweils ein Gelenk und die inneren Flansche der Paneele. Diese Kette wiederum wird gehalten von einer einfachen Gerüstkonstruktion, die als Herzstück und Inbegriff des temporären Baus in Szene gesetzt wird: Durch Sonnenlicht am Tag und gezielte Beleuchtung nachts zeichnen sich die Schatten der Rohre auf der geschwungenen Fassade ab.
Der Schriftzug erinnert übrigens nicht zufällig an amerikanische Diner der 50er Jahre. Das gesamte Konzept folgt dieser Richtung, allerdings ohne Polsterbänke und mit einem südlichen Einschlag. Von der Palme bis zur Wandbemalung wird eine dezent »mexikanische« Atmosphäre hergestellt, und die Speisekarte erzählt die Geschichte einer (fiktiven) Dame namens Shrimpy, die von ihren Reisen aus Mexiko die verschiedenen Tortas, Cocktails und v. a. Fischgerichte mitgebracht hat. Und so sitzt man hier und entdeckt im Grauen, Gezackten der Kunststoff-Hülle des Restaurants zu guter Letzt auch noch Ähnlichkeit mit den Schalen von Shrimps und Austern.
Für drei Jahre, bis 2014, hat »The Filling Station« eine Genehmigung, ursprünglich waren nur zwei Jahre geplant. Jetzt im Winter finden nur einzelne Veranstaltungen statt, doch soll das Restaurant ganzjährig für das Publikum offenstehen. So arbeiten die Architekten gegenwärtig an einer Lösung, die den Hof dauerhaft nutzbar macht – ein Vorhang, der vor Kälte schützt, wünschenswerterweise aber die Aussicht nicht verdeckt. Gleichzeitig wird darüber verhandelt, ob sich die Genehmigung um ein weiteres Jahr verlängern ließe.db, Mo., 2013.12.02
02. Dezember 2013 Dagmar Ruhnau
Halt und Sinnlichkeit
(SUBTITLE) Hortgebäude Allenmoos II in Zürich (CH)
Mit dem Umbau und der Erweiterung eines maroden Schulpavillons zu einem Schulhort schufen Boltshauser Architekten ein gelassen ruhendes Gebäude, das unaufgeregte und großzügige Räume für bis zu 100 Kinder bietet. Ein ausgewogenes Spiel zwischen Einfachheit und Komplexität sorgt dabei sowohl für räumliche Klarheit als auch für anregende sinnliche Erfahrungen.
Knapp 15 Minuten dauert die Fahrt mit der Straßenbahn vom umtriebigen Züricher Hauptbahnhof bis zum Bad Allenmoos in Zürich-Unterstrass. Kaum hat man die denkmalgeschützte Freibadanlage (Haefeli Moser Steiger, 1939) mit ihren eleganten und äußerst filigranen Überdachungen und Funktionsbauten passiert, prägt ausschließlich Wohnen das Bild der verkehrsberuhigten Straßen. Mitten durch dieses vorstädtische Quartier mit seiner lockeren zwei- bis viergeschossigen Bebauung führt ein kleiner parkartiger Grünzug. Hier, in Sichtweite zur benachbarten Volksschule und umgeben von Wohnbauten, findet sich der von Boltshauser bis Anfang 2011 grundlegend umgebaute Schulpavillon, der seither als Hort für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren dient.
Das gestreckte eingeschossige Hortgebäude (ca. 63 x 16 m) ruht ganz selbstverständlich und erdenschwer im leicht bewegten Gelände der behutsam ergänzten Grünanlage (Schmid Landschaftsarchitekten, Zürich). Über die ganze Länge seines Flachdachs zieht sich ein kastenförmiges Oberlicht, das zusammen mit der Eingangsnische an der östlichen Stirnseite und den insgesamt sechs ausgesparten Wandabschnitten der Südfassade bereits einen Hinweis auf seine einhüftige innere Organisation gibt. Aufgrund der über die Geschossdecke nach oben gezogenen Fassadenflächen und geschosshohen kastenartig ausgebildeten Fenster ergibt sich ein durchgängig sehr dünner Dachrand, der in einem spannungsreichen Kontrast zur sonstigen Massivität des Gebäudes steht. Dies trägt erheblich zu seiner wohltuend abstrakten Anmutung bei: dimensionslos, ein wenig rätselhaft, archaisch. Inmitten der mehr oder weniger gelungenen Wohnbebauung ringsum behauptet es so freundlich aber bestimmt seine Sonderstellung.
Besetzt und vernachlässigt
Die souveräne Ausstrahlung des Gebäudes lässt seine bewegte Vergangenheit beinah vergessen: In den 50er Jahren als Erweiterung der benachbarten Volksschule, eher zweckmäßig als gestalterisch hochwertig, mit fünf Unterrichtsräumen errichtet, sollte es 2002 nach einem Jahr des Leerstands schließlich dem Neubau eines bis zu viergeschossigen Schulgebäudes weichen. Der Widerstand der Anrainer gegen das Projekt – durch sämtliche juristischen Instanzen hindurch – verhinderte jedoch dessen Realisierung. 2009 schließlich, nach einer zwischenzeitlichen Hausbesetzung, schrieb die Stadt Zürich in Anbetracht des steigenden Bedarfs an Hortplätzen einen Wettbewerb unter drei eingeladenen Büros zur Umnutzung und Sanierung des Pavillons aus. Boltshauser Architekten überzeugten mit ihrem Konzept, in Grundriss und Volumen des Bestands eher zurückhaltend einzugreifen. Die angedachte behutsame Sanierung entwickelte sich jedoch v. a. aufgrund der für heutige Schneelastrichtlinien zu schwach dimensionierten bestehenden Dachkonstruktion zu einem »Beinah-Neubau«. So entstand auf dem erhaltenen UG, abgesehen von ein paar verbliebenen Raumwänden, eine neue Stahlbetonkonstruktion, die den Außenkanten des Vorgängergebäudes weitgehend folgt. Lediglich nach Westen wurde das Bauvolumen um eine Raumachse verlängert und entlang der Südfassade um einen überdachten Außenbereich erweitert.
Gebrannt oder gestampft
»Ein ganz wesentlicher Punkt, der zur ungewöhnlich hohen Akzeptanz v. a. auch bei Erziehern und Eltern führt, ist die als vertraut empfundene Materialität«, so Projektleiter Daniel Christen von Boltshauser Architekten. Ton, ob gebrannt als Bekleidung aus Klinkerplatten oder als Stampflehm wie an den Stützen der Südfassade bestimmt das Äußere des Horts. Stampflehm-Fachmann Martin Rauch musste sich schon aus Kostengründen mit der Errichtung der mächtigen U-förmigen Außenstützen begnügen, die in ihren verschließbaren Nischen Freiluftspielgeräte aufnehmen. Eingelegte horizontale Reihen schmaler, leicht auskragender Klinkerplatten, deren Abstände sich von oben nach unten zunehmend verkleinern, dienen als Tropfnasen, um starke Auswaschungen des Lehms zu verhindern. Die vom Bauherrn befürchtete Beschädigung des weichen Materials durch Kinderhand hat sich bislang nicht eingestellt, vielleicht weil sich in der Betrachtung und Berührung der archaisch anmutenden Bauteile ganz unvermittelt ein gewisser Respekt einstellt.
Die von den Architekten ursprünglich gewünschte Vormauerschale der Außenwände aus dem »Kolumba-Klinker« ließ sich nicht durchsetzen. Die aufzuwendende Graue Energie und die Kosten für diesen Wandaufbau erschienen dem Bauherrn nicht angemessen. Nach vielen Diskussionen unter den Architekten aber auch mit der Stadt Zürich kam eine eigens hergestellte nur 2 cm dicke Variante des ursprünglich favorisierten Ziegels zum Einsatz, die, nicht vermauert sondern um 90° gedreht, auf die Wärmedämmung geklebt und anschließend verfugt wurde. Gerade weil auf eine Verlegung in versetzten Stoßfugen verzichtet wurde und auch die Außenecken sowohl die Materialstärke und als auch die Verarbeitung deutlich erkennbar machen, enttäuscht dieser Kompromiss nicht. Das beträchtliche Ansichtsformat der Platten von 52,8 x 10,8 cm und die sichtbaren Spuren ihrer handwerklichen Herstellung, wie leichte Verformungen und Fingerabdrücke, sowie die präzise Verarbeitung führen zu einer solch hohen Wertigkeit der Klinkerbekleidung, das sie selbst im Zusammenspiel mit den Stampflehmoberflächen zu überzeugen vermag.
Verschränkt und verbunden
Die nach innen versetzte einzige Öffnung der östlichen Stirnseite mündet im Windfang, der mit Kunst auf die kindlichen Nutzer des Gebäudes sympathisch beiläufig verweist: Ausgewählte sich teilweise überlagernde kleine Figurenumrisse – gezeichnet von Hortkindern in einem Workshop mit den Künstlern Marta Rauch-Debevec und Sebastian Rauch – wurden auf keramischen Wandfliesen verewigt und heißen nun den Eintretenden willkommen. Ein heller über 40 m langer Raum schließt sich an und macht die eigentlichen Dimensionen des Gebäudes deutlich. Bei durchschnittlich 4 m Breite herrscht dennoch nicht die Atmosphäre eines Flurs, da die Planer die vermeintlich ungünstigen Proportionen mit gut platzierten Fensteröffnungen in der Nordfassade und Aufweitungen nach Süden unter dem Oberlicht gliedern. Hier kann das zenitale Licht gar über Wandabschnitte aus Glasbausteinen in die Schul- und Betreuungsräume im Süden fallen und bietet zudem ein Spiel mit Transparenzen. So weitet und verengt sich der lange Raum, erhält mal zenitales Licht oder bietet Ausblicke und entwickelt dabei eine Aufenthaltsqualität, die der Nutzungsflexibilität im Hortalltag zugutekommt.
Die sechs großzügigen Räume entlang der Südfassade – für Unterricht sowie Hortbetreuung und ganz im Westen die professionelle Küche mit Edelstahleinbauten – werden sowohl abschnittsweise über das Oberlichtband als auch über jeweils ein beeindruckend großes (ca. 6 x 3 m) Fenster nach Süden mit Tageslicht versorgt. Mit tiefen mittelgrauen Metalllaibungen, die auch die Türflügel bündig in sich aufnehmen, gefasst und flankiert von den Stampflehmstützen des überdachten Freibereichs präsentiert sich der kleine Park wie auf einer Bühne. Wenn zudem noch der textile Sonnenschutz in Fenstergröße langsam herunter gleitet, wirkt es, als ob sich ein Bühnenvorhang nach einer Theatervorstellung senkt.
Der ockerfarbene fugenlose Lehm-Kasein-Bodenspachtel, der durchgängig auf den Estrich aufgebracht wurde, soll, ebenso wie der unbeschichtete Lehmputz – im Erschließungsbereich blau pigmentiert – zu einem gesunden Raumklima beitragen. Der Einsatz dieser ökologisch sinnvollen Materialien kostete die Architekten jedoch viel Überzeugungsarbeit. Die Robustheit der Oberflächen scheint sich bisher bewährt zu haben und zudem verleiht ihre sichtbare Handwerklichkeit dem ansonsten sehr geradlinig gestalteten Inneren eine wohltuende Dosis an »Unvorhersehbarem«. Feinsteinzeugfliesen rund um die schwarzen Waschtische der Zahnputzecken und als Bodenbelag der Küche sowie Messingleisten an den Deckenleuchten ergänzen den überraschend vielstimmigen Materialkanon der Innenräume. Und dennoch, dank sorgfältiger Platzierung und Gewichtung kann ein klares Gesamtbild entstehen.
Dreifachverglasungen, dicke Wärmedämmschichten und die kontrollierte Lüftung lassen den Totalumbau den Minergie Standard für Neubauten erreichen. Energetisch ist der Hort also bestens für die Zukunft gerüstet. Die nicht minder zukunftsfähige Gestaltung des Gebäudes, die ohne die sehr sorgfältige Detaillierung nicht zu erreichen gewesen wäre, ist dem Blick der Planer für das Beständige, das Kindern wie Erwachsenen sowohl Aneignung als auch sinnliche Erfahrung erlaubt, zu verdanken. Als öffentlich genutztes Gebäude mit überzeugend eigenständiger Architektur leistet der Schulhort von Boltshauser einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung des ganzen Quartiers – wie schon seit 1939 das benachbarte Bad Allenmoos.db, Mo., 2013.12.02
02. Dezember 2013 Martin Höchst