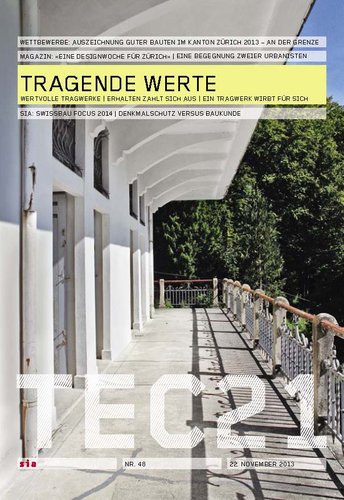Editorial
Protagonist dieser Ausgabe von TEC21 ist das bestehende Tragwerk. Es als zentrales Thema aufzunehmen ist naheliegend, denn meist ist es einmalig und schon allein deshalb beachtenswert. Es ist aber auch effizient, funktionstüchtig, hoffentlich formvollendet, oftmals konstruktiv interessant und – nicht zu vergessen und zu unterschätzen – durchaus fotogen. In den Räumen zwischen den bestehenden Tragwerken werden Fotoshootings gemacht; Fotografen setzen Models vor Sichtbetonpfeilern in Szene. Die raue und doch stimmige Atmosphäre zieht Musikbands an, die zu ihrem Song einen Videoclip drehen möchten. Ein freigelegtes Tragwerk scheint dazu beizutragen, etwas und jemanden ins rechte Licht zu stellen. Selten aber steht unser Protagonist selber im Mittelpunkt, und wenn er denn einmal von Fotografen in den Fokus gerückt wird, dann kaum wegen seiner ingenieurspezifischer Charakteristika.
Diese lichten die Bauingenieure selbst ab – oft ohne Gespür für ein attraktives Bild. Für sie soll das Foto vielmehr informativ und nützlich sein.
Ingenieurspezifisch interessante und sehenswerte Details lassen sich durchaus attraktiv fotografieren. Fotografen, die das können, sind allerdings selten; die Szene steckt noch in den Kinderschuhen. Die Situation ist vergleichbar mit einem Erlebnis, das Robert Bösch, Bergsteiger und Berufsfotograf, kürzlich in seinem eindrücklichen Vortrag «Passion für Berge» in Oberägeri schilderte: Bei seinem ersten Fotoauftrag musste er sich von einem Cheflayouter sagen lassen, er sei wohl ein ausgezeichneter Bergsteiger, der nebenbei fotografiere; sein Kollege hingegen – der ein ausgezeichneter Fotograf ist und nebenbei zu Berg geht – liefere zumindest brauchbares Bildmaterial. Wie die Bergfotografie wird sich auch die Tragwerksfotografie weiterentwickeln und zu einer ausgereiften Berufsgattung avancieren. Dies bleibt zumindest zu hoffen, denn unser Protagonist zeichnet sich durch Eigenheiten aus, die es wert sind, herausgestellt zu werden, um sie der Öffentlichkeit zu zeigen.
Lesen Sie in «Wertvolle Tragwerke», in «Erhalten zählt sich aus» und insbesondere in «Ein Tragwerk wirbt für sich», was bestehende Tragwerke auszeichnet. Mit der Villa Hauteroche in Le Pont VD hat TEC21 eine echte Trouvaille aufgespürt, die als eine kleine Sensation betrachtet werden darf. Lassen sie sich von der Wirkung und Ausstrahlung inspirieren, die ein Tragwerk haben kann.
Vielleicht können die Artikel dazu beitragen, die Wertschätzung von bestehenden Tragwerken zu steigern.
Clementine van Rooden
Anmerkung:
Die Gesellschaft für Ingenieurbaukunst veranstaltet Ende Februar 2014 eine Exkursion zur Villa Hauteroche. Details dazu finden Sie demnächst auf www.ingbaukunst.ch
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Auszeichnung guter Bauten im Kanton Zürich 2013 – an der Grenze
08 PERSÖNLICH
«Eine Designwoche für Zürich» | Ämter und Ehren
10 MAGAZIN
Adventsverlosung auf | Studie: Klimawandel im urbanen Raum | AS: «Eine Furche ziehen für die Kultur» | Eine Begegnung zweier Urbanisten | Design Preis Schweiz
16 WERTVOLLE TRAGWERKE
Clementine van Rooden
Bestehende Tragwerke werden in vielerlei Hinsicht verkannt. Es ist an der Zeit, sie differenziert zu achten.
18 ERHALTEN ZAHLT SICH AUS
Paul Lüchinger
An drei Beispielen aus seiner jahrelangen praktischen Tätigkeit erläutert der Autor, welche materiellen Kriterien jeweils für einen Erhalt des Tragwerks sprachen.
21 EINTRAGWERK WIRBT FÜR SICH
Eugen Brühwiler
Die Villa Hauteroche in Le Pont am Lac de Joux ist eine Trouvaille unter den bestehenden Tragwerken. Für die Schweiz ist sie eine bautechnische Pionierleistung sondergleichen.
27 SIA
Neue Vorstandsmitglieder | Swissbau Focus 2014 | Umgang mit Widersprüchen | Denkmalschutz versus Baukunde | Direkt-Link zu SIA-Form-Kursen
30 MESSE
neue räume 13, Zürich
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Wertvolle Tragwerke
Tragwerke sollten nicht unbesehen rückgebaut werden. Zu oft gehen materielle und immaterielle Werte verloren: eine Substanz, die ihre endgültige Lebensdauer noch nicht erreicht hat, ein Zeitzeuge, eine Konstruktionsart oder ein bautechnisches Vorbild. Weil bestehende Tragwerke aber veraltet und vielleicht sogar marode erscheinen können, unterschätzen oft selbst Fachpersonen ihr Potenzial – trotz vorhandenen Regelwerken zu ihrer Einschätzung. Es ist an der Zeit, Tragwerke differenziert zu betrachten.
Das Spektrum der Begründungen, ein Tragwerk zu erhalten, ist breit. Ebenso zahlreich sind allerdings oft die Argumente dafür, es rückzubauen. Baubeteiligte schrecken vor allem vor allfälligen Überraschungen zurück, die eine bestehende Bausubstanz birgt und die während der Umbauphase zutage treten können. Die Gebäudesubstanz – und im Speziellen auch das Tragwerk – lässt sich aber immer objektiv analysieren. Nicht selten sprechen die Erkenntnisse in mancher Hinsicht für eine Erhaltung – einschliesslich immaterieller und emotionaler Gründe (vgl. «Erhalten zahlt sich aus», S. 18).
Breite Palette der Werte
Jedes Tragwerk hat seine Qualitäten und seine Minderwertigkeiten. Nach diesen gilt es zu suchen, wenn ein bestehendes Tragwerk auf seinen Erhaltenswert hin analysiert wird. Das Merkblatt 2017 des SIA[1] gibt dafür eine Checkliste, wobei die Kriterien in immaterielle und materielle Werte gruppiert werden. So gehen die wichtigsten Bewertungsfaktoren nicht vergessen – zu denen auch die immateriellen gehören. Wenn Experten – meist Bauingenieure – aber ein Tragwerk in seinem individuellen Kontext und mit den für seine Auslegung spezifischen Rahmenbedingungen beurteilen, ergibt sich der Erhaltenswert nicht aus fix festgelegten und stets gleich definierten Kriterien. Vielmehr sind die einzelnen Faktoren immer wieder neu zu bestimmen, zu ergänzen und zu gewichten. Es kann durchaus sein, dass ein einziges das Tragwerk auszeichnendes Merkmal für die Erhaltung entscheidend ist. Vielleicht ist die Tragkonstruktion weder schön noch effizient oder wirtschaftlich tragbar, aber sie ist ein beispielhafter Zeuge ihrer Zeit oder die letzte Ausführung in dieser Art – dann ist das unter Umständen Grund genug, sie zu bewahren. Ebenso, wenn ihre Formgebung, ihre Materialisierung oder ihr statisches System ihrer Zeit voraus oder für die Zeit typisch war oder wenn ihr Erbauer berühmt ist und das Werk – ob im Guten oder im Schlechten – eine gewichtige Arbeit im Gesamtwerk ist (vgl. «Ein Tragwerk wirbt für sich», S. 21). Im einzelnen Fall ist es erhaltenswert, weil das Tragwerk sozusagen einen Lehrpfad an spezifischen, historischen und nicht mehr existierenden Konstruktionsdetails darstellt.
Werte Offenlegen, um sie zu sehen
Das Ziel jeder Beurteilung besteht also darin, die Besonderheiten eines spezifischen Tragwerks mit seinen typischen und charakteristischen Details zu erkennen und seine materiellen und vor allem auch immateriellen Werte offenzulegen[2]. Dadurch wird die dahintersteckende kostbare oder seltene, einmalige oder gewöhnliche, be- oder verkannte Leistung aufgedeckt. Nur so wird man diese bei Eingriffen auch respektieren und nach Möglichkeit bewahren können. Denn erst eine kritische Auseinandersetzung mit dem Tragwerk und seinen materiellen und immateriellen Werten führt zu einer ganzheitlichen Beurteilung des Bauwerks und legt schliesslich sein Entwicklungspotenzial offen.[3]
Ein Bauwerk steht und fällt mit seinem Tragwerk
Auf dieses Entwicklungspotenzial gilt es auch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Ihr muss gezeigt werden – wider den Zeitgeist, sich auf das Aussehen, statt auf den Inhalt zu konzentrieren –, welche Leistung hinter den Tragwerken steckt und welches Handwerk es dazu braucht. Denn auch wenn ein bestehendes Tragwerk unattraktiv erscheint – sei es unansehnlich oder verdeckt, abgenutzt oder überholt, unmodisch oder einfach nur in ein schlechtes Licht gerückt –, sind es schliesslich doch die tragenden Teile, die das Bauwerk zusammenhalten. Die Kunst, ein Tragwerk schlank auszulegen oder mit einer raffinierten Konstruktion oder Technik weite Spannweiten oder ausgeklügelte Details zu ermöglichen, ist eine bemerkenswerte Leistung, die es zu würdigen, schätzen zu lernen und schliesslich auch zu erhalten gilt.
Tragwerke haben Stil und sind fotogen
Tragwerke als Ingenieurbauwerke haben im Übrigen durchaus einen Stil, den es nicht nur kritisch zu bewerten gilt, sondern den es auch fotografisch einzufangen lohnt – wenn man denn ein ingenieurspezifisches Auge dafür hat oder entwickelt. Die oben stehenden Fotos mögen andeuten, welches Potenzial in der Bebilderung von Ingenieurbauwerken noch steckt. Mit attraktiven Fotografien von Rohbauten oder Baustellen zum Beispiel liessen sich vermehrt Emotionen für Tragwerke wecken – einen immateriellen Wert also, der sich – so bitter es sein mag, dass man so argumentieren muss – grundsätzlich auch versilbern liesse, wenn man ihn entsprechend als wertvoll vermarktete. Insofern werden die immateriellen Werte gegenüber den materiellen Werten klar unterschätzt.
Anmerkungen:
[01] B. Schnitter, M. Aczél, H. U. Aeschlimann, M. Diggelmann, C. Haldemann, L. Held, A. Kölliker, N. Ruoss, M. Wohlgemuth: «Erhaltungswert von Bauwerken», SIA-Merkblatt 2017. Zürich, 2000.
[02] Als materielle Werte sind u. a. standort- und nutzungsspe zi fi sche, substanzielle, gesellschaftli - che, wirtschaftliche und/oder umweltspezifische Werte aufzufassen; zu den immateriellen zählen da gegen die situativen, historischen und soziokul - turellen, gestalterischen, handwerklich-techni - schen und/oder emotionalen Werte.
[03] Eugen Brühwiler: «Grundsätze der Denkmal - pflege bei Bahnbrücken» in: Schweizer Bahnbrü - cken. Zürich, 2013, S. 215–220TEC21, Fr., 2013.11.22
22. November 2013 Clementine Hegner-van Rooden
Erhalten zahlt sich aus
Der Gebäudepark, den es auf seine Lebensdauer zu überprüfen gilt, wächst. Ob die Tragwerke der einzelnen Bauten noch dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, ist dabei jedes Mal individuell abzuklären. Das bedeutet: Die Kriterien für einen Rückbau oder eine Erhaltung sind stets spezifisch zu gewichten, denn jedes Tragwerk birgt seine Eigenheiten, die von den projektspezifischen Rahmenbedingungen geprägt sind. Der Autor berichtet aus der Praxis und erläutert kurz drei gebaute Beispiele.
Eigentümerschaften ziehen die Erhaltung ihrer Bauwerke heute viel öfter in Erwägung als auch schon. Es wird aufgestockt, verstärkt, ertüchtigt, restauriert und instandgesetzt. In Ausnahmefällen können betriebliche Einschränkungen angemessen sein, um eine bestehende Substanz zu erhalten. Diese Situation basiert einerseits auf der florierenden Bautätigkeit in den 1960er- und 1970er-Jahren und andererseits darauf, dass sich die Ansprüche der Eigentümerschaften, der Betreiber und der Gesellschaft insgesamt verändert haben. Spätestens mit der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls 1997 wurde die nachhaltige Entwicklung im Allgemeinen und des Bausektors im Speziellen zum Langzeitziel der globalen Politik erhoben.
Erhaltung erhält zunehmend mehr Bedeutung
Im Sinn eines schonenden Umgangs mit natürlichen Ressourcen ist es tabu, den Fokus nur auf Neubauten und Ersatzneubauten zu legen. Setzen sich die am Bau Beteiligten mit der bestehenden Bausubstanz auseinander, beurteilen sie ihren materiellen und immateriellen Wert und erhalten sie dann begründet die Tragwerke, leisten sie einen wesentlichen Beitrag an die Nachhaltigkeit (vgl. «Wertvolle Tragwerke», S. 16). Letztlich entscheidet aber die Eigentümerschaft, ob und in welcher Weise bestehende Bauwerke – Hochbauten oder Infrastrukturanlagen – weiterhin genutzt und welche Strategien verfolgt werden sollen. Denn neben statisch-konstruktiven Aspekten geben vor allem auch andere, vom Tragwerk losgelöste Punkte den Impuls zur Überprüfung. Diese müssen von Fall zu Fall eigens abgeklärt werden.
Beispiel 1: Flughafen Zürich Dock B
So sprachen beim Umbau des Terminal B des Flughafens Zürich (vgl. Kasten, Abb. 01 und TEC21-Dossier, April 2012) vor allem betriebliche Rahmenbedingungen dafür, das bestehende, knapp dreissig Jahre alte Tragwerk in Stahl-Beton-Verbundbauweise zu erhalten. Der Rückbau des bestehenden Stahlskelettbaus und der Wiederaufbau eines neuen Tragwerks hätten bei den Zufahrten zum Flughafen und im Flugvorfeld zu grossen logistischen Problemen geführt. Die Bauingenieure überprüften im Rahmen von Ortsbegehungen, Massaufnahmen und Sondierungen die vorhandenen baulichen Verhältnisse, und sie analysierten die bestehende Substanz, nachdem das Gebäude bis auf das Tragwerk rückgebaut war. Bis auf wenige Ausnahmen attestierten sie ihm einen einwandfreien Zustand. Weitere Untersuchungen führte das Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich durch. In einer umfangreichen grossmassstäblichen Versuchsreihe unterzog es die bestehenden Holorib-Blechverbunddecken vielseitigen Belastungsprüfungen, insbesondere im Hinblick auf das Verbundverhalten und die Tragfähigkeit nach längerer Nutzungsdauer. Zur Verfügung stand hierfür ein für den Rückbau bestimmter Gebäudeteil. Nach eingehender Überprüfung empfahlen die Bauingenieure, das Tragwerk des Terminals B auch aus statischer Sicht zu erhalten. Vergleiche der Kosten und der Termine unterstützten den Entscheid zur Erhaltung und Ergänzung mit neuen Bauteilen gegenüber einem Ersatzneubau zusätzlich. Die Vorteile aus betrieblicher, statischer, ökonomischer und terminlicher Sicht wogen die Einschränkungen der Flexibilität für die neue Gebäudetechnik bei Weitem auf.
Beispiel 2: Geschäftshaus Hohlstrasse Zürich
Die Beantwortung der Frage, inwiefern bestehende Bauwerke auch nach einer längeren Nutzungsdauer den ursprünglichen oder gar neuen Anforderungen aus allen Fachbereichen wie eben der Gebäudetechnik oder der Architektur noch genügen oder inwiefern diese Anforderungen allenfalls herabgesetzt werden müssen, ist zentral, um zu entscheiden, ob ein Tragwerk erhalten werden kann oder nicht. Das Geschäftshaus an der Hohlstrasse in Zürich (vgl. Kasten) sollte beispielsweise architektonisch aufgewertet, gebäudetechnisch erneuert und aufgestockt werden. Dieselben Bauingenieure überprüften hier also, ob der bestehende klassische Betonskelettbau die zusätzlichen Geschosslasten der Aufstockung würde aufnehmen können und ob die Tragsicherheit gegenüber Erdbeben gesichert wäre. Nur wenige tragwerksspezifische Eingriffe waren schliesslich notwendig, um das Tragwerk so zu ertüchtigen, dass es den neuen Anforderungen entsprach und den neuen Einwirkungen standhielt. Insbesondere mussten lokal der Durchstanzwiderstand und der Biegewiderstand im Randbereich der Abfangdecke über dem Erdgeschoss erhöht werden, was mit Stahlmanschetten bzw. mit einem Überbeton bewerkstelligt wurde (Abb. 02). Des Weiteren schloss man die Dilatationsfuge, die das Gebäude in zwei Teile trennte, um die Anforderungen der aktuell gültigen Normen bezüglich Erdbeben zu erfüllen. Diese statische Verbindung auf allen Geschossebenen stand im Einklang mit dem Konzept der architektonischen Neugestaltung des Treppenhauses.
Beispiel 3: Wohnüberbauung Gutstrasse Zürich Architektonische Gründe gaben auch im dritten Beispiel den Impuls für eine Abklärung des Erhaltenswerts des Tragwerks, allerdings mit ganz anderen planerischen Voraussetzungen. Das 16-geschossige Wohnhochhaus an der Gutstrasse in Zürich (vgl. Kasten und Abb. 03) – eine reine Mauerwerksbauweise – sollte noch während einer geplanten Restnutzungsdauer von rund 15 Jahre dienen, und es stellte sich daher die Frage, ob ein Rück- und Neubau absehbar war. Die Bauingenieure nahmen ausführliche statische Abklärungen vor, insbesondere hinsichtlich der Tragsicherheit gegenüber Erdbeben. Die Überprüfung musste allerdings ohne Ingenieurpläne, Berechnungen und Berichte aus der Zeit der Erstellung des Gebäudes erfolgen, denn trotz intensiver Nachforschungen konnten keine Bauwerksakten ausfindig gemacht werden. Die Bauingenieure machten Sondierungen, entnahmen Proben und führten Baustoffprüfungen an grosskalibrigen, d.h. sechs Mauerwerksschichten hohen Prüfkörpern durch. Erst mit diesen ausführlichen und aufwendigen Untersuchungen konnte eine Grundlage geschaffen werden, um sich für oder gegen den Erhalt des Tragwerks zu entscheiden. Dieses genügte auch in diesem Fall den Anforderungen und konnte erhalten bleiben. Die gebäudetechnischen Installationen wurden erneuert und die Fassaden aufgefrischt.
Getrennte Subsysteme helfen zu erhalten
Nicht zuletzt zeigt sich bei allen drei Beispielen, was allgemein gilt: Die Subsysteme Tragwerk, Gebäudehülle, Gebäudetechnik sind je mit ihrer unterschiedlichen Nutzungs- und Lebensdauer konsequent getrennt voneinander entwickelt und ausgeführt worden. Es waren keine bedeutenden gebäudetechnischen Installationen im Tragwerk integriert. So kann für jedes Subsystem eine eigene termingerechte Erhaltens- oder Rückbaustrategie entwickelt werden. Diese konsequente Trennung kann den Erhalt des Tragwerks erleichtern.
Immer wieder neue Umstände
Letztlich stützt sich die Entscheidungsfindung aber nicht nur auf das bestehende Konstruktionsprinzip, sondern auch auf die Verhältnismässigkeit des gesamten Erhaltensprojekts und der erforderlichen Massnahmen. Hier spielen die Sicherheitsanforderungen, Verfügbarkeit des Bauwerks und das Schadensausmass bei einem Einsturz ebenso eine gewichtige Rolle wie – ganz im Sinn der Nachhaltigkeit – der kulturelle Wert. Wie die einzelnen Kriterien gewichtet und gewertet werden, gilt es projektspezifisch abzuklären und mit aktualisierten Informationen zu überprüfen. Die Entscheidungsfindung ist in jedem Fall von grosser Tragweite. Denn im Gegensatz zur Projektierung von Neubauten können unausgewogene Entscheide Sprungkosten auslösen und insbesondere auch aus Sicht der immateriellen Werte verheerend sein. Bei fachgerechtem Vorgehen sollte aber ein Entscheid – ob Erhalt oder nicht – in jedem Fall zu einem technischen, ökonomischen und ökologischen Gewinn führen.TEC21, Fr., 2013.11.22
22. November 2013 Paul Lüchinger