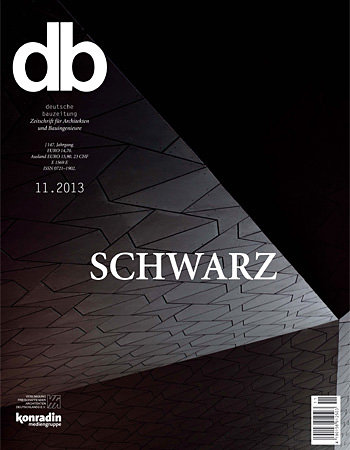Editorial
Architektur, die sich der am stärksten lichtabsorbierenden Farbe Schwarz bedient, demonstriert ihre Präsenz – falls nicht landschaftlich oder ortstypisch verankert – in einem für gewöhnlich nichtschwarzen baulichen Kontext. Sehgewohnheiten von Nutzern und Passanten werden infrage gestellt, was regelmäßig zu Diskussionen über die Angemessenheit der Farbwahl führt. Umso entscheidender ist also eine sorgfältige Auseinandersetzung mit Materialisierung und Detaillierung sowie der daraus resultierenden Farbqualität des jeweiligen Schwarztons. Die vorgestellten sehr unterschiedlichen Projekte zeigen, dass sich die Mühe lohnt. Von futuristisch bis traditionell, von elegant bis archaisch: Schwarz kann, sensibel eingesetzt, Gebäude in vielen Facetten zum Leuchten bringen. | Martin Höchst
Eleganz im Gewerbehof
(SUBTITLE) Erweiterung des Medienpool Waterloohain in Hamburg
In einem innerstädtischen Gewerbehof schuf Architekt Carsten Roth einen Bürobau, der nachverdichtend ein Stück Stadtreparatur leistet. Sein schwarz-schimmerndes Fassadenkleid verbindet dabei Understatement mit komplexer Anmut.
Über zehn Jahre ist es her, dass die Hamburger Kommunikationsagentur fischerAppelt den Architekten Carsten Roth mit dem Umbau eines unscheinbaren Produktionsgebäudes der späten 50er Jahre im Hamburger Stadtteil Altona-Nord beauftragte. Damals war diese Gegend westlich des Szenestadtteils Schanzenviertel noch ein Geheimtipp, in dem man relativ günstig innerstädtisch wohnen oder seinem Gewerbe nachgehen konnte. Die Kreativ- und Werbebranche wird von Fabrikbauten ja geradezu magisch angezogen, vorausgesetzt, sie sind alt und besitzen Patina. Die Gebäude am Waterloohain aus den späten 50er und frühen 60er Jahren wurden somit links liegen gelassen, bis Carsten Roth und fischerAppelt ihr Potenzial entdeckten. Zunächst baute der Architekt den unauffälligen ockerfarbenen Klinkerbau Waterloohain 5 um und stockte ihn auf.
Es war diese weithin sichtbare Ergänzung, die mit ihren Winkeln und Asymmetrien, v. a. aber mit ihrer ungewöhnlichen, changierenden Farbigkeit die Konventionen Hamburger Bauens verließ und damit irritierte. Transparentes und verspiegeltes Glas und polyspektral beschichtetes Edelstahlblech, matt, glänzend oder gelocht, trafen hier zu einem Wunderwerk der optischen Täuschung zusammen, der Moderne verpflichtet und doch vielfältig lesbar. 2003 folgte der Umbau eines weiteren, vormals als Kegelcenter und Klubhaus genutzten Gewerbebaus zum Bürohaus, das der Bauherr an Medien- und Werbeagenturen sowie an Designbüros vermietet. Die angegriffene Betonfassade ließ Roth durch eine transluzente Industrieglashülle austauschen und eine zusätzliche Etage obenauf setzen, wiederum mit polyspektral-rot beschichtetem Edelstahl bekleidet.
Doch auch damit war der Umbau des innerstädtischen Gewerbegebiets zum »Medienpool Waterloohain« noch immer nicht zu seinem Ende gekommen. So widmete sich das bewährte Team aus Bauherr und Architekt nun einem Neubau als Ergänzung des Hauses Waterloohain 5.
Schwarz und schwebend
Waterloohain 5+ genannt, wird das neue Bürogebäude nur in der obersten Etage von der Agentur selbst belegt und im Übrigen an Medienfirmen vermietet. Da der Bebauungsplan lediglich vier statt der vom Bauherrn gewünschten fünf Etagen erlaubte, wurde das als Garage genutzte offene EG eingegraben und ragt nun die für Keller maximal zulässigen 1,40 m aus dem Erdboden. Ein schöner Nebeneffekt ist die daraus resultierende schwebende Anmutung des Hauses. Die Ausrichtung seiner Fassaden orientiert sich an der Stellung benachbarter älterer Gebäude, aber auch an der Aufstockung des Altbaus. Dadurch steht es in einem leichten Winkel zum bestehenden Gelbklinkerbau und rückt an seiner Südseite ganz nah an ihn heran – getrennt zwar durch eine schmale Fuge, zugleich jedoch verbunden mittels eines Übergangs, der in das Treppenhaus des Altbaus mündet. Städtebaulich übernimmt der neue Baustein im Ensemble eine wichtige Funktion, denn der viel zu weite und indifferente Straßenraum des Doormannsweg erhält durch ihn wieder eine Fassung. Carsten Roth hat die Aufgabe mit Bravour bewältigt, einen ganz eigenständigen Anbau zu gestalten, der dennoch nicht seinem Nachbarn die Show stiehlt.
Ausschlaggebend hierfür ist die Farbe. Wie schon bei den Aufstockungen und Treppenhausverkleidungen der beiden Altbauten verwendete Roth auch hier an den Fassaden mittels Galvanisierung polyspektral gefärbten Edelstahl, statt in Rot hier allerdings in Schwarz. Der Grund erschließt sich sofort: Dank seines dunklen Kleids tritt der Neubau nicht in Konkurrenz zum älteren Nachbarn. Das Schwarz erhielt jedoch einen leichten Rotstich, wodurch eine Verbindung zur Aufstockung des Altbaus hergestellt wurde – so subtil, dass man es erst auf den zweiten Blick bemerkt.
Die drei Glasfassaden des Neubaus sind von einer unregelmäßigen Struktur vertikaler Lamellen – Roth nennt sie Finnen – unterteilt. Diese je nach Geschoss und Fassadenseite unterschiedlich gedrehten Lamellen dienen als Sicht- und Sonnenschutz, verleihen der Fassade jedoch auch Tiefe und Rhythmus. Die unterschiedlichen Abstände der Finnen führen – besonders in der Schrägsicht – mal zu mehr geschlossen oder eher geöffnet anmutenden Fronten. Und wie nebenbei erhalten die Fassaden durch das je nach Geschoss unterschiedliche Stakkato der Lamellen eine ganz klassische horizontale Dreiteilung, da die mittleren beiden Etagen formal geeint zusammenwirken. Die Komplexität wird noch gesteigert durch unterschiedliche Auskragungen und Winkel einzelner Fassadenteile. Sie sind nie willkürlich gewählt, sondern von Gebäudefluchten und -höhen der Umgebung abgeleitet. Letztlich entsteht eine penibel detaillierte und raffinierte Textur, die Vergleiche mit der Haute Couture nahelegt – auch in der Farbqualität. Die alte Erkenntnis der Schneiderzunft, dass ein gänzlich schwarzer und matter Stoff leblos, ein Farbnuancierungen und Lichtreflektionen aufweisendes Gewebe hingegen lebendig und elegant wirkt, erfährt hier eine Übertragung auf die Architektur. Festlich und geheimnisvoll wie ein schwarzes Abendkleid oder ein Smoking erscheint diese Fassade: Wundervoll das leichte Farbspiel der Edelstahlplatten und das sanfte Schimmern im Licht, jäh gesteigert zu einem Funkeln an den Kanten der Sonnenschutzlamellen und der Horizontalbleche.
»Bügelfalten«
Die Fassade konnte derart zum Gestaltungselement und Bedeutungsträger werden, weil das Innere das Äußere vom Tragen entlastet. Die gerade einmal 20 cm breiten Unterzüge fächern sich – einer Schnittmusterzeichnung gleich – V-förmig auf und durchspannen die 16 m tiefen Räume in ganzer Breite ohne jegliche weitere Unterstützung und schaffen so stützenfreie Nutzflächen von 400 m² pro Geschoss. Die sie tragenden (ebenfalls äußerst schmalen) Stützen besitzen – auch hier bezieht sich Roth auf das Textile – »Bügelfalten« genannte vertikale Knicke, die sie schlanker und plastischer wirken lassen. Dieses Tragwerk ist aufs Äußerste optimiert und minimiert. Unwillkürlich fragt man sich, wie diese Konstruktion die Lasten halten kann. Die Weite des Raums, nur unterbrochen durch die notwendigen Einbauten für Toiletten und Küchen, setzt sich über die Glasfassaden in den Außenraum fort und beschert grandiose Blicke ins Grün stattlicher Straßenbäume oder auf die dichte heterogene Nachbarbebauung. Der Ausblick ist jedoch abhängig vom Standort, denn die schwarzen Lamellen entfalten auch im Innern ihre Wirkung: Je spitzer der Betrachtungswinkel, desto schmaler werden die Durchblicke zwischen ihnen und so werden aus Glasfronten geschlossen wirkende Wände. Eine Ausnahme bildet die gänzlich lamellenfreie gläserne Nordfassade im zweiten und dritten OG.
Das Offene ist zugleich geschlossen, das Äußere ein Teil des Innern, das Schwarze farbig: Carsten Roth zieht die Ambivalenz der Eindeutigkeit vor und spielt meisterhaft mit unserer Wahrnehmung. Dabei ist Waterloohain 5+ ein überaus zweckmäßiger, funktionaler, flexibler Bürobau. Sein so elegantes dunkles Kleid ist kein Ausdruck von Eitelkeit, sondern von Hochachtung gegenüber seiner Umgebung. Wie wusste schon Oscar Wilde: »Eine rote Rose ist nicht selbstsüchtig, weil sie eine rote Rose sein will. Es wäre aber furchtbar selbstsüchtig, wenn sie wollte, dass alle Blumen im Garten rote Rosen sind.«db, Mo., 2013.11.11
11. November 2013 Claas Gefroi
Dunkler Stein auf dem Schulhof
(SUBTITLE) Schulsporthalle mit Kulturforum in Hamburg
Dunkler, fast schwarzer Klinker ist ein ungewöhnliches Fassadenmaterial für einen Schulbau. Doch für die Dreifachsporthalle mit zusätzlichem Veranstaltungssaal der Stadtteilschule in Hamburg-Bergedorf war er genau die richtige Wahl: Der Neubau drängt sich nicht auf und bildet doch ein kraftvolles Zentrum in einem heterogenen Umfeld.
Wer, wie der Autor, im zentrumsnahen Bereich Hamburgs wohnt, für den ist es gar nicht so leicht, hierher zu finden. Auf der gut ausgebauten Bundesstraße bis ins Herz des südöstlichen Bezirks Bergedorf verpasst man schnell die kleine Seitenstraße, die durch beschauliche Einfamilienhausgebiete zur Stadtteilschule Bergedorf führt. Diese war früher eine Gesamtschule, bevor in Hamburg im Zuge einer Reform Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu Stadtteilschulen umgewandelt wurden. Hamburger Gesamtschulen der 70er Jahre zeigen sich in der Regel als große Bildungsmaschinen im Stile des Brutalismus'. Nicht so in diesem Fall, denn die 1979 gegründete Gesamtschule nutzte bereits vorhandene Pavillons einer Vorgängereinrichtung. Diese in die Jahre gekommenen Waschbetonbauten der späten 60er und frühen 70er Jahre prägen noch heute das weitläufige Schulgelände und sollen nach und nach saniert werden. Bereits 2009 kam es im Zuge der Modernisierung der alten Sporthalle bei Dacharbeiten zu einem Brand, durch den das gesamte Dach einstürzte. So blieben nur Abriss und Neubau. Die Schule nutzte die Chance und erweiterte zur Stärkung ihres musischen Schwerpunkts die Bauaufgabe Sporthalle um einen Saal für kulturelle Veranstaltungen.
Startschuss
Für die mit dem Neubau beauftragten BKS Architekten aus Hamburg war dies keine einfache Aufgabe. Eine städtebauliche oder architektonische Orientierung gab es nur bedingt, da die umgebenen Schulbauten in den nächsten Jahren umgebaut oder ersetzt werden sollen. So steht die Sporthalle, ergänzt um das Kulturforum für einen Neustart der Schule. Die Architekten waren sich ihrer Verantwortung dabei bewusst und wollten den heterogenen und sich weiter wandelnden Ort beruhigen und nicht zu stark vorprägen. Naturgemäß führt eine Dreifeldsporthalle mit Nebenräumen und angegliedertem Kulturbereich zu einem beachtlichen Gebäudevolumen, das die Planer nicht zu dominant erscheinen lassen wollten. So erfuhren die Fassaden eine feine Gliederung: Langgezogene geschlossene Flächen wechseln sich mit bündig eingesetzten Fenstern ab. Zudem verliert der große Quader der Halle durch weitere wohlüberlegte Details seine Mächtigkeit: Das Vordach auf der Eingangsseite weitet sich in einem sachten Winkel, den ein eingeschossiger Anbau für Nebenräume aufnimmt und weiterführt. Auf der Rückseite wurde die notwendige Fluchttreppe nicht einfach als Metallkonstruktion angehängt, sondern ebenfalls als backsteinbekleideter massiver Körper ausgebildet. Zusätzliche Spannung erzeugt die Dachform: Das Satteldach der eigentlichen Halle ergänzt noch ein weiteres Pultdach für den Umkleidetrakt. Das Auf und Ab dieser Dachlandschaft setzt den Bau in Bewegung und veranschaulicht dabei gleichzeitig seine innere Gliederung. Mit dem ansteigenden und dann jäh abbrechenden Pultdach wird gar eine imaginäre Verbindung zur Umgebung hergestellt.
Überzeugungsarbeit
Der entscheidende Faktor für ein zurückhaltendes und langlebiges Erscheinungsbild ist jedoch die Materialität und Farbigkeit der Fassadenflächen. Um eine möglichst (farb-)neutrale Außenhaut zu erhalten, planten die Architekten eine Vormauerschale aus schwarzen Ziegeln. Ihnen gefiel die Vorstellung einer geheimnisvollen, artifiziellen Fassade – gerade im Kontrast zur durchgrünten Umgebung. Die als Bauherrenvertreter für alle Schulbauten des Stadtstaats verantwortliche »Schulbau Hamburg GmbH« forderte jedoch roten Backstein für die Hülle. Nach einem längeren Diskussionsprozess konnten sich schließlich die Architekten mit ihrem Wunsch durchsetzen, auch, weil sie, unterstützt von der Schulleitung, dem Bauherrn die Furcht nehmen konnten, hier entstünde ein pechschwarzer, lebloser, düsterer Bau. Der Schlüssel hierfür war die sorgfältige Wahl des richtigen Steins. Die Architekten entschieden sich für schwarz durchgefärbten Klinker, gefertigt in traditioneller Kohle-Salzbrand-Technik. Dazu werden die Klinker bei extrem hohen Temperaturen gebrannt, sodass sie auf dem Ofenwagen leicht deformieren und miteinander verkleben. Nach dem Brand haften so an den Oberflächen noch Reste der Klinker aus den darüber liegenden Lagen. Dies und das durch Kohle und Salz hervorgerufene reiche Farbspiel führen zu einer sehr heterogenen Oberfläche. Im Ergebnis wirken die Fassaden dunkel, aber eben niemals vollkommen schwarz. Je nach Tageslichtsituation erscheinen die Ansichten mal anthrazit, mal rötlich oder auberginefarben. Die in ihren Abmessungen etwas unregelmäßigen Steine erzeugen zudem ein lebhaft plastisches Bild, noch gesteigert durch ihre Anordnung im Wilden Verband und einzelne leichte Schrägstellungen – eine Reminiszenz an die Hamburger Backsteintradition mit ihren handwerklich hergestellten reliefartigen Wandflächen. Die dunklen Klinker in ihrer Struktur und Farbigkeit zusammen mit der Art ihrer Vermauerung unterstützen bestmöglich die skulpturale Kraft des Gebäudes.
Farbiges Leuchten
Die durch das Äußere geweckten hohen Erwartungen werden auch im Innern nicht enttäuscht. Der Eingangsbereich mit seinem offenen Treppenraum bleibt noch dezent schwarz-weiß und setzt so die Reduktion der Fassade fort. Doch nur einmal rechts um die Ecke gebogen ist die Zurückhaltung vorbei: Wände, Boden und Decke, kurz, der gesamte Flur zu den Umkleiden des Sportbereichs erstrahlt in leuchtendem Grün. Die Farbe verleiht dem Raum einen artifiziellen Charakter – abgemildert nur durch das lange Fensterband, das Blicke in die ebenfalls grüne Umgebung erlaubt. Die Umkleiden selbst wiederum überraschen durch ihre himmelblaue Erscheinung, kontrastiert durch die eigens angefertigten, im Grün des Flurs lackierten Sitzbänke.
Als dritte Farbe gesellt sich schließlich noch das weitaus dezentere und wärmere Rot des Linoleumbodens der Sporthalle hinzu. Die Hallenwände wurden mit Eiche bekleidet, die – weil in der Halle auch Indoor-Hockey mit sehr harten Bällen gespielt wird – eine Beschichtung mit HPL erhielt. Der an sich eher kühle Farbton der Holzpaneele wird durch die Reflektion des roten Bodens deutlich wärmer, was zur Behaglichkeit im Innern beiträgt. Die Dachhaut aus Trapezblechen wird getragen von Holzleimbindern, die gut zur Eiche an den Wänden passen. Schade nur, dass sie durch die abgehängten Lüftungs- und Beleuchtungskörper kaum in Erscheinung treten. Erfreulich auch, dass der Bauetat noch eine schmale Galerie mit Sitz- und Stehplätzen für Zuschauer zuließ.
Rot, allerdings nur punktuell, findet sich auch im »Zeighaus«, wie die Schule ihren vorgelagerten Veranstaltungssaal nennt. Hier kann Theater gespielt, musiziert und getanzt werden – der Raum lässt vieles zu. Sein Sportboden aus Eiche, die weißen Wände, der schwarze Bühnenbereich und die schalldämpfenden Vorhänge aus rotem Samt klingen zusammen und erzeugen einen harmonischen Gesamteindruck. Durch große Seitenfenster fällt viel Tageslicht in den Saal, ergänzt durch ein herausgeschobenes Erkerfenster in der rückwärtigen Wand, das den Blick in die Baumwipfel lenkt. Eine Garderobe, ein Kiosk, eine sauber in die gefaltete Gipskartondecke integrierte Saalbeleuchtung – man ist gut gerüstet für Veranstaltungen mit viel Publikum. Umso bedauerlicher, dass derzeit noch eine richtige Bühne fehlt – solange die Schule dafür noch spart müssen stattdessen mobile Podeste herhalten. Doch das ist schon das einzige Manko in diesem Sport- und Kulturbau, der – obwohl den Kostenrahmen von 6,1 Mio. Euro einhaltend, durch eine hohe gestalterische Qualität bis ins kleinste Detail besticht. Sie wäre nicht möglich gewesen ohne das Engagement von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schüler, die sich sehr für dieses Gebäude eingesetzt haben.
Wie gut das Haus angenommen wird, zeigt sich auch daran, dass es bislang nicht die kleinsten Zeichen von Vernachlässigung oder Vandalismus gibt – nirgendwo ein Graffito. Und wie man hört, ist angesichts des so gar nicht düsteren Gebäudes auch die Schulbau Hamburg stolz auf die Entscheidung zum schwarzen Klinker und empfiehlt ihn für die weitere Verwendung auch anderswo. Die Backsteinstadt Hamburg – von Rot bis Schwarz – sie bleibt lebendig.db, Mo., 2013.11.11
11. November 2013 Claas Gefroi
Schwarzer Diamant
(SUBTITLE) Festspielhaus in Erl (A)
Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht – der dunkle, kantige Neubau der »Tiroler Festspiele Erl« ist keineswegs eine autistische Bauskulptur, sondern das feinsinnig in die Berglandschaft eingebettete Pendant zum weißen Passionsspielhaus der 50er Jahre. Ebenso wie dieses ist auch das neue Festspielhaus ein Ort des reinen und auf das Wesentliche konzentrierten Musikgenusses.
Erl wäre ein Dorf wie jedes andere, wenn die Dorfbewohner nicht seit dem 17. Jahrhundert jeden sechsten Sommer ihre Passionsspiele veranstalten würden. Den festlichen Rahmen hierfür bildet der weithin sichtbare, von Robert Schuller 1957-59 ganz in Weiß geplante Rundbau, dessen schneckenförmig verdrehter Bühnenturm auf elegante Weise die Baumasse eines 1500 Personen fassenden Zuschauerraums kaschiert.
Dass 2007 ein internationaler Architektenwettbewerb für einen weiteren Konzertsaal ausgelobt wurde, obwohl der zwischen Kufstein und Rosenheim am Inn gelegene Ort bereits mehr Theaterplätze als Einwohner zählte, hat mit der ganz persönlichen Passion von Gustav Kuhn zu tun. Fasziniert von der nachkriegsmodernen Authentizität und der großartigen Akustik des bis dahin nur alle sechs Jahre genutzten Passionsspielhauses, gründete der weltweit tätige Dirigent, Komponist und Regisseur 1997 die »Tiroler Festspiele Erl«. Wesentliches Merkmal und Erfolgsfaktor seiner Aufführungen sind sowohl die requisitenarmen und puristisch-handwerklichen Inszenierungen, die – anders als im Regietheater – ganz ohne Knalleffekte auskommen, als auch die volle Konzentration auf das Wesentliche: die Musik. Wegen des wachsenden Publikumsandrangs, u. a. bei den Opern Richard Wagners, sowie angesichts des nicht beheizbaren Altbaus mit unzureichenden Nebenräumen, entwickelte er schon bald die Idee, den Festspielbetrieb mithilfe eines neuen »Winterfestspielhauses« auszudehnen und zu professionalisieren. Überhaupt denkbar wurde dieser Wunsch freilich erst, als sich 2004 mit Hans Peter Haselsteiner, dem kunstsinnigen Chef eines österreichischen Bauunternehmens, ein Mäzen fand, der letztlich 20 der 36 Mio. Euro Baukosten plus Betriebskosten stiftete und dennoch keinerlei Ambitionen hatte, sich in die Arbeit Kuhns oder der Architekten einzumischen.
Ungleiche Zwillinge
Der von der Tagespresse für den anthrazitfarbenen Neubau gern ins Spiel gebrachte Spitzname »Tarnkappenbomber« weckt Assoziationen an ein in der dörflichen Idylle gestrandetes Ufo. In Wirklichkeit bilden Passions- und Festspielhaus vor der durchgängigen Bergwaldkulisse ein wunderbar harmonierendes Ensemble der Gegensätze und Gemeinsamkeiten. In respektvollem Abstand zueinander begegnen sich Alt- und Neubau auf Augenhöhe und erscheinen jeweils einzigartig: einer geschwungen, der andere kantig, einer eher hoch, der andere flach, einer weiß, der andere fast schwarz. Nach Vorstellung der Architekten Delugan Meissl tritt das Festspielhaus zur Sommerspielzeit eher in den Hintergrund, während das alte, weiße Gebäude vor dem dunklen Wald geradezu leuchtet. Im Winter hingegen kehrt sich die Situation um: dann steht das Winterfestspielhaus vor weißer Schneelandschaft im Rampenlicht. Dass dieses Konzept nicht ganz aufgeht, liegt zum einen daran, dass der Konzertsaal auch im Sommer bespielt wird, zum anderen spiegelt sich insbesondere bei Nässe der helle Himmel in den Dachflächen, die im Winter überdies so tief verschneit sind, dass auch das Festspielhaus größtenteils weiß erscheint.
Diese Unschärfe wiegt jedoch keineswegs so schwer, dass sie der Idee der ungleichen Zwillinge schaden könnte. Stattdessen werden auf diese Weise die Gemeinsamkeiten der beiden hervorgehoben: Beide liegen – leicht erhöht – am Fuß eines sanft ansteigenden Berghangs. Beide verfügen über weitgehend geschlossene Fassaden mit geringem Fensteranteil. Und beide erscheinen umso differenzierter, je mehr man sich ihnen annähert. So wird beim Festspielhaus schnell deutlich, dass die klare Großform nicht aus einem Guss ist, sondern sich aus Faserzementplatten zusammensetzt, die sich mit offenen Fugen und verdeckter Entwässerung gleichmäßig über alle Dachflächen verteilen. Die dunkelgrauen Platten mit hellen Sprenkeln sollten ein monolithisches, an ein Felsmassiv erinnerndes Erscheinungsbild, zugleich aber auch eine insgesamt relativ kostengünstige Lösung mit Standardmontagedetails ermöglichen. Grundlage für die Gliederung der Flächen bildete das Prinzip der Penrose-Teilung – eine Art der Kassettierung, die auf der aperiodischen Wiederholung von nur zwei Plattenformaten basiert. Gerade weil dieses Prinzip große Freiheiten bei der Entwicklung unregelmäßiger Muster erlaubt, gelang den Architekten nicht nur die Realisierung homogener Dachflächen mit ungerichtetem Fugenbild, sondern auch eine im Hinblick auf den unvermeidlichen Plattenverschnitt optimierte Lösung.
Dynamik und Ruhe
Der Eingang zum Festspielhaus befindet sich unverkennbar unter dem weit auskragenden Dachkörper, am Ende einer Freitreppe, die direkt auf eine breite, an Spielabenden atmosphärisch leuchtende Glasfuge zuführt. Im Innern erwartet die Besucher ein strahlend weißes, als sanft auf- und abwogende Landschaft konzipiertes Foyer. Wie in einer Schleuse können sie hier zur Ruhe kommen, den Alltag abstreifen und anschließend durch eine weitere Glasfront ebenerdig zum Passionsspielhaus oder aber direkt bzw. über das obere Foyer in den Konzertsaal gelangen. Der dynamischen Asymmetrie des Foyers folgt ein orthogonaler, geradezu statisch anmutender Zuschauerraum, der analog zum Passionsspielhaus als Parketttheater ohne Galerien oder seitliche Ränge konzipiert ist. Vollständig mit dunkel gebeiztem Akazienholz ausgekleidet, weckt der Raum mit gleichmäßig ansteigenden schwarzen Sitzreihen und 732 Sitzplätzen dabei Assoziationen an das Innere eines Streichinstruments, das nur darauf wartet, endlich erklingen zu dürfen. Dass hier tatsächlich die Musik im Vordergrund steht, wird spätestens beim Blick in den Orchestergraben deutlich. Mit 160 m² fast 40 m² größer als in der Wiener Staatsoper, sind selbst bei opulent orchestrierten Opern keine Platzprobleme zu erwarten. Wird der Boden des Orchestergrabens mit Hubpodien auf Parkettniveau angehoben und bestuhlt, finden im Konzertsaal bis zu 862 Personen Platz.
Massgeschneidert
Gemäß der im Wettbewerb von Kuhn definierten Vorgaben ist hier ein reiner Tempel für die Musik entstanden, in dem keinerlei Sprechtheaterstücke bzw. nichtmusikalische Events oder Kongresse stattfinden sollen. Die Akustik des Saals ließ sich daher perfekt auf Opern und Konzerte abstimmen. Außer drei Deckensegeln über dem Orchestergraben sind Wand- und Deckenelemente des Zuschauerraums unbeweglich. Bühnen- und Zuschauerraum sind nicht durch ein festes Portal voneinander getrennt, sondern bilden eine räumliche Einheit, sodass ein relativ großes, akustisch zusammenhängendes Raumvolumen für ein optimales Klangerlebnis sorgt. Ansonsten zeigt sich das Festspielhaus hinsichtlich seiner technischen Ausstattung eher schlicht: So gibt es zwar ein rechtwinkliges Hubpodium auf der Bühne und eine zeitgemäße Lichttechnik, jedoch keine computergesteuerten Bühnenmaschinerien, keinen hohen Schnürboden, keine Lautsprecheranlage und schon gar kein elektronisches Raumakustiksystem. Im Mittelpunkt von Kuhns Aufführungen stehen vielmehr ein authentischer »Naturklang« sowie Bühnenbilder und Schauspiele, die die Musik erläutern statt mit ihr in Konkurrenz zu treten.
Hybrides Tragwerk
Wer am Abend in der Pause eines solchen Musikerlebnisses auf den nach Westen orientierten Balkon des oberen Foyers tritt, blickt – zumindest bei gutem Wetter – direkt in eine Art Götterdämmerung in fantastischer Bergkulisse. Der Ausblick ist v. a. deshalb so imposant, weil er vom weit auskragenden Bauvolumen über dem Eingangsbereich überlagert wird. Dort und in den seitlich des Zuschauer- und Bühnenraums gelegenen OGs befinden sich jene Lager, Werkstätten, Büros, Neben-, Aufenthalts- und Probenräume, die im Passionstheater fehlten. Auf Grundlage des trotz expressiver Gebäudeform erstaunlich klaren Tragwerkskonzepts entstanden seitliche Gebäudeflügel, Zuschauer- und Bühnenraumwände in Stahlbeton, während die Auskragung und die Decke des Zuschauerraums als Stahl-Raumfachwerk ausgeführt wurden. Letztlich handelt es sich hierbei um eine Zweckkonstruktion, die sich – auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte – relativ frei im Raum zwischen der heute sichtbaren äußeren und inneren Hülle bewegt.
Beim Festspielhaus in Erl geht es Delugan Meissl nicht um abgehobene Theatralik oder kompromisslosen Detailfetischismus. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Übersetzung der Bauherrenanforderungen in eine Architektur, die perfekt auf die Gedankenwelt Gustav Kuhns zugeschnitten ist. Durch das überaus glückliche Zusammenspiel der Beteiligten aus Wirtschaft, Musik und Architektur ist hier gerade kein heimtückischer Tarnkappenbomber entstanden, sondern viel eher ein überaus seltener schwarzer Diamant, auf den die Einwohner Erls heute ebenso stolz sind wie auf ihre Passionsspieltradition.db, Mo., 2013.11.11
11. November 2013 Roland Pawlitschko
Reflektierende Black Box
(SUBTITLE) Umbau eines Pförtnerhauses in Arnheim (NL)
Im Arnheimer Industriepark Kleefse Waard hat das vorhandene Empfangsgebäude ein komplett neues Gesicht erhalten. Der scharfkantige Quader des Amsterdamer Büros NL Architects kontrastiert ein konsequent transparentes EG überraschend und zeichenhaft mit einem schwarzen Aufbau, der gerichtetes Licht bei Dunkelheit effektvoll reflektiert.
Die Bauaufgabe »Pförtnerhaus« findet gemeinhin wenig Beachtung. Schade eigentlich, denn an ihr lassen sich wie unter einem Brennglas unterschiedliche gestalterische Tendenzen zum jeweiligen Entstehungszeitpunkt festmachen. Eine ziemlich ungewöhnliche Umsetzung des Themas hat jetzt das Amsterdamer Büro NL Architects für den Industriepark Kleefse Waard IPKW im niederländischen Arnheim vorgestellt. Das im Südosten der Stadt in unmittelbarer Nähe zu einem Rheinarm schon in den 20er Jahren angelegte Terrain beherbergt auf einer Fläche von 90 ha rund 35 Unternehmen, die meisten davon aus den Bereichen Technologie und Forschung.
Um den hohen Sicherheitsanforderungen der vor Ort ansässigen Firmen zu entsprechen, ist der nach Süden und Westen durch zwei Hafenbecken begrenzte Industriepark vollständig umzäunt und wird an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr bewacht. Am nordwestlichen Rand des Areals steht seit den 70er Jahren ein zweigeschossiges Pförtnerhaus, an dem sich Mitarbeiter, Besucher und Zulieferer zunächst registrieren lassen müssen, bevor sie das Gelände – die beiden letzteren nur in Begleitung – betreten dürfen. Nach rund vierzigjähriger Nutzung entsprach der Altbau jedoch nicht mehr den gestiegenen logistischen und repräsentativen Anforderungen der Betreiber. Um eine schnellere Erschließung zu ermöglichen, sollte insbesondere Platz für eine zweite Zufahrtsspur geschaffen werden. Aufgrund der begrenzten Fläche war deshalb zunächst geplant, ein komplett neues Rezeptionsgebäude neben der Straße zu errichten. »Allerdings beherbergte das bestehende Pörtnerhaus die Verteilerzentrale für sämtliche Datenleitungen innerhalb des Industrieparks, sodass es sich letztlich als beinahe unmöglich erwies, das Gebäude abzubrechen, ohne dabei den ganzen Betrieb lahmzulegen«, so Projektarchitekt Guus Peters.
Zeichenhafter Empfang
Als Alternative schlugen die mit der Planung direkt beauftragten Architekten vor, den vorhandenen technischen Kern des Altbaus zu erhalten, aber durch eine elegant detaillierte neue Hülle mit leicht geänderten Proportionen einzufassen; in Richtung Westen sollte das Volumen dazu leicht beschnitten, an den anderen drei Seiten um rund 1,5 m vergrößert werden. Ausgehend von dieser Grundidee wurde die deutlich in die Jahre gekommene Bekleidung aus blau beschichteten Spanplatten komplett abgebrochen und durch eine Hülle mit gänzlich veränderter, betont zeichenhafter Ausstrahlung ersetzt, die sich wohltuend vom zweckbetonten Charakter des Standorts abhebt. Dem umlaufend raumhoch verglasten EG wurde dabei ein tief schwarzes und komplett geschlossenes Geschoss »aufgebürdet«, das trotz seiner optisch wirksamen dunklen Schwere gleichsam über der Erde zu schweben scheint und so auf Anhieb neugierige Blicke von Passanten und Nutzern auf sich zieht; ganz so, als hätten die Architekten sämtliche physikalischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt.
Im EG des nachhaltig transformierten Gebäudes haben die Planer als notwendige Einbauten lediglich eine verglaste Rezeption sowie ein kleines, vollständig geschlossenes Volumen mit Büro und Besucher-WC eingefügt. Außerdem wurde neben der Rezeption ein kleiner Wartebereich mit Kaffeeautomat und Schließfächern integriert. Ansonsten wurde der Raum so transparent wie möglich gehalten, um dem Wachdienst anders als früher einen guten Überblick über die Eingangssituation zu verschaffen. Aus dem gleichen Grund ist die Rezeption leicht erhöht auf einem Sockel platziert. Um dennoch eine ausreichende Stehhöhe und außerdem eine optimierte Beleuchtung zu erreichen, findet sich oberhalb der Arbeitsfläche statt der sonst verwendeten abgehängten Deckenelemente aus Aluminium eine rund 20 cm höher angeordnete großformatige Lichtdecke. Im Zusammenspiel mit den transparenten Fassaden wird die Präsenz des Pförtners durch diese Illumination zusätzlich betont. Die acht Stahlstützen im Raum nehmen dagegen zusammen mit den massiv gemauerten, im Zuge des Umbaus leicht veränderten Wandscheiben des Büros die statischen Lasten des OGs auf, das als Black Box die gesamte Schaltzentrale birgt.
Leuchtender Dialog
Ebenso ungewöhnlich wie das Bild der beiden kontrastierenden Geschosse präsentiert sich auch die Materialwahl für die Fassadenhaut des OGs: Um die vom Bauherrn gewünschte »Interaktion des Gebäudes mit den Besuchern« zu ermöglichen, griffen NL Architects dabei auf eine retroreflektierende schwarze Folie zurück. Sie ist in der Lage, einfallendes weitgehend gerichtetes Licht zur Strahlungsquelle zurückzuwerfen, ein Funktionsprinzip, das vorrangig an Oberflächen im Straßenverkehr und bei der Radartechnik eingesetzt wird. Folienbespannte Sandwich-Elemente aus Aluminium wurden auf einer gedämmten Stahlkonstruktion, die den gewünschten Abstand zu den massiven OG-Wänden schafft, montiert. Das gewählte schlanke Format der 4 mm dicken Platten von 4,30 x 1,20 m sorgt dabei für eine elegante Untergliederung der Fassaden.
Um die entstehenden Lichteffekte vorab zu simulieren und anzupassen, nutzten die Architekten die Attrappe eines Fahrzeugcockpits inklusive Beleuchtung. Der schließlich erreichte Effekt ist verblüffend: Denn während das OG am Tag als rätselhaft mattschwarze Box erscheint, in der sich die Umgebung schemenhaft spiegelt, beginnt es bei Nacht und während der Dämmerung bei Kunstlichteinstrahlung in Richtung der Lichtquelle hell zu reflektieren. Je nach Farbtemperatur der Lichtquelle ergeben sich dabei ganz unterschiedliche Farbtöne. Bei Sonnenunter- oder -aufgang verwandelt sich die schwarze Hülle fast schon in eine goldene Oberfläche. Verstärkt wird der Effekt dadurch, dass die Zufahrt zum Industriepark leicht ansteigt und so das Scheinwerferlicht der ankommenden Fahrzeuge direkt auf das OG trifft. Der Bau, der sich tagsüber durch seine schwarze, schwebende Eigenständigkeit abhebt, mutiert so abends zum rätselhaften Lichtobjekt, das direkt und unmittelbar eine interaktive Verbindung zur Lichtquelle und zum Betrachter schafft. Ein überraschendes Erlebnis, das die Ein- und Ausfahrt für die Besucher und Mitarbeiter des Industrieparks zur spannenden Passage werden lässt.db, Mo., 2013.11.11
11. November 2013 Robert Uhde