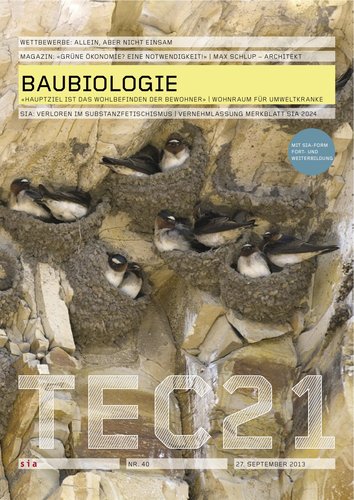Editorial
Die Baubiologie ist eine relativ junge Disziplin. Erste baubiologische Vereinigungen entstanden in den 1970er-Jahren – zuerst in Deutschland, dann auch in der Schweiz. Sie waren eine Reaktion auf den damals entdeckten Zusammenhang zwischen den Schadstoffemissionen aus neuen industriellen Baustoffen und gesundheitlichen Beschwerden der Gebäudenutzer. Wichtigstes Ziel der Baubiologie ist das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen in ihrer gebauten Umwelt. Zur breiten Palette ihrer Massnahmen gehören auch solche, die nicht wissenschaftlich überprüfbar sind («Spezialisten für die dritte Haut»). Das hat der Baubiologie vor allem in der Anfangszeit den Ruf des Dogmatischen und Sektiererischen eingebracht. Heutige Baubiologinnen und Baubiologen gehen wesentlich offener und pragmatischer mit diesem Erbe um («‹Hauptziel ist das Wohlbefinden der Bewohner›») und erhalten ihre Ausbildung seit 1996 in einem Fachkurs mit eidgenössisch anerkanntem Abschluss. Im Licht der Nachhaltigkeitsdiskussion zeigt sich ausserdem, dass wichtige Aspekte der Baubiologie seit jeher nachhaltig sind – beispielsweise die Bevorzugung nachwachsender, lokaler Rohstoffe.
Als vor einigen Jahren in Zürich der Bau von Wohnungen für eine besonders empfindliche Bevölkerungsgruppe – Menschen, die unter Multipler Chemikalien-Unverträglichkeit (MCS) leiden – in Angriff genommen wurde, stand fest, dass das Gebäude hohen bauökologischen und biologischen Anforderungen genügen müsse: Die Betroffenen reagieren mit starken körperlichen Beschwerden auf geringste Mengen synthetischer oder natürlicher Schad- und Duftstoffe. Zwar sind schon verschiedentlich Gebäude für MCS-Betroffene gebaut worden, doch bisher waren sie auf die jeweiligen Bedürfnisse der künftig dort Wohnenden «massgeschneidert». Im Gegensatz dazu muss das Mehrfamilienhaus, das jetzt in Zürich Leimbach fertiggestellt wird, den Anforderungen verschiedenster Mieter mit dieser Krankheit gerecht werden. Dieses Ziel haben Bauherrschaft und Planer mit einer sehr umfassenden und dabei pragmatischen Vorgehensweise verfolgt. Einige Materialien, die nach gängiger baubiologischer Praxis als unbedenklich gelten, kamen nach Tests mit den Betroffenen nicht mehr in Betracht («Eine Frage – zwei Meinungen»). Andererseits kamen auch wissenschaftlich nicht abgestützte Methoden zum Einsatz, um wirklich alles zu tun, was zum Wohlbefinden der Bewohner beitragen könnte. Ob das gelungen ist, wird sich erst herausstellen, wenn die Mieter einige Zeit darin gewohnt haben.
Noch scheinen viele Betroffene skeptisch zu sein – die Nachfrage nach den 15 Wohnungen läuft eher schleppend an. Offenbar möchten die potenziellen Mieter erst selbst spüren, ob sie sich in den fertigen Wohnungen tatsächlich wohlfühlen.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Allein, aber nicht einsam
12 PERSÖNLICH
«Grüne Ökonomie? Eine Notwendigkeit!» | usic unterstützt Energiestrategie | Eine Frage – zwei Meinungen
15 MAGAZIN
Bücher | Max Schlup – Architekt
20 SPEZIALISTEN FÜR DIE DRITTE HAUT
Claudia Carle
Was tun Baubiologen? Eine kurze Einführung in Geschichte, Ziele, Arbeitsweise und Ausbildung.
21 «HAUPTZIEL IST DAS WOHLBEFINDEN DER BEWOHNER»
Claudia Carle, Tina Cieslik
Drei Baubiologen erläutern im Gespräch mit TEC21, wie sie vorgehen, wo sie ihre Funktion im Bauprozess sehen und warum der Anteil baubiologischer Gebäude noch immer gering ist.
25 WOHNRAUM FÜR UMWELTKRANKE
Michèle Blätz Fleischli
In Zürich Leimbach entsteht ein Mehrfamilienhaus für Menschen mit Multipler Chemikalien-Unverträglichkeit (MCS), das hohe bauökologische und biologische Anforderungen stellte.
31 SIA
SIA-Form Fort- und Weiterbildung | Verloren im Substanzfetischismus | Vernehmlassung Merkblatt SIA 2024 | Beitritte zum SIA im
2. Quartal 2013 | Neue Mitarbeiterin Tragwerke
36 FIRMEN | PRODUKTE
SFS unimarket | Verband Schweizer Kalksandstein-Produzenten | Hexis | Qn’C | Sika
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
«Hauptziel ist das Wohlbefinden der Bewohner»
Vor fast 40 Jahren schlossen sich in der Schweiz die ersten Baubiologen zu einem Verband zusammen, der mittlerweile 800 Mitglieder hat. Trotzdem wird bis heute nur ein Bruchteil aller Neu- und Umbauten nach baubiologischen Grundsätzen ausgeführt. Im Gespräch mit TEC21 orten drei Baubiologen unterschiedlicher Generationen unter anderem mangelndes Wissen über baubiologisches Bauen bei Architekten und Bauherrschaften als eine Ursache dafür. Sie erläutern, was man durch das Beiziehen eines Baubiologen gewinnt und welche Funktion er im Bauprozess wahrnehmen kann.
TEC21: Wann werden Sie als Baubiologen in der Regel zu einem Projekt beigezogen?
Bosco Büeler (B. B.): Das ist sehr unterschiedlich. Die Bandbreite reicht von kurzen Beratungen, in denen Bauherren spezifische Fragen stellen, über eine Basisberatung zu Beginn der Planung bis hin zur Begleitung oder Planung des ganzen Projekts. Letzteres ist natürlich am umfassendsten und daher am schönsten. Neben Bauherrschaften beraten wir auch Architekten.
TEC21: Haben Baubiologen dann die Rolle eines weiteren Fachplaners?
Jörg Watter (J. W.): Baubiologen sind nach meinem Verständnis «Gesamtbetrachter», die Aspekte aus verschiedenen Fachrichtungen zu einem neuen, nachhaltigen Ganzen zusammenführen. Bei der Materialwahl können sie z. B. abschätzen, wie diese den Feuchtehaushalt, die Wärmespeicherung oder den Geruch beeinflusst, oder sie beraten bezüglich elektrobiologischer Aspekte. Das Problem der verschiedenen Fachplaner ist häufig, dass sie in ihrem Bereich zwar sehr gut sind, aber kaum disziplinenübergreifend zusammenarbeiten können, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Diese unterschiedlichen Werke zu einem zusammenzufügen und zu gewichten ist eine Qualität der Baubiologen. Das Hauptziel dabei ist das Wohlbefinden der Bewohner oder Nutzerinnen.
TEC21: Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Bauvorhaben von Anfang an begleiten?
J. W.: Das beginnt bei der Analyse des Grundstücks. Mit Hilfe von Sonnendiagrammen schaue ich zum Beispiel, wie man mit dem Gebäude passiv möglichst viel Sonnenenergie ernten kann bzw. wie man allenfalls Photovoltaik- oder Solarthermiemodule platzieren müsste. Natürlich schaue ich das Grundstück auch hinsichtlich der Wasseradern oder Erdverwerfungen1 an.
B. B.: Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die das für Humbug halten, kann ich das auch problemlos akzeptieren. Dann lasse ich diese Untersuchungen einfach weg. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute in den vergangenen Jahren offener geworden sind gegenüber diesen Aspekten. Nathalie Frey (N. F.): Das hängt auch mit der eigenen Vorstellung vom Menschen zusammen: ob man nur an das glaubt, was man messen kann, oder daran, dass der Mensch grundsätzlich ein sensibleres Messgerät ist als alle technischen Instrumente.
TEC21: Welche Aspekte sind beim Gebäude selbst aus baubiologischer Sicht wichtig?
J. W.: In der Projektentwicklung beginne ich im Innern bei den Oberflächen, frage die Bauherrschaft, was sie in den verschiedenen Räumen am Boden bzw. an den Wänden und Decken spüren und sehen möchte. Meine Aufgabe ist es dann, die dahinterliegende Konstruktion mit den passenden Materialaufbauten zu entwickeln. Als Baubiologen arbeiten wir vorwiegend mit natürlichen, schadstofffreien und umweltfreundlichen Materialien.
N. F.: Unser Ziel ist, dass alle Sinne vom Raum genährt werden. Ob ich mich in einem Raum wohlfühle, hängt nicht nur mit der Form des Raums zusammen, sondern eben auch mit der Materialität, der Oberflächenstruktur, der Farbe, dem Lichteinfall, der Akustik und dem Raumklima. Ein weiterer Aspekt sind Störfaktoren wie Elektrosmog, die wir weitestgehend zu verhindern, zu reduzieren oder abzuschirmen versuchen (vgl. «Wohnraum für Umweltkranke» S. 25).
TEC21: Sie sprachen den Einsatz möglichst schadstofffreier Materialien an. Was bedeutet das bei einem Umbau? Welche Beurteilungskriterien ziehen Sie dafür heran?
J. W.: Bestehende Bauten werden mit Messungen vor Ort sorgfältig auf allfällige Schadstoffe überprüft und vorhandene Materialien bei Verdacht im Labor analysiert. So kann entschieden werden, was rückgebaut oder ersetzt werden muss.
TEC21: Welche Beurteilungskriterien ziehen Sie dafür heran?
J. W.: Das Problem ist, dass es für Wohnräume – anders als für den Bürobereich – nur wenige gesetzlich festgelegte Schadstoffgrenzwerte gibt, deren Einhaltung man einfordern könnte.
B. B.: Das Umweltschutzgesetz in der Schweiz geht nur bis zur Haustürschwelle. Eine entsprechende Ergänzung beim Chemikaliengesetz lag im Jahr 2000 auf dem Tisch, ist aber vom Parlament abgelehnt worden. Wir arbeiten daher mit den wissenschaftlich anerkannten Richtwerten des Standards baubiologischer Messtechnik SBM.2 Das sind hauptsächlich Erfahrungswerte aus Tausenden von Untersuchungen, aus denen man schliessen kann, ab welchen Werten bei den Bewohnern gesundheitliche Probleme auftreten können. Wobei eigentlich immer eine Kombination verschiedener Faktoren die Probleme verursacht – Schadstoffe, Elektrosmog, eine falsche Raumgestaltung und vielleicht noch persönliche Probleme. Und dann redet man manchmal über den letzten Tropfen, der das Glas zum Überlaufen bringt, und ist nicht bereit, auch über den Rest, der das Glas gefüllt hat, zu reden.
J. W.: Mit den Leuten, die auf Substanzen im Gebäude mit gesundheitlichen Beschwerden reagieren, haben vor allem die Messtechniker in unserem Verein zu tun. In meinem beruflichen Alltag als Architekt steht das nicht so im Vordergrund. Da geht es um die gesamte Nachhaltigkeitskette, zu der wir wertvolle Beiträge liefern können, beispielsweise durch den Einsatz lokaler Materialien mit niedriger grauer Energie, die Förderung der lokalen Wirtschaft oder auch soziale Aspekte. Häufig würde eine kurze Beratung durch einen Baubiologen genügen, um auf mögliche Probleme hinzuweisen. Ich verstehe nicht, warum bei Architekten so eine Hemmschwelle besteht, einen Baubiologen beizuziehen. Ebenso fehlt auch bei vielen Nutzern noch das Bewusstsein, dass nicht nur die Ernährung für unsere Gesundheit wichtig ist, sondern auch der Ort, wo wir leben. Sie könnten einfach mal einen Baubiologen fragen, wenn sie ein gesundheitliches Problem haben.
TEC21: Würden Sie sich wünschen, dass die Baubiologie in der Architekturausbildung verstärkt behandelt wird, um diese Hemmschwelle abzubauen?
J. W.: Das ist für mich zwingend. Ich bin Dozent an der Fachhochschule Chur und führe dort jetzt zum zweiten Mal die Weiterbildung Baubiologie durch. Ich stelle zu Beginn jeweils ein grosses Wissensdefizit fest, dann aber Begeisterung, wenn die Studierenden sehen, dass Baubiologie mehr ist als ein bisschen Pendeln. Ich hoffe natürlich, dass Chur nicht die einzige Schweizer Fachhochschule bleibt, die das Thema ernst nimmt. Wir sind auch daran, mit verschiedenen Fachverbänden Gespräche zu führen, damit das Thema Baubiologie in die Ausbildung von Handwerkern aufgenommen wird.
TEC21: Hat der Planer als Generalist und als derjenige, der alle Fachplaner zusammenhält, vielleicht auch deshalb Mühe damit, einen Baubiologen beizuziehen, weil dann jemand in alle Bereiche reinredet?
B. B.: Das mag sein. Darum ist es auch sehr wichtig, dass man eine gewisse Offenheit hat und nicht belehren will.
N. F.: Man muss ja auch nicht kompromisslos baubiologisch bauen, sondern kann Schwerpunkte setzen. Wir müssen offen sein, das Ganze nicht zu fundamental zu betreiben.
B. B.: Der Dogmatismus, den du ansprichst, Nathalie, hat uns in den ersten Jahren ganz viel Goodwill kaputt gemacht. Die jüngere Generation der Baubiologen aber bringt diesen Pragmatismus mit.
TEC21: Der Minergie-Eco-Standard enthält einige baubiologische Aspekte. Müssen baubiologische Kriterien noch stärker in solche Standards einfliessen?
J. W.: Ich bin sehr froh, dass es Minergie-Eco gibt. Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber man könnte Minergie-Eco noch weiterentwickeln. Eine Gefahr bei Minergie sehe ich, wenn diese Vorgaben ins Baugesetz aufgenommen werden. Lüftungsanlagen sind toll, wenn ich an einer lauten Strasse wohne, aber sie sind nicht an jedem Ort der richtige Weg.
B. B.: Man darf das Ziel – eine gute Luftqualität im Innenraum – nicht mit den Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels verwechseln. Letztere müssen frei wählbar bleiben.
TEC21: Verteuert eine baubiologische Umsetzung ein Projekt?
B. B.: Nach meiner Erfahrung muss man bei einem Kleinbau mit ca. 5 % Mehrkosten rechnen.
J. W.: Da spielen zwei Aspekte eine Rolle. Vom Quadratmeterpreis her ist ein Naturbaustoff um 5 bis 10 % teurer als ein petrochemisches Produkt, wobei sich die Preise heute zum Teil immer mehr annähern. Vom Montageaufwand her gibt es praktisch keinen Unterschied.
B. B.: Das ist auch eine Frage der Menge. Bei einem Grossprojekt, das ich begleite, war der Kork dank der grossen Menge am Schluss günstiger als die aus baubiologischer Sicht nicht empfehlenswerte Steinwolle.
J. W.: Der zweite Aspekt ist die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus, wo Themen wie graue Energie oder Renovierbarkeit ins Spiel kommen und baubiologisches Bauen besser abschneidet. Einen Massivholzboden kann ich nach 20 Jahren schleifen und wieder ölen, dann sieht der wieder perfekt aus. Laminat reisse ich nach 10 bis 15 Jahren raus.
TEC21: Welchen Anteil hat baubiologisches Bauen derzeit nach Ihrer Einschätzung?
J. W.: Ich schätze, wir sind bei 1 bis 2 %. Davon ist der grösste Teil Einfamilienhäuser oder Wohnungen (vgl. Abb. 01). Bei grösseren Gebäuden stellen wir aber seit Neuestem einen Anstieg der Nachfrage fest. Auch die öffentliche Hand greift vermehrt auf Baubiologen zurück, zum Beispiel bei Schulhausbauten (vgl. Abb. 03 – 05).
TEC21: Wo sehen Sie die künftigen Arbeitsschwerpunkte Ihres Verbands?
J. W.: Als ich vor fünf Jahren das Präsidium übernahm, hatten wir keine professionellen Strukturen. Mittlerweile haben wir immerhin die Fachstelle. Wir werden unsere Angebote weiter ausbauen, mit Verbänden zusammenarbeiten und die Qualität der Ausbildung stetig verbessern. Mir geht es darum, die Begeisterung für die Baubiologie nach aussen zu tragen und die Qualität baubiologischen Bauens zu zeigen. Wenn die Leute in den Raum kommen und sagen: «Da fühle ich mich wohl», ist das für mich ein grösseres Kompliment als jedes Label.TEC21, Fr., 2013.09.27
27. September 2013 Tina Cieslik, Claudia Carle