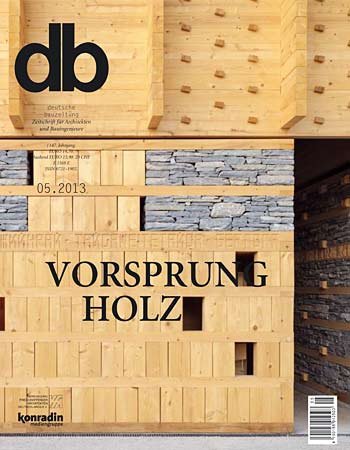Editorial
Holz – es »lebt« und arbeitet, ist Möbelstück und Deckenträger, Akustikplatte und Sonnenschutz, es duftet und ist leicht – und wächst ständig nach. Es wird natürlich belassen oder behandelt, verklebt oder verpresst, verschraubt oder vernagelt, durchlöchert, eingeschnitzt oder verformt. Dass es prinzipiell brennen kann, zählt längst nicht mehr als Argument gegen seine Verwendung. Das zeigt eine Vielzahl in den vergangenen Jahren auch im großstädtischen Kontext fertiggestellter Bauten. Ihre Architekten und Bauherren haben dabei die Wettbewerbsvorteile und Vorzüge von Holz geschickt genutzt, den Baustoff teils aus pragmatischen (einfache, schnelle und leise Baustelle) oder ökologischen (niedrige Primärenergie), teils aus politischen, meist aber aus gestalterischen und haptischen Gründen gewählt. Schließlich bietet kein anderes Material so viele Vorteile und ist, konstruktiv wie gestalterisch, multifunktional einsetzbar. Dabei ist v. a. in der Schweiz ein Trend hin zu unbehandeltem Holz und seinem »ehrlichen« und robusten Einsatz auszumachen. | Christine Fritzenwallner
Wirkungsvoll einfach
(SUBTITLE) Sporthalle in Sargans (CH)
Die Vierfach-Sporthalle zweier Schulzentren ist seit August 2012 das Glanzstück im schweizerischen Sargans. Aufgrund ökologischer Gesichtspunkte stand bei dem Entwurf von Beginn an die Reduktion auf das Wesentliche im Vordergrund. Die besondere Ästhetik, umgesetzt mit modernster Holzbautechnik, basiert auf einfachen, aber wirkungsvollen Gestaltungsmitteln und ist einer frühzeitigen und engen Kooperation zwischen Architekten und Tragwerksplanern zu verdanken.
Die neue Sporthalle in Sargans im Kanton St. Gallen liegt eingebettet zwischen den hoch aufragenden Berggipfeln des Pizol, des Falknis und des Gonzen. Bevor sie errichtet wurde, stand an der gleichen Stelle eine fast 30 Jahre alte Dreifach-Sporthalle. Sie wies so viele Schäden auf, dass die Kosten für eine zeitgemäße Sanierung plus Anbau einer notwendig gewordenen weiteren Sporthalle nur unwesentlich unter den Neubaukosten gelegen hätten – eine Lösung, die außerdem weder baulich noch betrieblich zufriedenstellend gewesen wäre. So entschied sich der Bauherr, das Hochbauamt St. Gallen, für Abriss und Neubau und führte 2008 einen anonymen, einstufigen Wettbewerb durch, den die Planungsgemeinschaft blue architects & Ruprecht Architekten aus Zürich gewann.
Enges Korsett
Das Hochbauamt legte den Fokus des Projekts auf Nachhaltigkeit und auf regionale Wertschöpfung. Es forderte Minergie-Standard, die Einhaltung eines festen Budgets von 20 Mio. CHF (16,4 Mio. Euro) und geringe Unterhalts- und Entsorgungskosten. Zudem sollte die Bauzeit möglichst kurz sein, um die sportlichen Aktivitäten nicht allzu lange unterbrechen zu müssen, sowie die vorhandene Pfahlgründung des Vorgängers genutzt werden, da die Tragfähigkeit des Baugrunds im ehemaligen Sumpfland des Rheins sehr schlecht ist. Aufgrund all dieser Einschränkungen und Vorgaben hatten die Architekten die Sporthalle bereits beim Wettbewerb als Leichtbau in Holz konzipiert – was sich schließlich als entscheidendes Auswahlkriterium für ihren Entwurf darstellte.
Entwurfsidee und Ziel der Planungsgemeinschaft war, einen sinnlichen, ausdrucksstarken Edelrohbau mit einer Tragstruktur aus hochwertigem, möglichst sparsam und sinnvoll eingesetztem Holz zu errichten. Zur Optimierung von Kosten und Ressourcen prüften die Architekten deshalb bei jeder Projektphase aufs Neue, ob Arbeitsschritte bzw. Material eingespart oder Bauteile weggelassen werden können. Diese sorgfältige, konsequente Architektur ist nun das Markenzeichen des etwa 66 m langen und 56 m breiten Bauwerks.
Klare Struktur, grosse Wirkung
Städtebaulich orientiert sich die Sporthalle an der benachbarten, sanierten und erweiterten Kantonsschule sowie deren Positionierung im gesamten Campus, der zusätzlich einen Pavillon erhielt (ebenfalls von blue architects & Ruprecht Architekten) und dessen Sportaußenanlagen neu angeordnet wurden. Die neue, 10 m hohe Sporthalle schafft den Übergang zwischen Hallenvolumen und den umgebenden kleineren Gebäuden v. a. dadurch, dass auf der Längsseite der hohen Sporthalle im Nordosten ein eingeschossiger, niedrigerer Baukörper folgt. In ihm befinden sich die Geräteräume. In der Sporthalle selbst unterteilen doppelwandige Hubfaltwände aus Kunstleder den Raum je nach Bedarf in vier kleinere Einheiten. Im zweigeschossigen Bereich, der sich auf der anderen Hallenseite im Südwesten anschließt, sind innerhalb einer Infrastrukturzone oben wie unten Garderoben und Sanitärzellen, im OG zusätzlich die Räume für Fitness und Gymnastik und im EG u. a. Küche, Technik und Außengeräte untergebracht. Der innere Aufbau ist somit einfach und pragmatisch in Funktionen gegliedert und der Baukörper je nach Nutzungsanforderungen der Räume in der Höhe gestaffelt.
Das Haupttragwerk bilden 40 schlanke Brettschichtholz-Rahmen aus heimischer Fichte unterschiedlich hoher Festigkeiten – da nicht an allen Stellen des Tragwerks die gleichen Kräfte auftreten und folglich nicht überall gleich hohe Brettschichtholz-Festigkeiten notwendig waren, konnten durch diese Anpassung Kosten eingespart werden. Mit einem Abstand von 1,65 m eng aneinandergereiht, erzeugen die Rahmen den Eindruck einer filigranen Holzlamellenwand bzw. -decke.
Die Architekten platzierten die abgehängten Deckenleuchten in der Halle zwischen den Rahmenriegeln. Abends leuchten sie im Kontrast zu den schwarzen Deckenelementen, die u.a. für die gute Raumakustik verantwortlich sind. Zusammen mit den Riegeln ergibt sich ein stimmungsvolles Farb- und Formenspiel, das sich auch in der durchgängigen, 7 m hohen Glasfront der Sporthalle spiegelt. Nur mit einigen ingenieurmäßigen Kniffen ließ sie sich frei von aussteifenden Elementen halten, sodass das Tageslicht gleichmäßig über die gesamte Hallenlänge ins Innere fallen kann. Die serielle und dichte Tragstruktur aus schlanken Querschnitten zieht sich konsequent über alle Gebäudebereiche hinweg, führt damit zu einer überzeugenden Stringenz und außergewöhnlichen Ästhetik. Diese »soziale Nachhaltigkeit« war den Architekten genauso wichtig wie die ökologischen Aspekte. Denn auch wenn die hier verwendeten 2 500 m³ Rohholz einer Menge entsprechen, die laut Planer im Schweizer Wald in 3,21 h nachwächst: Die Ästhetik gilt für sie als Schlüssel für die langfristige Akzeptanz eines Bauwerks in der Gesellschaft und bildete ihr Leitmotiv für das Projekt.
Ingenieurleistung
Möglich wurde diese »soziale Nachhaltigkeit« jedoch erst durch den geschickten Einsatz einer neuen Verbindungstechnik und einer guten Idee seitens der Tragwerksplaner, die früh miteinbezogen wurden. Trotz der Länge von 28,80 m sind die Rahmenriegel bei einer Bauteilhöhe von 140 cm nur 14 cm dick, und die knapp 10 m hohen Stiele mit 14 cm × 80 cm ebenfalls sehr schlank. Um letztere so filigran zu halten, galt es, sie durch einen »ingenieurmäßigen Trick« zu entlasten. Dazu erhielten die Stiele bei der Vorfertigung der Rahmen eine Innenneigung, sodass deren Fußpunkte bei der Montage zur Fixierung in den Stahlgelenken einige Zentimeter nach außen in die Vertikale gezogen werden mussten. Diese Zwangsverformung erzeugt eine Art Vorspann-Moment in der Rahmenecke, das sich teilweise mit dem Moment aus den Vertikallasten des Riegels aufhebt und damit die Stiele entlastet.
Zur schadensfreien Aufnahme aller Lasteinflüsse in der Rahmenecke nutzten die Tragwerksplaner eine neue Verbindungsart, die GSA-Technologie (GSA: Gewinde Stangen Anker). Dabei handelt es sich laut Entwickler um ein kraft- und formschlüssiges Verbundsystem, das sich durch hohe Tragfestigkeit, Steifigkeit und duktiles Verhalten auszeichnet. Die Rahmen und Stiele wurden mit je zwei speziellen Stahlbändern und Bolzenverbindungen im äußeren und inneren Eckbereich sowie einer Gewindestange, die die oberen mit den unteren Stahlbändern verbindet, zusammengeschlossen. Dabei nimmt die Gewindestange den Querzug auf und wirkt Rissen entgegen. Als Dachelemente kamen (unterseitig mit einer Akustikplatte geschlossene) Doppel-T-Platten zum Einsatz, die zwischen die Rahmenriegel gehängt und zu einer Dachscheibe verbunden wurden.
Im zweigeschossigen Gebäudeteil ist die Geschossdecke als Holz-Beton-Verbundkonstruktion ausgeführt mit Unterzügen aus kombiniertem Fichte/Esche-Brettschichtholz und einer Platte aus Gitterträgern und Ortbeton. Da das größte Feld mit fast 11 m Spannweite die 15 t schweren Betonfertigteil-Duschzellen trägt, wurden bei den Unterzügen Verbundanker verwendet, die bisher nur im Brückenbau Verwendung fanden.
Zeichen der Zeit
Die Gebäudehülle bilden Holzrahmenbau-Elemente mit Mineralfaserdämmung und eine Vertikalschalung aus ebenfalls einheimischem, unbehandeltem Fichtenholz, die so mit der Tragstruktur korrespondiert. Im Bereich der Fenster öffnet sich die Schalung lamellenartig, wird halbtransparent, lässt den Betrieb dahinter erkennen und trägt damit wesentlich zum filigranen und homogenen Gesamteindruck bei.
Was am Ende ganz selbstverständlich und einfach daherkommt, ist das Ergebnis einer großen Investition in Ideen und Innovationen. Insgesamt ist die Architektur stringent und wohltuend klar – innen wie außen. Einzig die Fassade könnte das bisherige Erscheinungsbild im Laufe der Zeit stören: Vergrauung und weitere witterungsbedingte Veränderungen der Verschalung werden nicht ausbleiben und Ungleichmäßigkeiten erzeugen. Dessen sind sich die Architekten allerdings bewusst. Sie setzen damit die alpenländliche Tradition im Umgang mit der natürlichen Veränderung von Holz im Außenbereich fort und verstehen diese sich ändernde Patina auch als Teil der Poesie des Gebäudes.db, Do., 2013.05.02
02. Mai 2013 Susanne Jacob-Freitag
Keine falsche Nostalgie
(SUBTITLE) Ferienhaus in Reckingen (CH)
Von außen ist die Umnutzung einer alten Doppelstallscheune in das Ferienhaus »Casa C« im Schweizer Gebiet Goms im Wallis kaum wahrnehmbar. Innen hingegen hat ein junges Züricher Architekturbüro durch den Einbau eines neuen Holzhauses wahre Raumwunder geschaffen. Die dazu notwendigen Bauteile wurden behutsam durch die fragile Außenhülle eingebracht und bilden nun stimmungsvolle Kontraste.
Das Goms zählt auch heute noch zu den entlegenen Regionen der Schweiz; als Hochtal im Osten des Oberwallis erstreckt es sich vom Furkamassiv bis hin zur Geländestufe von Grengiols bei Brig und wird von der Rhone durchflossen, die hier entspringt. Wird das Walliser Rhonetal von Industrie und Durchgangsverkehr geprägt, so hat das Goms seinen dörflich-abgelegenen Charakter bewahrt: Hier kommt man nicht zufällig vorbei, hierher muss man wollen, und im Winter unterbrechen immer wieder Lawinenabgänge die Verkehrsverbindungen. Dennoch ist der Tourismus für die lokale Wirtschaft inzwischen die wichtigste Einnahmequelle. Davon profitieren nicht nur die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, sondern auch die Bauwirtschaft – Siedlungen mit Ferienhäusern umgeben die historischen Dorfkerne, auch wenn sich die Zersiedlung in der Region noch vergleichsweise moderat darstellt.
Dies gilt auch für das 1 300 m über dem Meer liegende Reckingen, das drei Siedlungsbereiche besitzt: das Unterdorf, das weiter am Hang gelegene Oberdorf sowie den jenseits des Flusses gelegenen Dorfteil Überrotten. Beherrscht wird Reckingen von der Pfarrkirche Geburt Mariä, die als wichtigstes Barockgebäude im Oberwallis gilt. Der weiß verputzte Massivbau, der für das doch eher kleine Dorf überdimensioniert wirkt, setzt farblich und materiell einen Gegenakzent zu den das Ortsbild prägenden historischen Holzbauten, die bedingt durch Klima und Sonneneinwirkung nahezu schwarz sind.
Vier Holzhaustypen haben sich im Goms ausgebildet: das Wohnhaus, die Stallscheune, der Speicher und der zur Aufbewahrung der geschnittenen Getreidegarben dienende Stadel. Die hoch aufragenden, aufgeständerten Stadel, die ein Eindringen von Mäusen verhindern sollten, sind eine Besonderheit der Region und erinnern an ähnliche Bauten in Spanien oder Portugal. Ihre Erhaltung stellt eine Herausforderung dar, da sie als Getreidelager überflüssig geworden sind. Das Gleiche gilt für die Stallscheunen, die – urprünglich für Kühe genutzt – heute aus Tierschutzgründen allenfalls noch Ziegen beherbergen können, zumeist aber durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft ohnehin obsolet geworden sind. Die Umwandlung in Ferienhäuser stellt ein übliches Vorgehen dar. Realisiert werden derlei mal mehr, mal weniger überzeugende Umbauten üblicherweise von den ortsansässigen Holzbaufirmen, meist jedoch ohne Architekten.
Erstlingswerk
Im Falle der »Casa C«, zwischen Bahnhof und Kirche im Unterdorf gelegen, wählten die Bauherren einen anderen Weg und beauftragten die in Zürich ansässigen Architekten Marianne Julia Baumgartner und Luca Camponovo, die mit diesem Projekt ihr eigenes Büro camponovo baumgartner architekten gründen konnten. Bei dem bestehenden, z. T. maroden Gebäude, das aus der Zeit um 1890 stammt und dem Ortsbildschutz unterliegt, handelte es sich um ein relativ großes Volumen, das ursprünglich von zwei Eigentümern genutzt wurde und daher durch eine Mittelwand in zwei Hälften getrennt war. Der Aufbau folgte der für das Goms typischen Struktur: Im Sockel die niedrigen Ställe, darüber die hohen, von einem Satteldach überfangenen und innen nicht weiter untergliederten Heukammern. Diverse mit Klappen versehene Öffnungen erlaubten das Einbringen des Heus, über Treppen erreichbare Türen an der Vorderseite dienten der Entnahme. Wie im Goms üblich, fanden bei dem sogenannten Strickbau (Blockbau) nicht Rundhölzer, sondern Kanthölzer Verwendung, die auch im Bereich der Scheune kompakt und nicht – wie etwa im Engadin – auf Lücke gesetzt wurden.
camponovo baumgartner entschieden sich aus gutem Grund, nicht den materiellen Bruch zu inszenieren, sondern den Strickbau mit dem Material Holz fortzuschreiben und möglichst behutsam, aber ohne falsche Nostalgie, der neuen Nutzung anzupassen. Zunächst galt es, die vorhandene Struktur zu ertüchtigen. Unter Verwendung einiger bestehender Elemente musste das Pfettendach fast vollständig neu aufgebaut werden, es erhielt anschließend eine Deckung aus Lärchenschindeln. Überdies war die Struktur des Blockbaus zu stabilisieren. Aus Gründen des Erdbebenschutzes wurden die Fundamente mit Beton verstärkt, die gestrickten Wände im Bereich der Ställe durch Stahlbänder fixiert, die Auflager des Bodens zwischen Stall und Heuboden vergrößert und stählerne U-Profile, die nur im Sockelgeschoss sichtbar sind, in das Tragwerk integriert.
Von dem Raum für die Haustechnik abgesehen – für die Heizung sorgt eine Wärmepumpe samt zwei Erdsonden – wurde die Stallebene nicht zuletzt aus Kostengründen im Rohbau belassen und kann später nach Bedarf ausgebaut werden.
Behutsame Fortführung
Die Wohnräume befinden sich im Bereich der früheren Heuböden. Hier wurde eine zweite Ebene eingezogen und die bestehende Mittelwand an zwei Stellen durchbrochen, um eine kontinuierliche Raumabwicklung zu ermöglichen. Decken und Wände des mit Zelluloseflocken gedämmten Einbaus bestehen ausschließlich aus Birkensperrholz, wobei die Architekten Regale und Schränke an verschiedenen Orten als Einbauten integrierten; Heizkörper sind hinter mit Lochrastern versehenen Platten versteckt. Lärchenholz wurde für den Boden und die Fenster verwendet.
Eine der wichtigsten Entwurfsideen war die hinsichtlich ihrer räumlichen Wirkung überzeugende Entscheidung, den beheizten Bereich des Einbaus nicht überall an die Außenwand des Bestandsgebäudes zu führen. In beiden Haushälften springt die Wand des Einbaus an einer Stelle zurück, sodass sich im Eingangsbereich, aber auch auf der Rückseite unbeheizte, loggienartige Zwischenzonen ergeben. Diese lassen Dimension und Materialität des Bestands anschaulich werden, vergrößern aber auch optisch die zu den Zwischenzonen sich öffnenden Wohnräume.
Der spannungsreiche Wechsel zwischen Räumen unterschiedlicher Proportionen macht den besonderen Reiz des Hauses aus. Der Eingangskorridor, an den sich Gästezimmer und -bad anlagern, führt in den beide Geschosse übergreifenden Bibliotheks- und Kaminraum. Eine Stufe hinauf gelangt man über den Durchbruch in der Mittelwand in den anderen Hausteil, wo sich ein winkelförmiger Wohn- und Essraum mit vorgelagerter Loggia und die Küche anschließen. Von hier führt eine Treppe in das OG mit einem großen Flur und zwei Schlafräumen. Sie werden z. T. über Fenster zu den Innenzonen (Bibliotheksraum, Loggia) belichtet.
Die Zwischenzonen und doppelgeschossigen Räume verringern zwar die Nutzfläche des Hauses, schaffen aber eine faszinierende räumliche Qualität – durch den Wechsel von hohen und niedrigen, offenen und eher geschlossenen, kleinen und großen Raumzonen. Nicht zuletzt wird in ihnen der Kontrast zwischen dem alten Holzbestand und dem neuen Einbau erlebbar, ein Kontrast, den man auch als konsequente Fortführung des Holzbaus mit zeitgenössischen Mitteln verstehen kann.db, Do., 2013.05.02
02. Mai 2013 Hubertus Adam
Der Wald kommt in die Stadt
(SUBTITLE) Das Wälderhaus in Hamburg
Wie kann man Stadtmenschen die Bedeutung des Waldes, seine Eigenheiten und Besonderheiten am besten erläutern? Indem man ihnen den Wald vor die Füße legt, statt darauf zu warten, dass sie zu ihm hinfahren und ihn selbst erkunden. So geschehen in Hamburg-Wilhelmsburg, wo nun, u. a. durch Mitwirken der IBA, das Wälderhaus entstanden ist. Zu einem Großteil aus Holz konstruiert und mit Lärchenholz bekleidet, zeigt das Ausstellungs- und Hotelgebäude, dass das Baumaterial auch in den großstädtischen Kontext passt.
Die Zukunft sieht manchmal ziemlich altbekannt aus. Gleich neben dem S-Bahnhof Wilhelmsburg wird derzeit das Zentrum der Internationalen Bauausstellung Hamburg, die »neue Mitte Wilhelmsburg«, fertiggestellt. Die hier errichteten Häuser sollen nichts weniger als »neue Bautypologien begründen« und »Antworten geben auf die Frage, wie wir in Zukunft bauen und wohnen werden«. Das Überraschende: Neben Hightech-Gebäuden mit Mikroalgenfassaden, Latentwärmespeichern oder Photovoltaik-Textilmembranen zählen zu den »Case Study Houses des 21. Jahrhunderts« auch solche aus dem ältesten Baumaterial der Welt: Holz. Zu ihnen gehören der »Woodcube« (architekturagentur, s. S. 46) oder etwa das »CSH Case Study Hamburg« (Adjaye Architects/planpark architekten).
Östlich dieses Quartiers, gleich neben der Wilhelmsburg durchschneidenden Fernbahntrasse, steht ein weiterer, ungleich größerer Holzbau, das sogenannte Wälderhaus. Dass dieses Gebäude hier im Rahmen der IBA entstand, war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), ein Naturschutzverband, der sich für den Erhalt der Wälder einsetzt, wollte sein Schulungs- und Informationszentrum ursprünglich ganz woanders, im Niendorfer Gehege – einem Waldgebiet im Hamburger Bezirk Eimsbüttel – errichten. Es war der lokale CDU-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse, zugleich Geschäftsführer des SDW-Landesverbandes Hamburg, der sich für die Ansiedlung des Multifunktionshauses in diesem Buchenmischwald im Hamburger Nordwesten stark machte. Doch schnell entzündete sich, unterstützt von SPD und Grünen, Bürgerprotest – man störte sich an den Dimensionen des Gebäudes sowie seiner Lage mitten im Wald, die zur Fällung einiger Bäume geführt hätte. Ein Bürgerbegehren war schließlich erfolgreich und stoppte die Planungen. Die SDW musste nach Alternativen suchen und fand in der IBA einen Partner, der großes Interesse am Wälderhaus zeigte. So konnte schließlich der neue Standort im zentralen IBA-Bereich von Wilhelmsburg präsentiert werden. Das war ein gelungener Coup, denn nun müssen Besucher nicht an den Stadtrand fahren, sondern der Wald kommt gewissermaßen zu ihnen in die Stadt – wichtig gerade für sozial benachteiligte Stadtteile wie Wilhelmsburg, in denen viele Kinder noch nie in einem Wald waren. Und die IBA, sie erhält ganz nebenbei eine weitere Attraktion in den so wichtigen Themenfeldern Bildung und Nachhaltigkeit.
Die Gebäudehülle als Biotop
Die neue Idee eines Wälderhauses mitten in der Stadt bedeutete für die Architekten von Andreas Heller Architects & Designers weitreichende Änderungen im Konzept: Ursprünglich planten sie einen flachen, nur zweistöckigen Bau, der den Blick auf die Bäume möglichst wenig verstellt. Nun galt es, ein kompakteres, höheres Gebäude mit Landmarkenwirkung zu entwickeln, dass das Thema Wald schon von außen zeichenhaft verkörpert. Als zusätzliche Nutzung sollte ein Hotel mit 82 Zimmern integriert werden. So ist das Wälderhaus nun Ausstellungs- und Schulungsgebäude, Hotel und Gastronomiebetrieb in einem. Für diese Mischung schufen die Planer einen sacht mäandernden, horizontal gestaffelten Baukörper. Nicht nur die gewinkelte, sich verjüngende Form, auch die Fassade aus (unbehandeltem) Lärchenholz lässt an einen Baum denken oder weckt – etwas abstrakter – Assoziationen zu Natur und Wildnis inmitten eines städtischen Umfelds. Mit zahlreichen Nischen und Pflanzinseln versehen, soll sie zahlreichen Kleinstlebewesen Rast-, Futter- und Nistgelegenheiten bieten. Ähnlich das riesige Gründach: Dort sollen, wenn denn einmal der Frühling einkehrt, außerdem 9 000 Büsche und 500 Hainbuchen das Mikroklima, die Luftqualität und den Lärmschutz am Standort verbessern. Das Haus als Biotop – ein bemerkenswerter Ansatz in Zeiten sich immer hermetischer abschließender Gebäude.
Mit wenigen Mitteln IN eine andere Welt
Eine sich über fünf Geschosse erstreckende Holzfassade war in den bislang geltenden deutschen Brandschutzregeln nicht vorgesehen, wurde aber durch die vorweggenommene Anwendung der Mitte 2012 eingeführten Eurocodes-Richtlinien möglich, die mehr Variationen im vorbeugenden Brandschutz bieten. Brandschutzgründe waren es jedoch, die verhinderten, dass das gesamte Gebäudeinnere in Holz errichtet wurde. Die beiden unteren Etagen sind konventionell in Stahlbeton-Bauweise gebaut und nur außen mit Holz bekleidet. In diesen Stockwerken befinden sich Hotel-Empfang, Wälderhaus-Kasse, ein Café/Restaurant sowie das Wälderhaus-Science Center. Die Architekten verstecken die kühle Betonkonstruktion nicht, doch durch zahlreiche hölzerne Ausstattungselemente wie Regale, Tresen, Sitzbänke, Stühle nimmt man ihr die Härte und führt das Thema Holzhaus fort. Zu beklagen sind jedoch die aus Kostengründen »offen« gelassenen Decken, unter denen sich, notdürftig kaschiert durch darunter drapiertes Astwerk, Lüftungs- und Heizungsrohre winden – schnöde Technik statt romantisches Naturerlebnis. Betritt man freilich das Science Center, ist dies schnell vergessen, denn wie schon beispielsweise beim Auswandererhaus in Bremerhaven schaffen es die Architekten, mit wenigen Mitteln den Besucher in eine andere Welt zu entführen – hier in die des Waldes. An 80 Stationen gibt es vielerlei spielerisch zu entdecken, wobei besonders die großen Schaukästen und präparierte Pflanzen und Tieren mit ihrem illusionistischen Spiel beeindrucken.
Sicher ist sicher
In den oberen drei Etagen ist das Raphael Hotel Wälderhaus untergebracht. Diese Stockwerke sind, vom Tragwerk über die Böden bis zu den Wänden, vollständig in Massivholz errichtet. Möglich wurde diese Holzbauweise ebenfalls durch die neuen Eurocodes-Richtlinien, die eine Bemessung der Bauteile über den Abbrand erlauben. Dabei ist jedes Zimmer des Hotels eine in sich abgeschlossene F90-Einheit: So sind die Trennwände zwischen den Räumen zweischalig (jeweils 9 cm Fichten-Brettsperrholz mit innenliegender 8 cm Steinwolledämmung) ausgeführt. Diese Redundanz sorgt – zusammen mit einer Falzausbildung der Deckenelemente – dafür, dass die Deckenlast bei Beeinträchtigung der einen Wand noch durch die zweite Wand getragen werden kann. Öffnungen sind zudem mit Deckenbrandschotts (Bekleidung aus GFK-Platte, Ausmörtelung mit Brandschutzmörtel) bzw., im Bereich der Fassadenstürze, mit dreiseitig umlaufenden, 20 cm dicken Brandschutzlaibungen (Sandwichkonstruktion aus Lärchenholz) versehen. Im Brandfall kann so ein Übergreifen von Flammen in die Fassadenkonstruktion oder in ein anderes Geschoss verhindert werden. Außerdem soll eine hohe Zahl von Rauchmeldern und Sprinklern rasch jeden Brandherd erkennen und löschen.
Von diesem Aufwand bemerkt der Gast freilich wenig bis gar nichts. Stattdessen spürt er die Atmosphäre des Naturmaterials – man fühlt sich geborgen wie in einer großen Blockhütte. Die Zimmer besitzen eine außerordentliche Behaglichkeit: Die Wände und Decken aus den sichtbar belassenen, großformatigen Holzelementen dämpfen den Schall, sorgen für ein ausgeglichenes Klima und verströmen einen milden Duft. Auch die Außenwände bestehen innenseitig aus den massiven Brettsperrholz-Elementen, auf die eine Steinwolledämmung und die äußere Lärchenholzbekleidung folgen. Dass trotz all des Naturholzes die Räume niemals rustikal wirken, liegt an der einfachen, aber modernen und liebevollen Ausstattung. So hat jedes Zimmer seinen eigenen Namen (Wacholder, Süntelbuchen oder Kulturbirne) und besitzt entsprechend Exponate in Form von Ästen, Früchten, Fotografien und Informationstexten zur jeweiligen Baumart. Mit ein wenig Einbildung meint man sogar, dass die Zimmer unterschiedlich duften …
Fragwürdig erscheint jedoch, dass das nachhaltige und durchaus kostengünstige Lowtech-Holzhaus-Konzept des Wälderhauses um weitere aufwendige und teure Energieeinsparmaßnahmen ergänzt und damit verwässert werden musste. So wurde eine PV-Anlage auf dem Dach installiert, mit einer großen Geothermieanlage aus 94 Energiepfählen die Erdwärme angezapft und das Gebäude an das lokale Nahwärmenetz angeschlossen. Die Haustechnikanlage des Gebäudes ist entsprechend komplex und nimmt immense Flächen im EG ein. Damit der Hotelbereich Passivhausstandard erreicht, gibt es dort, neben dicken Dämmungen und Dreifachverglasungen, eine mechanische, individuell regelbare Grundlüftung mit Wärmerückgewinnung. Man wohnt nun ziemlich abgeschottet von der Umgebung – nicht unbedingt das, was man mit einem naturnahen Wohnen im Waldhaus in Verbindung bringt. Hier wäre – trotz allem IBA-Exzellenzanspruchs – weniger wohl mehr gewesen. Das ist schade, denn die Idee eines Holzhauses, das anschaulich, lehrreich und sinnlich den Wald in die Stadt bringt, ist wunderbar und wurde von den Architekten in bemerkenswerter Weise umgesetzt.db, Do., 2013.05.02
02. Mai 2013 Claas Gefroi