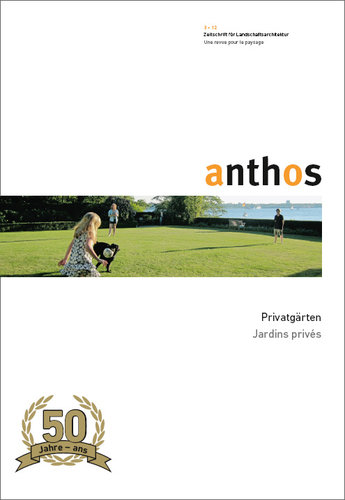Editorial
Die Neuanlage oder Restaurierung von Privatgärten ist für viele das Sahnehäubchen im weiten Aufgabenfeld der Landschaftsarchitektur. Nur wenige Landschaftsarchitekten aber haben auch durch ihre Gartengestaltungen Bekanntheit erlangt. Derzeit scheint das Thema populär: Gartenschauen, -messen und -ausstellungen erzielen Besucherrekorde, immer mehr private Gartenliebhaber öffnen ihre Schmuckstücke für Besucher, die Liste der Fachpublikationen wächst rasant und auch die Boulevardpresse ist stetig neuen Trends – wie etwa der Verschiebung des Gartens vom Repräsentationsobjekt zum erweiterten Wohnzimmer – auf der Spur.
Welch breite gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Tragweite Gärten haben, zeigt auch ein Blick in die Statistiken:
1997 waren insgesamt 279 095 Hektaren der Schweiz Siedlungsflächen, davon 2.4 % Gebäudeumschwung und Garten. (BFS 2012).
2010 arbeiteten in der Schweiz Frauen im Schnitt 2.2 Stunden pro Woche im Bereich «Haustiere, Pflanzen, Garten», Männer 1.7 Stunden. 1997 waren es noch 3.2 zu 2.6 Stunden. (BFS 2012)
2011 verfügten 90 % der Haushalte Frankreichs an ihrem Wohnort über einen Platz zum Gärtnern: 59 % haben einen Garten, 47 % eine Terrasse, 32 % einen Balkon und 50 % ein bepflanzbares Fensterbrett. (FNMJ / Promojardin)
2005 lag der Umsatz im Gesamtmarkt Garten in Deutschland bei 17.2 Millionen Euro, die Umsatzentwicklung zwischen 2002 und 2010 bei plus 17 %. (Statista 2012)
2010 waren in Österreich von den 36 542 unter Denkmalschutz stehenden unbeweglichen Objekten 26 Garten- und Parkanlagen sowie 265 Gartenbaudenkmale. (Statistik Austria 2012)
2011 hatten 77 % der Privatgärten Frankreichs eine Rasenfläche und 38 % einen Gemüseteil. (planetoscope 2012)
2010 war in Deutschland das Fleissige Lieschen (Impatiens walleriana) mit einem Marktanteil von 2 % Spitzenreiter bei den Beet- und Balkonpflanzen. (Statista 2012)
2009 passierte mehr als ein Fünftel (22 %) der spitalbehandelten Heim- bzw. Freizeitunfälle Österreichs in der näheren Wohnumgebung wie dem Garten. (KfV 2009)
In der Schweiz verteilt sich rund die Hälfte der Tieflohnstellen auf vier Wirtschaftszweige, darunter «Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau» mit 6.7 % im Jahr 2010. (BFS 2012)
Was Gartenliebhaber und -experten in aller Welt eint: sie legen ihre kleinen Paradiese mit ähnlichen Mitteln und Zielen an. Der Garten ist ein weltumspannender Gegenentwurf zum Alltag, die Sehnsucht nach dem Anderen. anthos stellt 13 zeitgenössische Beispiele vor. Viel Vergnügen.
Sabine Wolf