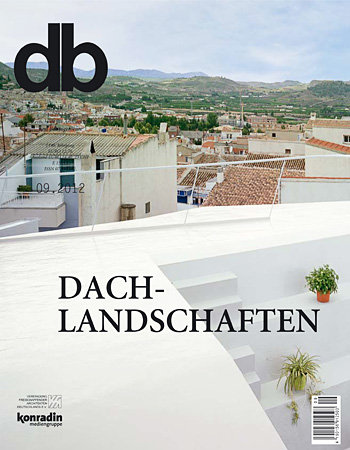Editorial
Der Blick auf die Dächer einer Stadt zeigt mehr als die Summe von Dachgeschossen. Es offenbart sich vielmehr ein komplexes Zusammenspiel zahlloser Volumina von unterschiedlicher Geometrie und Materialität. Dem Reiz, den diese ganz eigene abgehobene Welt der Dachlandschaft entfaltet, kann sich kaum ein Betrachter entziehen. Die Fantasie der Architekten und Planer, daran weiterzubauen und eigene Akzente zu setzen, wird geradezu beflügelt.
Bei den in dieser Ausgabe vorgestellten Projekten wurden die Grenzen von Anpassung und Innovation ausgelotet, um zu einer jeweils maßgeschneiderten Lösung zu gelangen. Dabei schaffen die Architekten attraktive Außenräume mit Ausblick für das Thermalbad in Zürich (S. 14), erwecken schlummernde Raumreserven auf einem Kaufhaus in Graz zum Leben (S. 22) oder verwirklichen trotz exponierten Baugrunds sehr kostensparend eine Wohnhausaufstockung im spanischen Cehegín (S. 30). Sie leisten ein Stück Stadtreparatur mittels eines Schutzdachs in Cartagena (S. 36), machen die besondere Bedeutung eines Museums in Basel über dessen Dachhaut ablesbar (S. 42) oder tragen mit einem rege genutzten gemeinschaftlichen Dachgeschoss zu einer seit 25 Jahren funktionierenden Hausgemeinschaft in Berlin bei (S. 50). | Martin Höchst
(K)ein Dach wie jedes andere
(SUBTITLE) Wohnhausaufstockung In Cehegín (E)
Auch wenn es zunächst nicht danach aussieht – diese Aufstockung unterscheidet sich von den umliegenden Häusern weniger durch die fließenden Formen, die fragile Dachreling oder die einheitliche Polyurethanbeschichtung der Gebäudehülle, als vielmehr durch ihre wunderbare Inszenierung von Außenraumbezügen.
Abseits der Touristenzentren am Mittelmeer liegt die südostspanische Kleinstadt Cehegín in einer der trockensten und sonnigsten Regionen Europas. Umgeben von einem kompakten Stadtgefüge sowie einem Gürtel aus Gewerbebetrieben und vereinzelten Eigenheimen, bildet ein Kirchplatz den höchsten Punkt der kleinen Altstadt. Von hier aus schweift der Blick über eine karge Hügellandschaft mit Wäldern, Marmorsteinbrüchen, Mandel-, Oliven- und Pfirsichbaumplantagen. Obwohl auf einer Anhöhe am südlichen Stadtrand gelegen, und obwohl es sich hierbei um das derzeit mit Abstand ungewöhnlichste Bauwerk der Stadt handelt, ist die Casa Lude von hier aus kaum zu erkennen.
Klar, die auf ein zweigeschossiges Wohnhaus der 60er Jahre aufgepflanzte Aufstockung liegt knapp einen Kilometer entfernt, verfügt über eine Grundfläche von nur 81 m² und ist nicht höher als seine Nachbargebäude. Aus der Nähe wirkt sie weit weniger spektakulär als Fotos es vermuten lassen. Da das Nebeneinander unterschiedlicher Kubaturen und Gebäudeformen hier ebenso zur Normalität gehört wie große fensterlose Wandflächen, schräge Dächer, auskragende Erker und weitläufige Dachterrassen, integriert sich der Neubau – trotz aller Expressivität – städtebaulich erstaunlich gut in sein Umfeld. Dass es darüber hinaus freilich keinerlei Gemeinsamkeiten gibt, zeigt am deutlichsten ein Rundgang durch sein Inneres.
Strasse und Landschaft im Leuchtkasten
Der Weg dorthin führt zunächst ins dunkle Treppenhaus des L-förmigen Nachbargebäudes – eine eigene Treppe gab es auch vor 20 Jahren nicht, als die Eltern des Bauherrn das Haus kauften. Befand sich hinter der Tür im 2. OG vor Baubeginn lediglich eine Abstellkammer mit begehbarer Dachfläche, offenbart sich dort heute ein zweigeschossiges, weitgehend weißes und scheinbar lediglich aus Licht und Schatten bestehendes Raumkontinuum. Das anfängliche Gefühl fast klösterlicher Introvertiertheit verschwindet unmittelbar nach Durchqueren des sparsam möblierten Wohn-Ess-Kochbereichs, wenn Straßenraum und dahinter liegende Berge in den raumhohen Erkerfenstern wie ein sorgsam inszeniertes Großformatdia im Leuchtkasten erscheinen. Wirklich überwältigend sind aber erst die Aussicht von der Dachterrasse im oberen Geschoss und das 360°-Panorama auf der Dachfläche. Umso verwunderlicher ist es, wenn beim Blick über Cehegín und die weitläufige Hügellandschaft auffällt, dass keines der Nachbargebäude über ähnliche Außenraumbezüge verfügt und Dächer entweder gar nicht, nur zum Wäschetrocknen, als Ablageflächen für Sperrmüll oder zur Unterbringung von Haustieren genutzt werden.
Sämtliche Vorzüge dieses Bauplatzes in sieben Metern Höhe voll auszuspielen – diese Idee bildete für Martín López, Architekt und Partner im Büro Grupo Aranea, den Ausgangspunkt der Planung. Konkrete Entwurfsvorgaben erhielt er zuvor weder vom Auftraggeber, ein Grundschul- und Musiklehrer und Jugendfreund, noch von dessen im unteren Teil des Gebäudes wohnenden Verwandten. Dafür zeigten sie sich alle erstaunlich aufgeschlossen und ließen den Architekt nach zahlreichen gemeinsamen Vorgesprächen mehr oder weniger unbehelligt an die Arbeit gehen.
Funktionalität statt akademischer Kunstintervention
Nach Präsentation des ersten Konzepts, das letztlich ohne grundlegende Veränderungen realisiert wurde, rieb sich die Familie zunächst erstaunt die Augen. Zahlreiche Papp- und CAD-Modelle machten jedoch schnell klar, dass die für lokale Sehgewohnheiten ungewöhnliche Architektursprache und die fließenden Räume keine akademische Kunstintervention darstellten, sondern eine auf die Bedürfnisse des alleinstehenden Bauherrn zugeschnittene, überaus funktionale Maisonettewohnung. Beispielsweise ermöglicht die Lage der Erkerfenster im offenen Wohn-Ess-Kochbereich bzw. Schlafzimmer nicht nur den gerahmten Blick in die Umgebung, sondern auch ein hohes Maß an Privatsphäre, während die schattenspendenden äußeren Rahmen dafür sorgen, dass in den heißen Sommermonaten zwar viel Licht aber keine direkte Sonneneinstrahlung in die Wohnung gelangt. Bei geöffneten Fenstern durchströmt am Nachmittag außerdem ein angenehm kühler Ostwind die Innenräume, weshalb auf eine Klimaanlage – zumindest bisher – verzichtet werden konnte.
Im oberen Geschoss befinden sich u. a. offene Arbeitsbereiche sowie die nach Osten ausgerichtete Terrasse, auf der es v. a. an heißen Sommernachmittagen angenehm kühl bleibt. Die über steil ansteigende Sitzstufen erreichbare, komplett nutzbare Dachfläche eignet sich hingegen eher für die Wintermonate oder sommerliche Abend- und Nachtstunden. Zur komfortablen Nutzung dieser Fläche stehen in einer niedrigen Wandscheibe Beleuchtungselemente, Wasser- und Stromanschlüsse bereit. Dass Partys am besten mit begrenzten Alkoholmengen und ohne Kleinkinder stattfinden sollten, versteht sich angesichts der filigranen Dachreling von selbst. Die über zwei Geschosse wogende Metallrohrkonstruktion resultiert aber nicht nur aus dem Willen nach einem eleganten Kontrast zur kantig kristallinen Form der Aufstockung; sie ist vielmehr auch unmittelbare Folge baurechtlicher Einschränkungen – massive Brüstungen hätten schlicht zu einer Höhenüberschreitung geführt.
Den Baubeginn markierte der Abbruch der alten Dachdecke über dem 1. OG. Diese Maßnahme war notwendig geworden, um eine tragfähige Grundlage für die darüber geplante Skelettkonstruktion aus Stahlstützen und Betondecken zu schaffen. Grundsätzlich hatte sich die Statik des Sockels als tragfähig erwiesen, sodass der Einbau zusätzlicher Tragstrukturen überflüssig war – u. a. auch weil vertikale Lasten des Neubaus ausschließlich direkt in die bestehenden Wände des Altbaus einfließen. Und um Gewicht zu sparen, wurden zwischen die statisch wirksamen Bereiche der Stahlbetondecke großflächige Styroporelemente eingelegt. Die Decken zum DG und zur Dachfläche liegen auf dünnen Stahlstützen, sämtliche Innen- und Außenwände sind aus nichttragendem Mauerwerk ausgeführt. Eine reine Stahlkonstruktion kam allein aus Kostengründen nicht infrage. Zugleich hätte sie aber auch über zu wenig Speichermasse für die wärmende Wintersonne verfügt – aufgrund der Lage Cehegíns knapp 600 m über dem Meeresspiegel sind Winternächte mit mehreren Minusgraden keine Seltenheit. Daher erhielten alle Außenwände und -decken mit Gipskartonplatten verkleidete Innendämmungen. Nach außen wurden die gemauerten bzw. betonierten Wände und Decken zunächst glatt verputzt und dann mit einer dreilagigen grauen, als Dachabdichtung und fertige Fassadenoberfläche dienenden Polyurethanbeschichtung überzogen. Die Farbauswahl basiert dabei nicht zuletzt auf finanziellen Überlegungen. Zur Ausführung kam Grau – Farbtöne außerhalb der vier Standardfarben Rot, Grün, Weiß und Grau – hätten zwar problemlos gemischt werden können, wären aufgrund der kleinen Fläche unverhältnismäßig teuer geworden.
Die Einhaltung des relativ knappen Baubudgets war bei fast jeder Entscheidung bestimmend: bei der Polyurethanbeschichtung und der Dachreling ebenso wie bei der Wahl der hybriden Primärkonstruktion und den Styroporeinlagen in der Decke. Dennoch entstand ein konstruktiv vielleicht etwas heterogener, aber in sich konsequenter und v. a. räumlich absolut stimmiger Dachaufbau. Dass die Gebäudehülle heute nicht mehr ganz so elegant in der Sonne schimmert wie kurz nach der Fertigstellung, liegt an den seltenen, mitunter aber sehr heftigen Regenschauern, die sich mit abgelagertem Staub mischen und an den Fassaden Schlieren hinterlassen – der größte Teil des auf der Dachfläche anfallenden Niederschlags wird über einen am Fuß der Dachreling angebrachten Stahlwinkel in ein vertikales Fallrohr geleitet. Die etwas verblasste Fassade vermag die einzigartige Ausstrahlung der Casa Lude jedoch kein bisschen zu schmälern. Im Gegenteil: Sie lässt die Aufstockung in ihrem Umfeld noch selbstverständlicher wirken. Und auf die wunderbare Inszenierung von Raum und emporgehobenem Außenraum hat sie ohnehin keinen Einfluss.db, Mo., 2012.09.10
10. September 2012 Roland Pawlitschko
Höchste Ambitionen
(SUBTITLE) Kaufhausumbau und -Aufstockung in Graz (A)
Das Kaufhaus Kastner & Öhler ist bekannt für Expansion auf höchstem Niveau – momentan auf Augenhöhe mit den historischen Ziegeldächern von Graz. Der neue Dachaufbau des Stammhauses wird zwar von den UNESCO-Hütern der Altstadt kritisiert, fügt sich aber dennoch ganz selbstverständlich in die Grazer Dachlandschaft.
Die Geschichte dieses Warenhauses, das seit 1883 in der Altstadt von Graz sein Stammhaus hat, zeigt, dass Innovation in diesem Unternehmen nicht nur für den Handel, sondern immer wieder auch für bauliche Erweiterungen angestrebt wurde. Nicht lange nach der Gründung der Grazer Filiale wurde der Kauf von weiteren Bürgerhäusern in der Sackstraße beschlossen, die dem Neubau eines Warenhauses (1912-14, Architekten Fellner und Helmer) weichen mussten, das zu den prunkvollsten und innovativsten dieser Zeit zählte.
Prosperierender Verkauf und Versand führten zu mehreren Aus- und Umbauten des Stammhauses, dem in den 60er Jahren die Glaskuppel der Halle und bald darauf die offenen Galerien zum Opfer fielen. Geschickte Expansionspolitik führte zum Ankauf von Häusern im Karree und auch auf der anderen Seite des Flusses, wann immer sich eine günstige Gelegenheit bot. 1990 war das Unternehmen im Besitz von Gebäuden aus vier Jahrhunderten – heterogene Bausubstanz, die ohne umfassende Planung nicht mehr in ein gut funktionierendes räumliches Kontinuum zu bringen war. Dringender Handlungsbedarf war gegeben. Die Grazer Architekten Szyszkowitz und Kowalski erhielten den Auftrag, ein Konzept der »Corporate Identity« zu entwickeln, das den Zusammenschluss der Häuser in den Gassen rund um das Stammhaus vorsah, ohne ihnen ihre Charakteristik zu nehmen – eine Aufgabe, die gekonnt bewältigt wurde. 2003, im Jahr, als Graz Europas Kulturhauptstadt war, fanden die Um- und Ausbauphasen mit einer konstruktiv aufwendigen Tiefgarage für 650 Autos ihren Abschluss, die fünf Geschosse tief, großteils unter historischem Bestand errichtet wurde.
Mehr als ein neues Dach
2005 war das Unternehmen auf 1500 Mitarbeiter angewachsen und zwei junge Vertreter der fünften Generation hatten die Geschäftsführung übernommen. Im Zuge eines weiteren geplanten Ausbaus der Verkaufsflächen wurden 2005 in einem geladenen, international ausgerichteten Wettbewerbsverfahren Ideen zur Neugestaltung der Dachzonen gefordert. Ein Konglomerat aus unansehnlichen Industriedächern, das den Blick auf die pittoreske Dachlandschaft der Grazer Altstadt, die seit 1999 Kulturerbestätte ist, empfindlich störte, sollte ersetzt werden. In einer ursprünglich nicht vorgesehenen Überarbeitungsstufe von drei Projekten konnten Nieto y Sobejano aus Madrid den Wettbewerb für sich entscheiden.
Ihr Projekt ist eine variantenreiche Sequenz scharfkantig geschnittener, unterschiedlich breiter, hoher und langer Aufbauten in Zeilenform, die in Form und Farbe eine Assoziation mit den historischen Steildächern mit Ziegeleindeckung hervorrufen soll. Bald nach der Wettbewerbsentscheidung, die in der Stadt breite Zustimmung fand, meldete ICOMOS, der internationale Rat für Denkmalpflege, Vorbehalte gegen die radikal moderne Dachlandschaft an und drohte Graz mit der Aberkennung des Status' als Weltkulturerbe, sollte das Projekt unverändert realisiert werden. Schließlich konnte über die Reduktion der Höhen eine Zustimmung erreicht werden, wohl auch deshalb, weil Konsens darüber bestand, dass der Standort des traditionsreichen Warenhauses (im Zuge des Ausbaus wurden 10 000 m² an zusätzlicher Verkaufsfläche geplant) in der Innenstadt erhalten bleiben muss.
Am 20.10.2010 wurden Dach und Kaufhaus, das bei laufendem Betrieb umgebaut wurde, feierlich eröffnet. Der Dachaufbau: Ein Ensemble von dicht aufeinander folgenden, schräg aufragenden Oberlichtbändern, die von Terrassen unterbrochen sind, die in Größe und Lage vom Wettbewerbsprojekt differieren. Zwei der Aufbauten mit den horizontal gekappten Gratabschlüssen ragen deutlich über die anderen hinaus – eine Akzentuierung der Dachlandschaft, die den Architekten aus stadträumlicher Sicht wichtig schien. Der Hochpunkt im Süden überdeckt die darunterliegende Halle im Stammhaus mit den stuckverkleideten Stützen und Galerien, in der die Rolltreppen nun alle Verkaufsebenen und das neue Café im DG erschließen. Jener im Norden verweist auf den Übergang zum zweiten, vormals unabhängigen historischen Gebäude, das nun, nach dem Umbau, mit ersterem zu einem Haus verschmolzen ist.
Das leichte Tragwerk
Als Tragwerk kam ein Stahlfachwerk zum Einsatz. Es wurde auf eine neu errichtete Geschossdecke aufgesetzt, da der vormalige Dachabschluss nicht tauglich war. Die Lasten werden teils über Wandscheiben, teils direkt über die neue Decke auf die bestehenden Stützen verteilt, die sich als sehr tragfähig erwiesen und nur z. T. ertüchtigt werden mussten. Der Dachaufbau ist konventionell: innen Gipskartonplatten, dann eine mineralische Dämmung, darüber ein Aluminiumblech mit Stehfalzen mit Trapezblech als Unterkonstruktion. Die Dachhaut spart im Bereich des Cafés große Bandfenster aus, die im Zusammenspiel mit dem strahlenden Weiß der Wand- und Deckenoberfläche und der Belichtung durch die Sheds für eine wunderbar helle, freundliche Atmosphäre des Raums sorgen. Die Shedverglasung ist überwiegend nach Norden ausgerichtet. Wo Licht von Süden einfällt, ist es durch feststehende Verschattungselemente gedämpft.
Cafélounge und Bar im DG stehen über den Luftraum der zentralen Halle in direkter räumlicher Verbindung mit den Verkaufsebenen und können deshalb nur im Zusammenhang mit den fünf Geschossen des Warenhauses klimatisiert werden.
Innere Stimmigkeit, Äussere Fehlinterpretation?
Glücklicherweise wirkt dieser Dachaufbau aus keinem Blickwinkel wie ein Dachausbau klassischer Prägung. Ihm fehlt die Gedrungenheit »stürzender« Wände, jeglicher Anflug von Rustikalität. Das Dachvolumen ist einladend hell. Seine Qualität liegt in der Bewegtheit der gefalteten Decke mit ihrer stark differenzierten Höhenentwicklung und in der Steilheit der Schrägen. Die weißen Wände, der Einsatz dezenter Grautöne und das satte Braun der Möblierung aus edlem Nussholz unterstützen die großzügige Raumwirkung.
Ein wesentliches Qualitätselement ist die Terrasse, die einen atemberaubenden Ausblick zum Schlossberg und auf die umliegenden Ziegeldächer bietet. Vom weit auskragenden Balkon lassen sich, tief unten, die belebte Straße vor dem Warenhaus, Hauptplatz und Rathaus überblicken. Kein Wunder, dass das Café selbst an regnerischen Tagen gestürmt wird.
Vermutlich wird kaum einem Besucher, der die Aussichtsterrasse betritt, auffallen, dass die Dachlandschaft des Kaufhauses noch nicht fertiggestellt ist. Vielleicht wird man feststellen, dass zur Freifläche im Norden des Cafés kein Ausgang führt, dass sie noch ihren Unterboden zeigt. Nur wenige Eingeweihte, die sich an die einst kursierenden Renderings erinnern, werden erkennen, dass im nördlichen Teil des Dachs noch drei Sheds fehlen und hier eine Lücke klafft. Dies lässt sich nur in der Übersicht vom nahen Schlossberg her entdecken. Vielleicht erinnert sich manch ein Stadtbewohner jedoch an das riesige Transparent außen am Dach des damals noch nicht lange eröffneten Cafés, auf dem zu lesen war, dass die derzeitige Dachfarbe Grau noch nicht die endgültige sei, sondern durch einen Bronzeton ersetzt werden wird. Die farbliche Anpassung und Eingliederung der neuen Dächer in die historische Dachlandschaft war ein wesentliches Kriterium für die Jury, das Projekt von Nieto y Sobejano zur Realisierung zu empfehlen, die ungewöhnliche Form der Information ist als Reaktion des Unternehmens auf die immer wieder auch in den Medien aufgeworfene Thematik des Ist-Zustands zu sehen. Auf Nachfrage bei den Architekten erfährt man, dass die Aufbringung der farbgebenden Paneele, die auf die jetzige Oberfläche aufgesetzt werden soll, erst nach der endgültigen Fertigstellung des Dachausbaus Sinn mache, weil sie andernfalls unterschiedlich verwittern würden. Nachdem der Eindruck einer geschlossenen Dachhaut entstehen soll, ist geplant, auch die Fensteröffnungen zu überziehen, allerdings perforiert.
Ob diese Information die gestrengen Hüter des Weltkulturerbes besänftigen würde, darf bezweifelt werden. Im ICOMOS Band der Reihe »Heritage at Risk«, dem Weltreport 2006/2007 über Denkmäler und historische Stätten in Gefahr, der nach der Einigung auf die Reduktion der Dachhöhen erschien, wird von einem Disaster, einer total inadäquaten und missverstandenen Interpretation einer mittelalterlichen Dachlandschaft ohne Verbindung zur Gebäudetypologie gesprochen. Letzteres mag zutreffen, aber eines ist gewiss: Die Wiederherstellung des historischen Dachs als einzige Möglichkeit, die offensichtlich für ICOMOS vorstellbar gewesen wäre, hätte sicher nicht diese räumliche Qualität des Dachausbaus gebracht, die den Besuch des Kaufhauses heute auszeichnet. Sie wäre mittelmäßig und unzeitgemäß gewesen. Und letztlich ebenso täuschend wie der mit der erhaltenen historischen Fassade getarnte Neubau des nördlichen Hauses, das völlig entkernt wurde, um den Ansprüchen an ein heute erwartetes Einkaufserlebnis zu entsprechen. Viele der Grazer, die vom Schlossberg aus die Dachlandschaft der Altstadt ins Visier nehmen, und auch Besucher, die die Geschichte dieses Dachaufbaus nicht im Detail kennen, glauben, das fertige Dach vor sich zu haben. Der Vorwurf von mangelnder Integration in die Dachlandschaft ist kaum zu hören. Vielleicht können sich die gestrengen Kulturbewahrer damit trösten, dass vom Straßenraum aus nichts vom neuen Dachaufbau zu sehen ist – nur der Balkon mit dem gläsernen Geländer ragt schwindelerregend auf Firsthöhe über die erhaltene Dachhälfte mit Ziegeldeckung hinaus.db, Mo., 2012.09.10
10. September 2012 Karin Tschavgova
Auftauchen über der Stadt
(SUBTITLE) Thermalbad und Spa in Zürich (CH)
Zwei Welten verbindet die Bad- und Thermenanlage in den Kellern und auf dem Dach einer ehemaligen Brauerei in Zürich. In den Gewölbekellern, in denen einmal Bierfässer gelagert wurden, ist eine komplexe Bäderlandschaft entstanden. Das Dach fasziniert durch einen Pool unter freiem Himmel, der eine einzigartige Aussicht eröffnet.
Als Finanzmetropole genießt Zürich den Ruf der Nüchternheit. Wer in den Sommermonaten am Ufer des Sees oder der Flüsse Sihl und Limmat unterwegs ist, gewinnt einen anderen Eindruck. Kaum eine zweite Stadt kann in Relation zu ihrer Einwohnerzahl mit einer solchen Dichte an öffentlichen Bädern aufwarten.
Wenig bekannt ist, dass die Stadt auch eine Thermalquelle besitzt. Im Jahr 1976 stieß die Hürlimann-Brauerei in Zürich-Enge bei Bohrungen auf ihrem Werksgelände in 600 m Tiefe auf warmes, mineralreiches Wasser, das zwischenzeitlich für die Bierproduktion genutzt wurde. Als das traditionsreiche Unternehmen 1997 mit einem Konkurrenten fusionierte und die Produktion auf dem Areal stillgelegt wurde, endeten hier mehr als 100 Jahre Brauereigeschichte. Das Gelände wurde mit Wohn- und Gewerbebauten nachverdichtet, der denkmalgeschützte Bestand teilweise umgenutzt.
Das Sudhaus als das eigentliche Herz des Brauereikomplexes blieb dagegen zunächst ohne Nachnutzung. Der seit 1867 immer wieder erweiterte und veränderte Baukomplex liegt dominant auf einem Hügelrücken, der das Flussbett der Sihl vom Becken des Zürichsees trennt. Unter dem Sudhaus liegt ein verzweigtes System von Gewölbekellern, die als Lager für Bierfässer dienten. 2007 entschloss sich nach mehreren gescheiterten Anläufen der neue Besitzer der Liegenschaft zu einem Umbau des Komplexes als Hotel und Thermenanlage, die als zwei unabhängige Einheiten betrieben werden. Eine besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, den heterogenen und z. T. denkmalgeschützten Bestand in ein Thermalbad umzugestalten, das auf 150 000 Besucher im Jahr ausgelegt ist.
Durch den Berg zur Aussicht
Heute betritt der Besucher die Thermenanlage durch die ehemaligen Stall- und Werkstattgebäude am Fuß des Hügels in Umkehrung des Wegs, den in früherer Zeit die Bierfässer vom Ort der Produktion zur Auslieferung nahmen. Ein 30 m langer Gang führt in den Berg. Auf einer tieferen Kellerebene sind hier Umkleiden, Duschen und ein Kursbad für geschlossene Gruppen angeordnet. Die Hauptebene der Thermalbäder und Anwendungen ein Stockwerk höher erreicht der Gast von dort über eine großzügige zweiläufige Treppe. Die Arbeitsgemeinschaft aus dem Züricher Büro Althammer Hochuli Architekten und der Innenarchitektin Ushi Tamborriello hat es hier verstanden, aus einem heterogenen Bestand, einen ebenen und weiträumigen Badebereich zu formen, der von der Geschichte des Ortes lebt. Neue oder wieder geöffnete Durchbrüche schaffen auf dieser unterirdischen Hauptebene aus den vormals unübersichtlichen Gewölben eine großzügige Raumfolge. Eine einheitliche Laufebene zwischen den Kellern, die zueinander versetzte Fußbodenniveaus besaßen, konnte hier dadurch geschaffen werden, dass die Badebereiche im nördlichen Teil als große Bottiche aus Schweizer Lärchenholz auf den Fußboden aufgestellt sind, in anderen Bereichen dagegen als Becken abgesenkt wurden. Die unterirdische Welt der Therme findet ihren Kontrapunkt 30 m höher in einem Außenbad, das auf dem Dach des ehemaligen Sudhauses angelegt wurde. Beide Bereiche sind durch einen Schnelllift miteinander verbunden, zwischen ihnen liegen die vier Geschosse des Hotels, das zwar als eigene Einheit betrieben wird aber eine direkte Verbindung zur Therme besitzt. Aus den Aufzügen gelangt der Gast in einen Bistro- und Ruhebereich, der auf Liegen und Sesseln Platz für gut 70 Gäste bietet. War das unterirdische Badegeschoss durch die Atmosphäre der steinernen Gewölbe geprägt, findet sich der Besucher im Bistro in einer hölzernen Welt prismatisch verschobener Raumvolumen, die an einen Dachboden erinnern sollen. In diesem speziellsten aller Räume des Bads kann sich, wer mag, auf dem bequemen und feuchtigkeitsunempfindlichen Polstermobiliar niederlassen und einen Drink nehmen. Die Zwischenwände und -decken aus Lattungen sind wie ein Zelt in das oberste Geschoss des Sudhauses eingestellt und verbergen ihren Charakter als Einbauten nicht. Die Zwischenräume der Lattenroste sind mit einem schwarzen Glasfaservlies hinterspannt, das auch als Sichtblende im Übergang zu einigen kreisförmigen Oberlichtern dient. In den Zwischenräumen hinter der hölzernen Schale sind, für den Besucher unsichtbar, die technischen Installationen für Klimatisierung und für den Betrieb des Außenbeckens über ihren Köpfen untergebracht.
Absturz- und erdbebensicher
Auf das Dach gelangt der Gast vom Bistro aus über eine abgewinkelte Treppe. Ihre letzten Stufen führen sogleich wieder in ein Becken aus Edelstahl hinab. Sein kantiger Umriss ist in die Mitte des sehr flach geneigten Walmdachs, welches das Sudhaus bekrönt, hineingestanzt. An zwei Stellen steigt das Dach zwischen den Ausläufern des Beckens weiter bis über den Wasserspiegel hinaus an, ansonsten ist der Pool die höchste Stelle des gesamten Gebäudes und eröffnet den badenden Gäste in drei Himmelsrichtungen einen Panoramablick über Zürich. Diese Inszenierung des Badeerlebnisses scheint Wirkung zu zeigen, sodass man an einem Sonntagabend schon ein wenig suchen muss, um einen ruhigen Platz im Becken zu ergattern. Nach Südwesten schirmt der prismatisch geformte, an einen Felsen erinnernde Dachaustritt die Badegäste gegen den Einblick von einem 7-geschossigen Wohn- und Bürogebäude ab, das wenige Meter entfernt auf dem Platz der ehemaligen Gärtankanlage der Brauerei steht. Zwischen Dachaustritt und Becken finden auf einem Liegedeck einige wenige Sonnenliegen ihren geschützten Platz.
Der Ausblick aus dem Wasser auf die Stadt kann seine Wirkung ungestört entfalten, weil auf eine Absturzsicherung rund um das Becken verzichtet werden konnte. Der Rand des Beckens und weitere Details sind darauf ausgerichtet, dass der Badegast das Wasser gar nicht erst verlässt. Das Dach außerhalb des Pools ist mit spitzwinklig abgefasten Sipolatten verkleidet, die es unmöglich machen, dort mit nackten Füßen zu laufen. Sollte ein Gast oder ein unbeobachtetes Kind dennoch diese Zone betreten, wird die Person an einem Galerie-Umgang, der um den Fuß des Walmdachs herumläuft, aufgehalten. Das Planungsteam nutzte zur Unterbringung dieser Galerie die denkmalgeschützte hohe Attika des Sudhauses. Die Dachkonstruktion ist wie das gesamte übrige Sudhaus von innen gedämmt.
Zur Aufnahme der Wasserlasten ist das Dach als massive Betonkonstruktion ausgebildet. Der unregelmäßige Umriss sowie die für unterschiedliche Anwendungen (tiefere Zonen, Whirlpool oder Sprudelliegen im Wasser) variierende Tiefe des Pools erzeugen ein steifes dreidimensionales Betonfaltwerk. Die statische Last mit hohem Schwerpunkt im Gebäude musste darüber hinaus erdbebensicher gelagert werden. Aus diesem Grund genügte eine Lastabtragung über die historischen Außenmauern nicht. Der Aussteifung der Dachkonstruktion und der darunterliegenden Hoteletagen gegen horizontal angreifende Kräfte dient ein im Querschnitt fünfeckiger Betontrichter, der vom Außenbad bis zu einem Tagungsraum im 1. OG des Hotels hinabreicht und diesen von oben belichtet.
Durch die Thermalquelle im Untergrund kann der Großteil der für das Bad benötigten Energie auf dem Gelände selbst gewonnen werden. Das im Untergrund geförderte Thermalwasser hat eine Temperatur von etwa 25 °C. Ein Teil des Vorkommens wird genutzt, um das für den Badebereich geförderte Wasser über Wärmetauscher weiter aufzuheizen. Das Wasser für den Pool auf dem Dach wird nachts in ein gedämmtes Retentionsbecken auf der Ebene des Bistros abgepumpt, um Wärmeverluste zu vermeiden. Für die unterirdischen Teile der Thermenanlage konnte in einem aufwendigen Verfahren nachgewiesen werden, dass keine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist, weil sich im Dauerbetrieb im umgebenden Erdreich eine Wärmeblase ausbildet, die einen ähnlichen Effekt hat wie eine konventionelle Dämmung.
Aus dem Bestand entwickelt
Eine frühe Entscheidung des Planungsteams aus Architekten und Innenarchitektin war es, die Grundlinien der Gestaltung aus dem Bestand selbst heraus zu entwickeln. Genau diese Haltung überzeugte den Bauherrn, als er 2007 unter vier Büros ein Planerauswahlverfahren durchführte. Das erfolgreiche Büro Althammer Hochuli hatte schon 2002 ein Wohnbauprojekt auf einem anderen Teil des Brauerei-Areals realisieren können und war deshalb mit den Gegebenheiten sehr gut vertraut. Der Betreiber »Aqua Spa Resorts« brachte die Architekten in einem nächsten Schritt mit der Innenarchitektin Ushi Tamborriello als Expertin für moderne Bäder und Wellnessanlagen zusammen. Zuschnitt und Gestaltung der Bäder wurden, so Margit Althammer, »in jeder einzelnen Linie« von diesem Dreierteam in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege Raum für Raum entwickelt. Von außen ist von den Umbauten so gut wie nichts zu erkennen, lediglich der markante Dachaustritt zeichnet sich ab, wenn man die ehemalige Brauerei aus der Distanz betrachtet. Ergebnis der Planung ist vor allem eine Innenwelt von unaufgeregten, aber atmosphärisch starken Räumen, denen man die Komplexität der technischen und denkmalbezogenen Planungsaufgabe nicht anmerkt. Zu den außergewöhnlichen Qualitäten des Konzepts gehört es, diese Innenwelt mit einem schlicht, aber wirkungsvoll inszenierten Außenbad auf dem Dach zu kontrastieren.db, Mo., 2012.09.10
10. September 2012 Karl R. Kegler