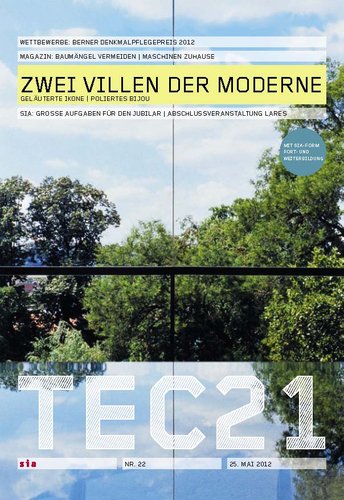Editorial
Auf den ersten Blick haben die beiden Bauten kaum Gemeinsamkeiten – ausser ihrer Entstehungszeit Anfang der 1930er-Jahre und ihrem Zweck (beides sind Einfamilienhäuser): Hier der Standort im kosmopolitischen Brünn, dort die Lage in der ländlichen Region bei Bern. Ein Bau ist ein international bekanntes architektonisches Meisterwerk, der andere ein kaum bekanntes Schmuckstück von nationaler Bedeutung.
Und doch weisen die Villa Tugendhat (1929 – 1930) von Ludwig Mies van der Rohe und die Villa Caldwell (1934 – 1935) von Otto Voepel überraschende Übereinstimmungen auf: Beides sind starke Entwürfe, die in ihrer Umgebung teils Bewunderung, teils Befremden, aber immer eine Reaktion auslösten. Sowohl die Villa Tugendhat als auch die Villa Caldwell wurden für wohlhabende, gebildete Bauherrschaften entworfen, die aufgeschlossen waren für die Ideen des Neuen Bauens. Die individuellen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, das «Für wen?» stand bei beiden Entwürfen im Vordergrund. Dies schlug sich zum einen in Raumprogramm und -anordnung, zum anderen in der sorgfältigen und freudvollen Verwendung von Bautechnik und -material nieder. Entstanden sind zwei Bauten mit unverwechselbarem Charakter.
Beide Villen wurden kürzlich instand gesetzt. Während die Villa Caldwell weiterhin bewohnt wird, ist die Villa Tugendhat seit März als Museum der Öffentlichkeit zugänglich. Die beiden Restaurierungen zeigen, was möglich ist, wenn weder Kosten noch Mühen gescheut werden (Villa Tugendhat) oder ein intensiver Austausch zwischen Architekt, Bauherrschaft und Denkmalpflege einen Mittelweg zwischen denkmalpflegerischen Prinzipien und heutigen Komfortansprüchen erlaubt (Villa Caldwell).
Wohnqualität wird heute oft mit mehr Platz, mit grösseren und höheren Räumen gleichgesetzt. Die beiden Häuser aus dem letzten Jahrhundert zeigen, dass die architektonische Interpretation von Bedürfnissen, Gewohnheiten und Wünschen ebenso ausschlaggebend ist. Mies van der Rohes Ausspruch ist heute noch genauso aktuell wie vor 80 Jahren: «Die Wohnung unserer Zeit gibt es noch nicht. Die veränderten Lebensverhältnisse aber fordern ihre Realisierung. Voraussetzung dieser Realisierung ist das klare Herausarbeiten der wirklichen Wohnbedürfnisse. Die heute bestehende Diskrepanz zwischen wirklichem Wohnbedürfnis und falschem Wohnanspruch, zwischen notwendigem Bedarf und unzulänglichem Angebot zu überwinden ist eine brennende wirtschaftliche Forderung und eine Voraussetzung für den kulturellen Aufbau ...»
Tina Cieslik
Literatur:
[01] Fritz Tugendhat in: Daniela Hammer-Tugendhat, Wolf Tegethoff, Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat, Springer-Verlag Wien, 1998, S. 36
[02] Ursel Berger, Barcelona-Pavillon – Architektur und Plastik, Jovis Verlag, Berlin, 2006, S. 112
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Berner Denkmalpflegepreis 2012
10 MAGAZIN
Baumängel vermeiden | Maschinen zuhause
18 GELÄUTERTE IKONE
Judit Solt, Alberto Caruso
Die für die Brünner Unternehmerfamilie Tugendhat von Mies van der Rohe errichtete Villa ist ein Meilenstein der modernen Architektur. Nach einer wechselvollen Geschichte erfolgte nun eine sorgfältige Restaurierung.
25 POLIERTES BIJOU
Tina Cieslik
Die Villa Caldwell im bernischen Allmendingen ist eines der wenigen weitgehend erhaltenen Einfamilienhäuser der Reform-Moderne in der Schweiz. Der kaum bekannte Bau wurde kürzlich beispielhaft instand gesetzt und dient weiterhin als Wohnhaus.
33 SIA
Fort- und Weiterbildung | Grosse Aufgaben für den Jubilar | Abschlussveranstaltung Lares | Alternative: Kostengarantievertrag | Bauforum 2012
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Geläuterte Ikone
Die von Ludwig Mies van der Rohe von Juni 1929 bis Dezember 1930 erbaute Villa Tugendhat im tschechischen Brünn gehört zu den Ikonen der architektonischen Moderne. Nachdem zunächst die Nationalsozialisten und später das kommunistische Regime den Bau in Besitz nahmen, wurde die Villa 2001 in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen. Unter der Schirmherrschaft des Tugendhat House International Committee erneuerte ein Team aus den Architekturbüros Omnia projekt (Brünn) und Archteam (Prag) von 2010 bis 2012 die Villa – die Geschichte der Instandstellung ist dabei streckenweise ebenso abenteuerlich wie jene des Baus selbst. Seit März 2012 ist die Villa als Museum wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.
Die Villa Tugendhat ist ein Gesamtkunstwerk: eine Komposition, in der Mies van der Rohe einerseits seine entwerferischen Ideen von fliessenden Räumen und freiem Grundriss umsetzen konnte, die andererseits aber den Bedürfnissen einer Familie zu genügen hatte. Das damalige Vorurteil, moderne Architektur sei kalt und streng, widerlegte Mies mit dem Einsatz von edlen Materialien, sorgfältigen Details – beispielsweise in der Anordnung der Räume und der Gebäudetechnik – und speziell für die Villa entworfenen Möbeln.
Genialer Architekt, kongeniale Bauherrschaft
Diese Konsequenz in Entwurf und Ausführung verlangte eine enge Beziehung zwischen Architekt und Bauherrschaft. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Brünn eines der lebendigsten Zentren des damaligen multikulturellen Osteuropa. Die Koexistenz von tschechischen, deutschen und jüdischen Gemeinschaften führte zu einem äusserst regen Kulturleben, was sich auch architektonisch durch eine hohe Anzahl an modernen Bauten manifestierte. Grete Tugendhat, 1903 in Brünn als Tochter der grossbürgerlichen jüdischen Industriellenfamilie Löw-Beer geboren, heiratete 1928 in zweiter Ehe den Brünner Textilindustriellen Fritz Tugendhat. Zur Hochzeit schenkten Gretes Eltern dem Paar einen Teil ihres eigenen Gartens als Baugrundstück und finanzierten auch den Bau der Villa. Während ihrer ersten Ehe hatte Grete Tugendhat in Berlin gelebt, wo sie oft Mies’ zweiten realisierten Bau, das vom Kulturwissenschaftler Eduard Fuchs bewohnte Haus Perls (1911), besucht hatte; auch die 1927 erbaute Weissenhofsiedlung faszinierte sie. Gemeinsam mit ihrem Mann kontaktierte sie daher Mies van der Rohe für den Bau ihres Hauses. Die Lage des Grundstücks am oberen Ende des Parks gegenüber der Brünner Festung Spielberg begeisterte Mies. Mit der für die Gartengestaltung verantwortlichen Brünner Landschaftsarchitektin Grete Roder-Müller schuf er ein Haus, dessen Struktur wesentlich vom Dialog zwischen Innen und Aussen, zwischen Natur und Architektur bestimmt war.
Der Eingang erfolgte von der Strassenseite, von wo aus sich der Bau als eingeschossiger Bungalow präsentierte (Abb. 2). Hier waren die Privaträume untergebracht, eine Treppe führte von der Eingangshalle in das Wohngeschoss, das aus den auf der Nordseite angeordneten Wirtschaftsräumen und einem grosszügigen offenen Wohnbereich bestand. Weite Terrassen in Ober- und Erdgeschoss und eine Treppe zum Garten verknüpften den Bau mit der Landschaft. Die dreigeschossige Villa war als Stahlskelett konstruiert, wodurch Mies die Trennung von Konstruktion und Wand ermöglichte.[1] Die Komposition von fliessenden Räumen, die Gegenüberstellung von tragenden Stahlstützen und trennenden Wänden aus kostbaren Materialien wie Onyxmarmor und Makassar-Ebenholz oder die beiden rund 15 m² grossen versenkbaren Fenster zum Park waren für die damalige Zeit geradezu revolutionär – im Gegensatz zum Raumprogramm, das mit der strengen Trennung von Tag- und Nachtbereich oder mit den Personalzimmern gutbürgerliche Wohnvorstellungen widerspiegelt. Gemäss Grete Tugendhat legte Mies Wert auf edle Materialien: «Dann legte er uns dar, wie wichtig gerade im modernen, sozusagen schmucklosen […] Bauen die Verwendung von edlem Material sei und wie das bisher vernachlässigt worden sei, z.B. von Le Corbusier. Als Sohn eines Steinmetzes war Mies vertraut mit schönem Stein […]. Er liess im Atlasgebirge lange nach einem schönen Onyxblock für die Wand suchen und überwachte selbst das Zersägen und Aneinanderfügen der Platten […]. Als sich nachher zeigte, dass der Stein durchscheinend war und gewisse Stellen der Zeichnung auf der Rückseite rot leuchteten, wenn die untergehende Sonne auf die Vorderseite schien, war das auch für ihn eine freudige Überraschung.»[2]
Villa, Büro, Stall und Spital
Bewohnt wurde die Villa allerdings nicht lange. Nach der Annektion des Sudetenlandes durch das Deutsche Reich flüchtete die Familie Tugendhat 1938 vor den Nazis zunächst in die Schweiz, 1941 nach Venezuela.1950 kehrte die Familie in die Schweiz zurück und liess sich in St. Gallen nieder.[3]
Die Villa Tugendhat wurde 1939 für den Bedarf der Gestapo formell beschlagnahmt und 1942 als Besitz des Grossdeutschen Reiches eingetragen. Zeitweise bewohnte sie der Flugzeugkonstrukteur Walter Messerschmidt, der die Villa als Konstruktionsbüro nutzte und mit massiven Einbauwänden unterteilte. Nach Einmarsch der Roten Armee diente der Bau deren Kavalleristen als Pferdestall. Von 1950 bis 1979 nutzten ihn die tschechoslowakischen Behörden für die orthopädische Abteilung des benachbarten Kinderspitals, das Wohnzimmer mutierte zur Turnhalle (Abb. 3). 1980 ging die Villa in den Besitz der Stadt Brünn über. In den 1980er-Jahren wurde der Bau für Repräsentationszwecke und als Gästehaus für hochrangige Besucher eingesetzt. Bei der damaligen «denkmalpflegerischen Wiederherstellung» (1981–1985) zerstörte man trotz hehren Absichten weitere Originalteile – unter anderem wurde das letzte noch erhaltene Fenster der Gartenfront ersetzt, das im Zweiten Weltkrieg die Explosion einer Bombe nur deswegen überstanden hatte, weil es gerade versenkt war. Fast alle Holzeinbauten wurden «erneuert», anderes mehr schlecht als recht rekonstruiert, etwa die verloren geglaubte Makassar-Wand: Weil das Regime nicht über den Willen oder die Mittel verfügte, das richtige Furnier zu beschaffen, erhielt die Wand ein dominantes Vertikalmuster und einen horizontalen Saum, die ihre Wirkung ruinierten.
Fragwürdige Auftragsvergabe
Brünns beeindruckendes Erbe an modernen Bauten aus der Zwischenkriegszeit fällt nach Vernachlässigung durch die sozialistischen Machthaber heute der Erneuerungswut von Investoren und der Gleichgültigkeit der Stadtverwaltung zum Opfer. Zumindest der Villa Tugendhat blieb dieses Schicksal erspart. Das Gebäude wurde 1995 zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt und gehört seit 2001 zum Unesco-Welterbe. Entsprechend aufwendig war die Restaurierung, die die Villa und den dazugehörenden Garten umfasste. Insgesamt kann das Unterfangen als gelungen bezeichnet werden. Dennoch erstaunt, dass der Auftrag für die Rettung des funktionalistischen Kunstwerks nicht an ein Architekturbüro ging, das sich auf die frühe moderne Architektur spezialisiert hat. Ein auch international bekannter profunder Kenner des Gebäudes, der Brünner Architekt Jan Sapák, der sich seit Jahrzehnten für deren Rettung eingesetzt hat, aber als politischer Querulant gilt, wurde aufgrund eines Formfehlers aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen. Der Hauptauftrag ging an eine Firma, die sich neben guten Beziehungen zu den Behörden bisher vor allem mit der Instandsetzung von barocken Schlössern hervorgetan hat. Auf eine Sichtung der originalen Detailpläne, die im Mies-Archiv im Museum of Modern Art in New York lagern, haben die Architekten denn auch verzichtet. Andere kompetente Fachleute wurden zwar beigezogen, doch nur für eng umrissene Bereiche wie die Möblierung oder die Gestaltung der neuen Ausstellung im Keller. Es gibt Anzeichen dafür, dass das gute Ergebnis nicht zuletzt ihrem informell eingebrachten Wissen zu verdanken ist sowie der Aufsicht eines mit namhaften Experten besetzten – allerdings erst nach Beginn der Arbeiten eingesetzten – Aufsichtskomitees (vgl. Kasten S. 18), worin auch Mitglieder der Familie Tugendhat vertreten sind.
Sorgfalt und Detektivarbeit
Trotz allen Zerstörungen, Umnutzungen und Transformationen ist sehr viel Originalsubstanz erhalten geblieben. Die Lüftung im Keller ist weiterhin funktionstüchtig; rund 80% der Wandoberflächen sind im Original vorhanden und können in «archäologischen Fenstern» – zum Beispiel im Verputz der Fassade – begutachtet werden.
Neue Elemente, die Verlorenes ersetzen, wurden mit den ursprünglichen Materialien nachgebaut: Der neu verlegte Linoleum wurde eigens nach der historischen Rezeptur hergestellt, die Schreinerarbeiten sind perfekt. Eine Sensation stellt die gewölbte Makassar-Wand im Essbreich dar. Während zweier Generationen galt sie als verloren, bis der Kunsthistoriker Dr. Miroslav Ambroz, der Bruder des für den Nachbau der Möbel zuständigen Restaurators, sie auf eigene Faust aufspürte: Das Tagebuch eines deutschen Soldaten, das er in einem Antiquariat erstanden hatte, erwähnte eine Holzwand, die die Gestapo aus einer Villa in ihr neues Hauptquartier – heute eine Universitätsmensa – transferiert hatte. Tatsächlich fand er das wertvolle Edelholz, das dort seit zwei Generationen und von tausenden von Studierenden unbeachtet als Brusttäfer diente. Die Teile wurden kaum sichtbar zusammengefügt und wo nötig ergänzt. Dank den sorgfältig ausgewählten Materialien und der äusserst hohen handwerklichen Qualität der Ausführung sind Alt und Neu nur für den geübten Blick zu unterscheiden. Nur wenige Misstöne sind zu vernehmen – im Schlafzimmer etwa feine Risse im Stucco, der aus Rücksicht auf die Proportionen der Fussleiste zu dünn aufgetragen werden musste, plumpe Vorhänge und Teppiche oder ein eckiges Element statt eines runden im Abflussrohr an der Strassenfassade. Ein weiterer Wermutstropfen ist die fehlende Plastik, die auf historischen Bildern jeweils auf der Wintergartenseite der Onyxwand platziert ist. Mies van der Rohe hatte hier bereits in frühen Zeichnungen eine Plastik vorgesehen, die Familie Tugendhat erwarb dafür den «Torso der Schreitenden» von Wilhelm Lehmbruck (1914). Nachdem sie während des Zweiten Weltkriegs zunächst von den Nationalsozialisten konfisziert wurde, war sie bis 2006 im Besitz der Galerie Moravska in Brünn, bis die Familie sie im selben Jahr zurückerhielt. 2007 wurde die Plastik verkauft – und ihr Fehlen schmerzt, die Wirkung des Raumes ist beeinträchtigt. In der Gesamtwirkung ist die Villa jedoch wieder als das erlebbar, was sie einmal war – ein bis ins letzte Detail perfekt durchdachter, in seiner Wirkung umwerfender Bau.
[Die Autorin dankt Tina Cieslik und Rahel Hartmann Schweizer für ihre wertvollen Hinweise.]
Anmerkungen:
[01]Etwa zeitgleich zur Villa entwarf Mies den Barcelona-Pavillon für die Weltaustellung 1929. Darin verwirklichte er die entwerferischen Prinzipien vom «fliessenden Raum» und vom «freien Grundriss». In der Villa Tugendhat übertrug Mies diese Motive auf ein Wohnhaus, das den Anforderungen und Bedürfnissen des grossbürgerlichen Alltags gerecht werden musste
[02] Grete Tugendhat in einem Vortrag, gehalten auf der internationalen Konferenz zur Rekonstruktion des Hauses (17. März 1969, Mährisches Museum, Brünn) in: Daniela Hammer-Tugendhat, Wolf Tegethoff (Hrsg.), «Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat», Springer-Verlag Wien, 1998, S. 5 ff.
[03] ebd., S. 27. 1957 liess sich die Familie vom St. Galler Büro Danzeisen & Voser in St. Gallen ein Haus bauen, das an die Ideen der Villa Tugendhat anschloss
[04] ebd., S. 7
Eine Kurzfassung dieses Artikels erschien anlässlich der Eröffnung in TEC21 11/2012 sowie auf . Dort finden Sie auch zusätzliches Bildmaterial. Ausführliche Informationen zu den Eingriffen, eine Bilddokumentation der Baustelle und für die Reservation von Besuchsterminen gibt es auf «www.tugendhat.eu».
Weiterführende Literatur:
Daniela Hammer-Tugendhat, Wolf Tegethoff (Hrsg.), Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat, Springer-Verlag Wien, 1998
Adolph Stiller (Hrsg.), Das Haus Tugendhat. Ludwig Mies van der Rohe. Brünn 1930, Verlag Anton Pustet, Salzburg, 1999
Villa Tugendhat. Rehabilitace a slavnostní znovuotevrˇení / Rehabilitation and Ceremonial Reopening, Study and Documentation Centre – Villa Tugendhat and Brno City Museum, Brno 2012
Terence Riley, Barry Bergdoll (Hrsg.), Mies in Berlin. Mies van der Rohe. Die Berliner Jahre 1907–1938, Prestel Verlag, München, 2002TEC21, Fr., 2012.05.25
25. Mai 2012 Judit Solt, Alberto Caruso
Poliertes Bijou
Architektur der Moderne ist nicht das Erste, was einem einfällt, denkt man an die ländliche Region zwischen Thun und Bern. Und doch findet sich hier, gut versteckt hinter jahrzehntealten Eichen, an der Hangkante zur Autobahn A6 ein architektonisches Kleinod aus den 1930er-Jahren: die Villa Caldwell, ein Einfamilienhaus für eine schweizerisch-britische Familie. Der von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege in seiner Bedeutung zwischen regional und national eingestufte Bau befand sich 2004, als es zu einem Besitzerwechsel kam, noch weitgehend im Originalzustand. Von 2010 bis September 2011 wurde er vom Zürcher Architekturbüro Hauswirth instand gesetzt – ein nachahmenswertes Beispiel für den Umgang mit Bauten der Moderne.
Zwischen den herrschaftlichen Landsitzen der Bernburger wirkt der Bau, südöstlich von Bern in der Gemeinde Allmendingen gelegen, auch heute noch wie ein Fremdkörper. Der Gegensatz zu seiner landwirtschaftlich geprägten Nachbarschaft dürfte zur Entstehungszeit 1934/35 noch grösser gewesen sein. So verwundert es nicht, dass sich um Bau und Bewohner allerlei Gerüchte rankten: Von einer zum Schutz des Flugplatzes Bern-Belp auf dem Glockenturm installierten Flugabwehrkanone während des Zweiten Weltkriegs war die Rede; als später die belgische Gesandtschaft die Villa als Residenz nutzte, hiess es, der Bau diene untergetauchten Nazis als Versteck vor den Alliierten.
Konventionelles Raumprogramm mit seltsamen Ausnahmen
Bauherrin der Villa war Agnes Edith Welti, die jüngste Tochter einer britischen Mutter und eines Berner Vaters. Während des Physik- und Mathematikstudiums an der Universität Göttingen hatte sie ihren späteren Ehemann John Caldwell kennengelernt, der dort Chemie studierte. Anfang der 1930er-Jahre beauftragte das Ehepaar den befreundeten deutschen Architekten Otto Voepel1 aus Weimar mit einem Entwurf für eine Villa auf dem Bergliacker in Allmendingen. Das Grundstück befand sich an privilegierter Lage über dem Aaretal, mit Blick auf Belpberg und das Dreigestirn Eiger-Mönch-Jungfrau. Zwar existierte der Flugplatz Bern-Belp bereits seit 1929, die heute an das Grundstück grenzende Autobahn A6 zwischen Bern und Thun wurde aber erst rund 40 Jahre später gebaut.
Voepel entwarf einen Bau, der sich in seiner Gestaltung sowohl beim Formenkanon der Reform-Moderne bediente als auch traditionelle Elemente enthielt. Eine rückwärtige Vorfahrt führte zum Eingang des Hauses. Über die zentral gelegene Eingangshalle gelangte man in die drei repräsentativen Räume Bibliothek, Wohn- und Esszimmer, die alle südwärts zur Aussicht hin angeordnet sind. Anstelle der üblichen Gartenanlage, die wegen der Hanglage nicht möglich war, ordnete Voepel jedem Raum einen individuellen Aussenbereich in Form einer Terrasse zu. Das Flachdach und die gemauerten Brüstungen liessen den Bau als scharfgeschnittenes geometrisches Volumen wirken, das von weitem die Landschaft prägte – insbesondere da die Villa damals noch nicht von der heute ebenfalls geschützten Vegetation verdeckt wurde. Im hinteren nördlichen Bereich waren Wirtschaftsräume, Küche und Garderobe untergebracht. Die Wegführung in die Repräsentationsräume ist unüblich: Statt vom Entree direkt in das mittig gelegene Wohnzimmer, gelangt man zunächst linker Hand in die Bibliothek, dort öffnet sich eine Art versetzte Enfilade zu den beiden anderen Räumen (Abb. 10+13). Ob diese verschlungene Wegführung von Otto Voepel stammt, ist ungewiss – auf den Originalplänen ist schwach eine Tür zwischen Eingangsbereich und Wohnzimmer zu erkennen.2 Voepel war für den Entwurf der Villa verantwortlich, die Bauleitung vor Ort besorgte der Berner Architekt Paul Riesen, Baumeister war Hans Wüthrich aus Muri. Auch im Untergeschoss gab es eine seltsame räumliche Anordnung: Über eine nach rechts aus der Mitte versetzte Treppe gelangte man zunächst auf ein Podest, von dem aus zwei weitere Treppen rechts und links zu Salon, Gartenzimmer und Billardraum sowie zu zwei seitlich angeordneten Nebenräumen für das Personal führten (Abb. 1). Statt die grosse Geste des Eintretens über das halbhohe Podest zu zelebrieren, trennte Voepel die Räume mit Wänden zu drei kleinen Einheiten. Eine Besonderheit bildet das auf der Ostseite gelegene Billardzimmer: Um die Mindestabstandsflächen von 1.50 m um den neun Fuss grossen Poolbillardtisch zu gewährleisten, ist die nördliche Wand entsprechend versetzt. Im Obergeschoss hingegen sind die Zimmer symmetrisch um den Treppenaufgang gruppiert.
Eckfenster und Klinkerplatten
Mit seinen gestaffelten Terrassen erinnert das Haus an Bauten von Adolf Loos, namentlich an die Villa Müller in Prag von 1930 (Abb. 7). Auch die unterschiedliche Behandlung der Fenster in Dimension und Konstruktion – Schiebefenster in Baubronze, Schiebefenster in gestrichenem Stahl, doppelt verglaste Drehfenster in Holz mit modern geformten Beschlägen und doppelt verglaste Holzfenster mit traditionellen Rudern – lässt diesen Bezug vermuten, ebenso wie der auf einem Quadrat basierende Grundriss. Gleichzeitig finden sich aber vor allem in den Details auch traditionelle Anleihen an den Heimatstil, wie die Kunststeinfassung der Eingangstüre oder die durch eine Ritzung im Verputz betonten Fenstereinfassungen.[3] Eine Referenz an die Bauten der Moderne waren hingegen die grosszügigen, stützenlos ausgeführten Eckfenster in Bibliothek und Esszimmer (Abb. 2+16). Das Glas zwischen den schlanken Fenstereinfassungen ist kaum wahrnehmbar und wirkt wie eine Membran zwischen Brüstung und auskragendem Baukörper, zwischen Innen- und Aussenraum. Da es sich bei der Decke um eine Hourdisdecke handelt, wurden Betonunterzüge in das Fassadenmauerwerk eingearbeitet, um dieses Detail stützenlos ausführen zu können.
In der Oberflächengestaltung setzte sich diese Ambivalenz im Ausdruck fort: Die Bibliothek war mit Kassettendecke, Klinkerboden und gemauertem Cheminée konservativ ausgestattet (Abb. 13), in Wohn- und Esszimmer fand sich dagegen Parkett und grüner Linoleum. In Ober- und Untergeschoss wurde diese Schlichtheit weitergeführt, mit Linoleum am Boden und in Grün-, Blau- und Beigetönen gestrichenen Wänden. Dazu gab es weitere Details, die an Loos erinnern, wie die eingebaute Eckbeleuchtung am Podest im Untergeschoss (Abb. 15). Sowohl Simplizität als auch Traditionalismus wurden im Treppenhaus gebrochen: Die Wände waren hier ursprünglich in einem kräftigen Türkis gestrichen. Mit seinen Anleihen an traditionelle Typologien in Grundriss und Oberflächengestaltung in Kombination mit Elementen der Moderne lässt sich der Bau der deutschen Reform-Moderne der Zwischenkriegszeit zuordnen. Zusammen mit seinem aussergewöhnlich guten Erhaltungszustand verleiht ihm dies eine singuläre Stellung in der Schweizer Architektur.[4]
Vergessenes Schmuckstück
Die Familie Caldwell-Welti lebte nicht lange in der Villa, bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verliess sie die Schweiz Richtung England.[5] In den 1950er-Jahren nutzte die belgische Botschaft das Haus als Residenz, 1981 erwarb es der Berner Schriftsteller und Sagenforscher Sergius Golowin, der es bis 2003 bewohnte. Der neue Besitzer, der den Bau 2004 erwarb (ursprünglich, um auf dem Grundstück eine Einstellhalle für seine Oldtimer-Sammlung zu erstellen), bewohnt die Villa nun seit Fertigstellung der Umbauarbeiten im Herbst 2011. Mit der durch den Besitzerwechsel ausgelösten Instandsetzung nach 70 Jahren wurde der Zürcher Architekt Stefan Hauswirth betreut. In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege entwickelte er ein Konzept für den Umgang mit dem geschützten Bau.
Die augenfälligste nachträgliche Veränderung an der Originalbausubstanz war die Verdoppelung der Kaminwandscheibe an der Nordostecke des Baus zu einem Glockenturm (in der Gegend «Fressglöggli» genannt[6] und verantwortlich für die Mutmassungen über eine Flak auf dem Dach), die allerdings noch unter den ursprünglichen Besitzern ausgeführt wurde. 2006 wies der Bau noch in weiten Teilen den Originalverputz auf. Die detailreichen Beschläge an den Fenstern waren ebenso wie die Mechanismen für den Sonnenschutz grösstenteils intakt, teilweise aber nicht mehr funktionsfähig. Da die filigranen Fenster integraler Bestandteil des Gebäudes sind, kam eine Ertüchtigung auf heutige Wärmedämmwerte oder auch ein besserer Schallschutz nur sehr bedingt infrage.
Reparaturen, Nachbildungen und neue Einbauten
Die Erneuerungsmassnahmen bestanden grösstenteils aus Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten. Ein bedeutender Eingriff war der neue Verputz der Aussenfassade. Obwohl der Putz generell in gutem Zustand war, wies er an wenigen Stellen grosse Risse aus, die lokal ausgebessert werden sollten. Die Ausführung war aber so homogen, dass sich beim Ausbessern statt der zu reparierenden Stelle jeweils die gesamte Oberfläche vom Mauerwerk löste. Um die wertvollen originalen Spenglerarbeiten wie Brüstungsabdeckungen und Sonnenschutzmechanismen nicht zu gefährden, entschied man, den gesamten Bau mit einem als Kratzputz ausgeführten Kalkhydrat-Zementputz zu versehen, der in Zusammensetzung und Ausführung dem Original entsprach. Wie dieses enthält die neue Oberfläche einen Glimmeranteil von 25%, die Nachzeichnungen der Fenster wurden ebenfalls wieder aufgenommen. Eine weitere Massnahme im Aussenbereich betraf die Abdichtung der Terrassen, die wohl wegen der teilweise falschen Ausrichtung des Gefälles nie vollständig dicht waren. Um dies in Zukunft zu gewährleisten, erhielten die Terrassen eine Oberfläche aus Flüssigkunststoff, dem Leuchtchips aus wasserlöslichen Polymeren beigemischt sind, um die ursprünglich enthaltene Glimmermischung nachzubilden. Die Sonnenstoren waren integral erhalten und wurden wieder funktionstüchtig gemacht, teilweise fertigten die Handwerker auch Nachbildungen an. Bei den Fenstern gingen die Architekten differenziert vor: Die originalen Holzfenster mit Zweifachverglasung an der Nord- und teilweise an der Ost- und Westfassade wurden ausgebessert und mit einer Doppelisolierverglasung von 14mm energetisch ertüchtigt. Schwieriger war dies bei den Metallfenstern mit ihren sehr schlanken Profilen. Im Obergeschoss griff man auf in Japan hergestelltes Vakuumglas (High Performance Insulation Floatglas, Schallschutz 30 Rw/dB) zurück. Dieses ermöglicht einen U-Wert von 1.4W/m2K bei einer Dicke von 6.5mm (Abb. 21) und eignet sich damit für Instandsetzungen denkmalgeschützter Gebäude aus den 1930er-Jahren. Bei den Fenstern im Erdgeschoss konnte dieses Glas wegen der grossen Formate von maximal 280×170cm nicht verwendet werden. Um den U-Wert zu optimieren, entschieden sich die Architekten hier für 8.5mm dickes VSG-Glas mit einer eingelegten transparenten Wärmefolie, das einen U-Wert von 3.2W/m2K erreicht.
Im Inneren erfolgte zunächst eine Bestandsaufnahme der Originalfarbigkeit, die bei den Erneuerungsarbeiten als Referenz diente, aber wesentlich dezenter ausgeführt wurde. Grössere bauliche Eingriffe betrafen vor allem Küche und Nasszellen. Die Küche war ursprünglich durch eine Wand mit Einbauschränken vom Esszimmer getrennt, lediglich ein in die Schrankwand integrierter schmaler Durchgang schuf eine Verbindung. Einer der Schränke wurde entfernt, die Nische dient nun als Durchreiche oder Bar, der Raum und vor allem die Eckverglasung an der Südseite sind nun in ihrer ganzen Tiefe erfahrbar (Abb. 16–18).
Bei den Nasszellen wünschte der Bauherr eine komplette Veränderung: Während die Anordnung identisch blieb, ist die Oberflächenbehandlung eine zeitgenössische. Die Architekten fotografierten jeweils einen Ast der gleichzeitig mit dem Bau gepflanzten Eichen, abstrahierten und verpixelten die Form und brachten dieses Motiv in die beiden neuen Bäder im Obergeschoss ein (Abb. 19+20). Wie die originalen Fliesen sind auch die neuen Plättli der Nasszellen fugenlos verarbeitet. Diese drastische Intervention versinnbildlicht die gute Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege: Die Villa kann nur erhalten werden, wenn sie bewohnt ist. Daher galt es, zwischen den denkmalpflegerischen Ansprüchen und den individuellen Wünschen des Bauherrn abzuwägen und, wo nötig, Kompromisse einzugehen. Die Eingriffe in den Bädern sind dazu reversibel, also aus denkmalpflegerischer Sicht vertretbar.
Im Untergeschoss korrigierten die Architekten die räumliche Disposition. Sie entfernten die Wände zwischen Salon, Billard- und Gartenzimmer, und es entstand ein grosszügiger, lichtdurchfluteter Raum, der über eine weitere Terrasse Zugang in den Garten gewährt. Auch bei diesem Eingriff stellten die Beteiligten den Wohnkomfort über die originalgetreue Rekonstruktion. Als Erinnerung an die Wände erhielten die Originalstützen aus Kalksandstein eine Aufdopplung, die die Wandstärke der verschwundenen Raumteiler andeutet (Abb. 15).
Schönheit gegen Lärm
Das Problem der Dauerbeschallung durch die Autobahn konnte die Instandsetzung nicht beheben. Die Metallprofile der Fenster waren zu schlank für Schallschutzscheiben. Es ist den heutigen und künftigen Bewohnern daher zu wünschen, dass baldmöglichst Lärmschutzmassnahmen an der Autobahn durchgeführt werden. Ein Eingriff am Haus selber, wie es noch das Projekt von Peter Schenker und Kurt Gossenreiter 1997 vorsah (Abb. 24), steht heute aus denkmalpflegerischen Gründen ausser Frage.
Dass dieses für die Schweiz so aussergewöhnliche Haus gemäss denkmalpflegerischen Vorgaben erneuert und gleichzeitig weiterhin bewohnbar gemacht wurde, ist ein Glücksfall. Es wäre schön, wenn die dabei gemachten Erfahrungen hinsichtlich Materialverarbeitung und -technologie weiteren Bauten der Epoche zugutekommen könnten.
Anmerkungen:
[01] Otto Voepel war der Leiter der Staatlichen Bauschule Gotha und der Vater der Bauhausschülerin Charlotte Voepel-Neujahr. Es ist davon auszugehen, dass er mit den Ideen des Neuen Bauens vertraut war, er selber war aber kein Vertreter
[02] Robert Walker, «Die Villa Caldwell (Haus Golowin) in Allmendingen» (20.01.2003), in: Dokumentation Villa Caldwell, 20.12.2010
[03] Die florale Malerei auf der Kunststeinfassung der Eingangstür wurde vermutlich später angebracht. Sie enthält die Initialen SD, was auf Suzanne Draeger aus Genf hinweist, die die Villa 1951 erwarb
[04] Ein Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege vom 9. September 2003 stuft die Villa Caldwell wegen ihrer Verbindung von traditionellen und modernen Elementen bei hoher gestalterischer und handwerklicher Qualität in ihrer Bedeutung zwischen regional und national ein. Als verwandtes Schweizer Beispiel gilt die Villa Sciaredo in Barbengo von Georgette Klein (1932).
[05] www.tqsi.info/genealogy, Zugriff: 6.5.12
[06] «Schweizer Architekturführer 1920–1990», Band 2 (Nordwestschweiz, Jura, Mittelland), Werk Verlag, Zürich, 1994, S. 152TEC21, Fr., 2012.05.25
25. Mai 2012 Tina Cieslik