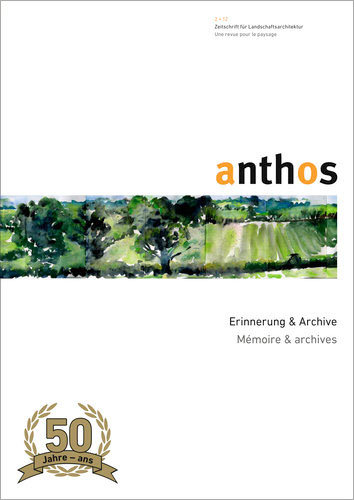Editorial
Polaroid-Fotos, Notizen, Tätowierungen. Fragmente, Bruchstücke, Impressionen. Wegweiser, die Leonhard Shelby in Christopher Nolans Film «Memento» nutzt, um die Puzzleteile seines Lebens wieder zusammenzufügen. Ohne Erinnerungen sind wir losgelöst von Raum und Zeit, Erinnerungen sind unsere Scharniere zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Gebunden an Gegenstände können sie aufbewahrt und immer wieder neu interpretiert werden; die materiellen Zeugen lagern in Museen, Bibliotheken und Archiven.
Erinnerungen binden sich jedoch nicht nur an Gegenstände, sondern auch an Orte. Die Strassenkreuzung des ersten Kusses, die Rütli-Wiese am Vierwaldstättersee, die die Schweizer Geschichte wie keine andere prägte oder der Garten der Grossmutter in Graubünden sind Einschreibungen in die Landschaft, die einen Bezug zur Vergangenheit leisten. Während individuelle Erinnerungsorte nur einen kleinen Wirkungskreis haben, tragen Orte der kollektiven Erinnerung, häufig inszeniert mit Denkmälern und Schautafeln, Zeremonien und Feiertagen zur Konstruktion und Festigung der offiziellen Geschichte einer Gemeinschaft bei.
Orte, deren einstige Bedeutung und Funktion verloren ging, vermögen ein Gedächtnis auch über Phasen kollektiven Vergessens hinweg zu bewahren. Sie können später – bei erwachtem Bedarf – reaktiviert werden. Für die gestalterische Aufgabe müssen sie jedoch von Landschaftsarchitekten und -planern entziffert, gelesen und interpretiert werden können. André Corboz hat das Bild der Landschaft als Palimpsest geprägt, in das sich Geschichte Schicht um Schicht einschreibt; Vergangenes in die Gegenwart durchdrückt oder die Gegenwart Vergangenes überlagert und auslöscht. In der Praxis geht es hierbei nicht nur darum, Spuren sichtbar zu machen, sondern auch einen Kontext (wieder)herzustellen.
Aber auch Landschaft und Landschaftsarchitektur selbst sind Gegenstand von institutionalisierten Gedächtnisorganisationen. Beim genaueren Hinschauen auf die Schweizer Archivlandschaft zeigt sich eine erstaunliche Fülle an Institutionen und Sammlungen mit für die Landschaftsarchitektur und -planung relevanten Beständen. Viele von ihnen sind noch wenig bekannt und es gibt keine übersichtliche Zusammenschau. Mit dieser Ausgabe machen wir einen Anfang: Auf den Seiten 46 bis 63 haben wir die «Gelben Seiten» mit Archiven und Sammelinstitutionen zur Schweizer Landschaftsarchitektur und -planung in kurzen Steckbriefen zusammengetragen. Schliesslich war der ursprüngliche Auslöser der Ausgabe das 30-jährige Jubiläum des Schweizer Archivs für Landschaftsarchitektur (ASLA) an der Hochschule in Rapperswil. anthos gratuliert!
Wir danken allen an der Ausgabe Beteiligten herzlich für die Zusammenarbeit.
Sabine Wolf
Inhalt
Annemarie Bucher
- Die Landschaft als Archiv
Susanne Karn, Beatrice Nater und Bernd Schubert:
- 30 Jahre Archiv für Schweizer Landschaftsarchitektur
Cornel Doswald
- Ein lebendiges Archiv der Verkehrsgeschichte
Sabine Wolf, Nicole Graf
- Wie archiviert man Landschaft?
Olivier Lasserre
- Plätze, Orte der Erinnerung
Marcus Cordes
- Anwesendes Erinnern
Sophie Gräfin von Maltzan
- Erinnerungslandschaften?
Gudrun Hoppe
- Regionale Spezialitäten fördern!
Johannes Stoffler
- Einen Garten erinnern
Sebastian Sowa
- Zur Ästhetik von Ruinen: eine Prognose für die Zukunft
Lorenz Dexler, Thilo Folkerts
- Erinnerung übertragen – Weltkulturerbe Kloster Lorsch
- Schweizer Archive zur Landschaft
- Wettbewerb: 50 Jahre anthos!
- Schlaglichter
- Zum Gedenken an Reinhard Möhrle
- VSSG-Mitteilungen
- Wettbewerbe und Preise
- Mitteilungen BSLA
- Forschung und Lehre
- Markt
- Agenda
- Literatur
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Die Autoren
- Impressum und Vorschau
Die Landschaft als Archiv
Was ein Archiv ausmacht, kann auch für die physische Landschaft geltend gemacht werden. Denn Geschichte erschliesst sich nicht nur aus klassischen Archivalien und Dokumenten, sondern ist auch in der Form und Materialität von Landschaften, Städten und Dingen zu lesen.
Ein Archiv ist per Definition ein Behälter für Archivalien: Hier werden sie erfasst und so abgelegt, dass sie wieder auffindbar sind. Der Ursprung des Archivs liegt etymologisch im griechischen «archeion», was so viel wie Amtsgebäude bedeutet. Seit dem 17. Jahrhundert meint Archiv in der Kanzleisprache Aufbewahrungsort für Akten, Schriften und Urkunden, welche einerseits dem Recht als Belege und Beweise für Handlungen, Bewertungen und Entscheidungen dienen. Andererseits sind Archivgüter auch «Überreste» der Geschichte und damit «Quellen» der Geschichtsschreibung. Sie bilden ein materielles kollektives Gedächtnis – ein Bewusstsein für die Vergangenheit. Um es zu aktivieren, sind aber nicht nur Archivalien im engeren Sinn, sondern auch symbolische und geografische Orte ausschlaggebend. Pierre Nora[1] hat dargelegt, dass das kollektive Gedächtnis erst an konkreten Orten lesbar wird. Solche «lieux de mémoire» haben eine symbolische Aufladung und damit identitätsstiftende Funktion.
Dass Landschaft ein grosses und noch nicht ausreichend erforschtes Erinnerungspotenzial besitzt, zeigen auch ihre medialen Repräsentationen. Bilder halten unwiederbringlich fest, wie sich die Landschaft in räumlicher Gestalt zu ihren gesellschaftlich verankerten Vorstellungen verhält. So war die europäische Landschaftsmalerei seit der Renaissance auf das Portraitieren des Landschaftsraumes fokussiert. Auch wenn die dargestellte Landschaft symbolischer Natur war, wird sie als visuelle Übertragung des Augenscheins angenommen. Im Gegensatz dazu bezog sich chinesische Landschaftsmalerei seit der Tang-Dynastie primär auf imaginäre Landschaften. Bilder resultierten nicht aus der Anschauung, sondern aus dem Ziel, mit der Darstellung von Landschaft ihre geistigen und emotionalen Aspekte zu vermitteln. Sowohl westliche als auch die ostasiatischen Landschaftsdarstellungen sind deshalb subjektive Notationen einer kulturell konstruierten, idealen Natur.
Kulturelle Konstruiertheit
Dass wir Landschaft als Produkt der vorherrschenden Glaubenssysteme und Ideologien betrachten und gestalten, hat Simon Schama aufgezeigt: «Before it can ever be the repose for the senses, landscape is the work of the mind. Its scenery is built up as much from strata of memory as from layers of rock.»[2] Beispielhaft hierfür sind die in die Felsen gemeisselten Porträts amerikanischer Präsidenten am Mount Rushmore, welche die Geschichte der amerikanischen Nation für die Ewigkeit in die physische Landschaft wie in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben haben. In der Schweiz ist die Rütliwiese eine der nationalen Landschaften.
Kulturell hybride Erinnerungslandschaften haben sich in Südamerika entwickelt. Im 17. und 18. Jahrhundert gründeten Jesuiten auf dem Gebiet von Paraguay, Bolivien und Südbrasilien sogenannte Reduktionen (von spanisch reducir = zusammenführen), in denen die nomadischen Indianer in festen Siedlungen zusammengeführt wurden. Das Ziel war, die Indigenen zu christianisieren, vor der Ausbeutung zu schützen und zu «zivilisierten Wesen» zu entwickeln. Die Folge war eine grundlegende Umgestaltung des als «Naturlandschaft» bewerteten Gebietes[3] in eine mit befestigten Siedlungen durchsetzte, nach europäischen Konzepten strukturierte Kulturlandschaft.
Verdrängte Landschaften
Obwohl meist positiv besetzt, enthalten Archive aber auch Akten über Dinge, die lieber verdrängt werden. Ähnlich verhält es sich mit der Landschaft, die als schöne und gute gern erinnert wird. Was aber ist mit den schwierigen und bedrohlichen Erinnerungen? In den letzten Jahrzehnten sind solche «verdrängten Landschaften» verstärkt ins Visier der landschaftstheoretischen Forschung gerückt.
In den USA entstanden verschiedene Studien, die aufzeigten, dass die nationale Landschaft in ihrer sozialen und ökonomischen Struktur auch durch indigene, subalterne, unterdrückte Teile der Gesellschaft geschaffen wurde. Beispielsweise die Plantage – eine charakteristische Institution der Neuen Welt – wurde durch die physischen Einschreibungen der menschenverachtenden Praxis der Sklaverei in die Landschaft geformt. Nicht nur die Diskrepanz von Herrenhaus und Sklavenhütte, auch die geometrische und übersichtliche Struktur der verschiedenen Felder und Anbauflächen sind weniger durch die Arbeitsorganisation als vielmehr durch Disziplinierungstechniken der Sklavenhalter zu erklären.
Zu diesen offiziellen Landschaften der Sklaverei haben sich auch Gegenlandschaften entwickelt. In den USA waren dies die unsichtbaren Aufenthaltsorte und Fluchtrouten der entlaufenen Sklaven nach Norden, die sich versteckt als Spuren im Raum manifestierten.[4] In Südamerika waren es eher siedlungsbedingte Landschaftsveränderungen, die von geflüchteten Sklaven herrühren: Die brasilianischen Quilombos oder die jamaikanischen und surinamischen Maroon-Dörfer sind von entlaufenen Sklaven (Maroons) gegründete, autonome, demokratisch organisierte und teils befestigte Städte im abgelegenen Landesinnern, die heute wichtige Erinnerungslandschaften der Unterdrückten darstellen.
Eingeschriebene Kultur
Um solche nicht im kollektiven Gedächtnis verankerten Orte zu finden, muss man jedoch nicht weit reisen. Sie liegen unbesehen vor der eigenen Haustüre und werden oft erst nach dem Verschwinden überhaupt bemerkt. So geschehen im Leutschenpark[5] in Zürich, der einst Schiessplatz, dann Standplatz der Fahrenden, Parkplatz – mit anderen Worten – ein Nicht-Ort war, und der heute räumlich und gestalterisch ins Zentrum der Stadtentwicklung gerückt ist. Aber auch Schrebergartenareale, räumliche Horte der Interkulturalität, werden häufig erst nach ihrem Verschwinden erkannt.
Dass sich die Geschichte in die physische Landschaft einschreibt, macht sie zur Kulturlandschaft in einem weiten Sinn des Wortes. So gilt es, Landschaft nicht nur wissenschaftlich zu analysieren, sondern sie auch in ihren immateriellen Bestandteilen und Wahrnehmungsformen zu deuten – sie ernsthaft lesen und verstehen zu wollen.
Anmerkungen:
[01] �Pierre Nora: Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005; Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/89NoraLieuxIntroRepresentations.pdf.
[02] �Simon Schama: Landscape and Memory, New York 1995. S. 6, 7.
[03] �Erst in jüngster Zeit werden die von nomadisch lebenden Gesellschaften genutzten Landschaften auch als Kulturlandschaften erkannt.
[04] �vgl. Ginzburg, Rebecca: «The Fugitive Slave Landscape», in: Landscape Journal, vol. 26 (1) 2007; Vlach, John Michael: Back of the Big House. The Architecture of Plantation Slavery, Chapel Hill 1993.
[05] �Günter, Rolf; Bucher, Annemarie: Ein Quartier im Umbruch – die Entstehung des Leutschenparks 2006–2009. Eine filmische Langzeitbeobachtung im Auftrag von Grün Stadt Zürich 2009.anthos, Do., 2012.05.24
24. Mai 2012 Annemarie Bucher