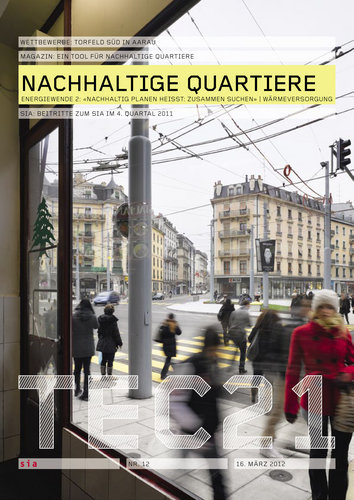Editorial
Bei der Suche nach Massnahmen gegen Klimawandel und Ressourcenverschleiss lag das Hauptgewicht bisher auf der Technik. Doch die Hoffnung, technischer Fortschritt allein werde es richten können, entpuppt sich immer deutlicher als trügerisch, ja schlimmer noch: Die mit technischen Massnahmen erzielten Einsparungen werden durch Reboundeffekte mindestens teilweise wieder zunichte gemacht (TEC21 7/2012). Sektorielle Vorstösse tendieren also zu unbeabsichtigten negativen Handlungsfolgen. Deshalb wird immer mehr Akteuren klar, dass nachhaltige Entwicklung breiter ansetzen muss und nur als interdisziplinäre Querschnittaufgabe gelingen kann. Diese Bandbreite möchte TEC21 mit der diesjährigen Heftreihe «Energiewende» beleuchten: Sie wird neben technischen und ökologischen Aspekten auch gestalterische, soziale, raumplanerische und wirtschaftliche Faktoren thematisieren.
Das vorliegende zweite Heft dieser Reihe vereint eine soziale und eine technische Antwort auf die Herausforderung, in den nächsten Jahren grosse Schritte in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft machen zu müssen: Mit Matthias Drilling präzisiert ein Sozialwissenschaftler, was «soziale Nachhaltigkeit» eigentlich bedeutet, welche Anforderungen sie stellt und welche unerwarteten Möglichkeiten sie eröffnen kann (S. 16); Bruno Bébié und Martin Jakob erläutern das neue Wärmeversorgungskonzept der Stadt Zürich für das Jahr 2050 (S. 21). Noch kommen der soziale und der technische Ansatz getrennt daher, doch wäre es falsch, sie als Gegensatz zu begreifen, da wir lernen müssen, die Sichtweisen miteinander zu verbinden. Gemeinsam ist den Ansätzen der Fokus auf das Quartier: Beide wollen lokale Potenziale nutzen und schlagen auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Massnahmen vor.
Das Quartier rückt heute in den Fokus der Nachhaltigkeitsdiskussion. Denn es ist offensichtlich, dass ein auf das Gebäude beschränkter Fokus viele klima- und ressourcenrelevante Aspekte nicht erfasst, allen voran das Mobilitätsverhalten und die Lebensqualität in unseren Siedlungsräumen. Das Quartier ist ausserdem der Ort, wo sich soziale Nachhaltigkeit entwickeln kann. Die kommunale Ebene ist dagegen für viele Fragen bereits wieder zu gross. Eine Reihe von Tools zur Planung und Bewertung nachhaltiger Quartiere wird gegenwärtig erprobt (Seiten 6 und 10).
Der Fotograf Hannes Henz illustriert die Heftreihe «Energiewende». Da ein nachhaltiges Quartier noch nirgends fotografiert werden kann, hat er für diese Nummer das Quartier La Jonction in Genf besucht – immerhin eines der dichtesten und sozial wie funktional vielfältigsten der Schweiz.
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Torfeld Süd in Aarau
10 MAGAZIN
Ein Tool für nachhaltige Quartiere
16 «NACHHALTIG PLANEN HEISST: ZUSAMMEN SUCHEN»
Claudia Carle, Ruedi Weidmann
Was heisst sozial nachhaltig? Der Geograf, Ökonom und Raumplaner Matthias Drilling äussert sich im Interview zur bisher vernachlässigten dritten Dimension nachhaltiger Entwicklung.
21 WÄRME VERSORGUNG: POTENZIALE DER QUARTIERE
Bruno Bébié, Martin Jakob
Die Stadt Zürich hat für ihr 2000-Watt-Ziel ein Wärmeversorgungskonzept für das Jahr 2050 erarbeitet. Es stellt quartierspezifisch den Energiebedarf der Gebäude dem Angebot an erneuerbaren Energien gegenüber.
28 SIA
Beitritte zum SIA im 4. Quartal 2011
31 FIRMEN
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
«Nachhaltig planen heisst: zusammen suchen»
Wer definiert soziale Nachhaltigkeit? Matthias Drilling ist einer der wenigen Sozialwissenschaftler, die sich Gedanken zur nachhaltigen Entwicklung machen. Die Analysen und Forderungen des Geografen, Ökonomen und Raumplaners sind unbequem und erhellend.
TEC21: Wie erleben Sie die Diskussion um Nachhaltigkeit, was die soziale Dimension betrifft?
Matthias Drilling: Der Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung wird heute praktisch auf Energie- und Umweltziele reduziert. Wenn Fragen nach sozialer Nachhaltigkeit gestellt werden, werden sie meist nur im Dienst ökologischer Zielsetzungen gesehen. Interessant ist, dass wir früher viel mehr darüber wussten, was soziale Nachhaltigkeit ist. Doch dieses Wissen hat bisher kaum Eingang in den Nachhaltigkeitsdiskurs gefunden. Was von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre international geforscht und publiziert wurde über sozialen Wohnungsbau, über Konzepte von Nachbarschaft oder Gemeinschaft, über Verdichtung und soziale Integration, über das Entwickeln von Siedlungen mit der Bevölkerung zusammen – all das ist völlig vergessen gegangen.
TEC21: Wie kam es zu diesem Gedächtnisverlust unserer Gesellschaft?
M.D.: Das in den Sozialwissenschaften aufgebaute Wissen wurde nicht in die Umweltwissenschaften und das Ingenieurwesen transferiert, die heute den Diskurs über Nachhaltigkeit führen. Das hat auch damit zu tun, dass die Sozialwissenschaftler den Nachhaltigkeitsdiskurs nicht ernst genommen haben, da sie ihn für rein umsetzungsorientiert und damit uninteressant hielten. Deshalb tendiert der Diskurs heute zu einer mechanistischen Sicht eines Dreisäulenprinzips: Man nehme etwas mehr Massnahmen aus dieser Säule, dafür etwas weniger aus jener … Abgesehen davon, dass das kein geeignetes Verständnis von Nachhaltigkeit ist, sind wir Sozialwissenschaftler avers gegen die Forderung nach Messbarkeit von Massnahmen. Die wenigen Sozialwissenschaftler, die sich auf den Diskurs einliessen, standen ihm kritisch gegenüber und sahen ihn nicht als Chance, um Wissen und Forderungen der Sozialwissenschaften einzubringen. So ist das Soziale eine Art Erfüllungsgehilfin der Ökologie geworden. Gesellschaftsrelevante Fragen nachhaltiger Entwicklung wurden dem Städtebau überlassen, für den in der Schweiz die Architekturschaffenden zuständig sind, und diese denken enorm objekt- und umsetzungsorientiert. Erst jetzt merken wir Sozialwissenschaftler, welche Chance wir da versäumt haben.
TEC21: Wie lässt sich soziale Nachhaltigkeit heute definieren?
M.D.: Auf globaler Ebene laufen die Vorschläge meistens auf grosse Forderungen wie eine gerechte Verteilung von Lebenschancen hinaus. Im nationalen Massstab wird es schon komplizierter: Da wird zum Beispiel von ‹sozial gerechter Wohnraumversorgung› gesprochen. Auf lokaler Ebene stellt sich die Frage nach dem Geltungsbereich: Beziehen wir uns auf eine Gemeinde, ein Quartier, eine Siedlung oder ein Gebäude? Hier kommen zahlreiche Aspekte ins Spiel: Beteiligung, Nutzungsorientierung, soziale Durchmischung usw. Die SIA-Empfehlung 112/1 ‹Nachhaltiges Bauen – Hochbau› ist ein gutes Beispiel für ein lokales und prozessorientiertes Verständnis in Bezug auf ein Gebäude.
Ich meine, dass wir ‹soziale Nachhaltigkeit› heute im Vokabular des Nachhaltigkeitsdiskurses definieren müssen, damit sie darin Eingang finden kann. Ein fundamentales Kriterium ist etwa, dass wir es immer mit Prozessen zu tun haben. Man kann also nicht sagen, etwas ist sozial nachhaltig, sondern etwas wird sozial nachhaltig, beispielsweise: Wie erreichen wir, dass sich in einer Siedlung eine soziale Durchmischung entwickelt? Dieses Konzept ist anschlussfähig an prozessuale Sichtweisen in der Ökologie. Man kann dabei die Bevölkerung als Ressource bezeichnen. Nachhaltig mit der Ressource Bevölkerung umzugehen heisst, sich bei Planungen und Bauprojekten reflektiert mit Fragen auseinanderzusetzen wie: Wie viel der Ressource Bevölkerung nutze ich – z. B. in Mitwirkungsverfahren oder indem ich die Entstehung einer Nachbarschaft fördere – und wie viel ‹verbrauche› ich, das heisst, wie viele soziale Netze zerstöre ich durch das Verdrängen von Bewohnern? Es geht immer um die Fragen: Für wen baue ich? Und wie interagiert das Projekt mit dem sozialen Kontext?
Soziale Nachhaltigkeit zielt letztlich auch auf soziale Kohäsion: Zusammenhalt in der Gesellschaft, in der Gemeinde, im Quartier, im Haus. Eine sozial nachhaltige Gemeinde kann unterschiedlichste Ansprüche der Bevölkerung befriedigen, seien es die von alten oder jungen Menschen, Neuzugezogenen oder Alteingesessenen, In- oder Ausländern usw. Denn unser Konzept von Gesellschaft beruht darauf, dass heterogene Bevölkerungsteile miteinander in Kontakt stehen, in Konflikte geraten und kreativ damit umgehen – daraus entsteht Innovation. Dagegen wird ein Quartier, in dem nur Menschen aus einer einzigen Bevölkerungsgruppe leben, nicht sozial nachhaltig. Das Extrembeispiel ist die ‹gated community›: eine homogene Bevölkerung ohne Austausch mit anderen Teilen der Gesellschaft, abgetrennt durch einen Zaun und geschützt von Security-Personal. Gemeinden und Investoren sollten sich überlegen, was ihr Projekt zur Kohäsion der Gesellschaft beiträgt.
TEC21: Die Verbreitung der Nachhaltigkeitsidee funktionierte bisher erfolgreich über Labels und Tools. Heute wird daran gearbeitet, sie für ganze Quartiere operabel zu machen. Wie beurteilen sie solche Instrumente?
M.D.: Wir haben bestehende Indikatorensysteme analysiert.[1] Es hat sich gezeigt, dass die soziale Nachhaltigkeit immer zu unpräzise formuliert ist. Da stehen zwar oft Begriffe wie ‹ soziale Integration›, ‹Nahversorgung›, ‹Berücksichtigung von Genderaspekten› oder ‹Mitbestimmung›, aber es wird nicht definiert, wie sie in die Praxis einfliessen sollen.
TEC21: Liessen sich solche sozialen Indikatoren nicht durch messbare Richtwerte operabel machen? Sie sagten, dass Sozialwissenschaftler die Forderung nach Messbarkeit sozialer Massnahmen nicht schätzen …
M.D.: Das ist ja eben der Punkt! Soziale Nachhaltigkeit beruht auf Prozessen und auf Interaktion in diesen Prozessen – auf Verhandlung. Wird irgendwo eine grosse Siedlung geplant, dann wird es erst sozial nachhaltig, wenn das ganz Quartier daran Anteil nimmt und sich zum Beispiel überlegt, wer dort wohnen soll. Vielleicht stellt die Bevölkerung dann fest, dass der Investor nicht das baut, was für das Quartier nützlich wäre. Aus Unzufriedenheit über die Mainstreamproduktion entstehen dann neue Wohnmodelle.
TEC21: Sie plädieren also dafür, Bedürfnisse und Kreativität der Bevölkerung einzubeziehen?
M.D.: Ja. Es gibt Möglichkeiten, das zu fördern. Bei der Stadterweiterung Rieselfeld in Freiburg i. B. entschied sich die Stadtverwaltung, die Bauparzellen statt wie üblich auf Grossinvestoren zuzuschneiden nur 30 × 30 m gross einzuteilen. So konnten auch kleine Bauherrschaften, darunter auch Genossenschaften und die heute bekannten Baugruppen zum Zug kommen. Solche früh ansetzenden Methoden führten zu einer grösseren und vielfältigeren Beteiligung an der Übernahme von Verantwortung und damit zu mehr sozialer Nachhaltigkeit.
TEC21: Müssten also Nachhaltigkeitstools um soziale Indikatoren ergänzt werden, nicht in Form messbarer Werte, sondern indem partizipative Verfahren verlangt oder belohnt werden?
M.D.: Ja, aber ich würde noch etwas weitergehen; soziale Nachhaltigkeit mit Beteiligung gleichzusetzen, greift zu kurz. Ich verweise nochmals auf die SIA-Empfehlung 112/1, die diesbezüglich weitaus mehr Innovationen enthält. Diese Empfehlung könnte man zu einer Norm machen. Normen bewirken viel. Das Bundesamt für Energie erarbeitet gerade einen nationalen Standard zur Nachhaltigkeit. Bei den Unterlagen dazu war ein Verzeichnis bestehender Normen. Da fällt auf, dass die meisten Normen und Ausführungsbestimmungen der Ökologie gelten – und nahezu keine dem Sozialen. Man darf nun aber nicht erwarten, dass wir schon mit der gleichen Präzision aufwarten können wie über zwanzig Jahre Umweltforschung – ein Schicksal, das die soziale übrigens mit der ökonomischen Nachhaltigkeit teilt.
TEC21: Die Bundesämter für Energie und für Raumentwicklung haben mit der Stadt Lausanne und dem Kanton Waadt das Planungs- und Controllinginstrument ‹Nachhaltige Quartiere by Sméo› geschaffen (vgl. S. 10). Wie beurteilen Sie dieses Instrument?
M.D.: Sméo spricht soziale Kriterien zwar an, aber das Tool wendet sich an Investoren. Auf SIA 112/1 wird Bezug genommen, aber sie wird auf die Idee des Lebenszyklus reduziert. Ein wenig wird simuliert, dass das Soziale dann schon irgendwie mit dabei sei. Was ich meinte, geht über Sméo hinaus. Verhandlung findet am runden Tisch und in partizipativen Verfahren statt. Das heisst nicht, dass man für jeden Bau die halbe Stadt einladen muss. Je nach Projekt reicht auch ein Nutzervertreter. Hilfreich wären in dem Zusammenhang auch stärker für soziale Fragen sensibilisierte Fachplaner. Wichtig ist, wie gut die Gemeinden im Rahmen von Planungs- oder Baubewilligungsverfahren ihre Steuerungsmöglichkeiten in Sachen sozialer Nachhaltigkeit wahrnehmen: wen sie fragen und wonach sie fragen. Der Perimeter wird hier meist eng gezogen: Man begrüsst die Einspracheberechtigten und fragt vielleicht noch dort, wo der grösste Widerstand vermutet wird, aber alle anderen tauchen nicht auf.
TEC21: Aber gerade die neuen Quartiertools fassen die Perimeter relativ weit.
M.D.: Das ist richtig. Aber sie definieren nicht, was Gegenstand von Verhandlungen mit der Bevölkerung sein soll. Solche Tools sind schon nützlich. Nur erheben sie einen generellen Anspruch, den sie nicht einlösen können. Am Ende nutzt ein angekreuztes Kästchen nur beschränkt. Ein Beispiel: Beim Masterplan Aarburg-Nord haben wir mit dem Gemeinderat, Orts-, Verkehrsplanungs- und Architekturbüros zusammengearbeitet. Auslöser war der wachsende Verkehr auf der Oltenerstrasse. Eine Steuerung durch Ampeln wurde diskutiert, doch stellte man fest, dass dies die Lebensqualität im Quartier nicht wirklich steigern würde. Wir machten dann eine Sozialraumanalyse. Wir erkannten, dass nicht die Teilung des Quartiers durch Oltenerstrasse und Bahngleise das eigentliche Problem war, sondern seine Teilung in ein ‹Problemquartier› an der Strasse und ein ‹Mittelstandsgebiet› parallel dazu. Deshalb schlugen wir vor, bei der Quartierentwicklung nicht nur die Oltenerstrasse zu beachten, sondern die Quartierstrasse, die parallel dazu als unsichtbare Barriere die problematischen und die privilegierten Quartierteile trennt, zur Begegnungsachse für die Bevölkerungsteile zu entwickeln.
Das Beispiel zeigt, dass die frühe Berücksichtigung sozialer Fragen, von Bedürfnissen der Bevölkerung und Fragen der Lebensqualität zu ganz anderen Massnahmen führen kann als anfänglich geplant. Dazu gehört etwa auch, dass man nicht nur den Lebenszyklus eines Baus, sondern auch den seiner Bewohner betrachtet. So hat man zum Beispiel in Freiburg i. B. auf Wunsch der älter gewordenen Bewohner bei der Energiesanierung eines Hochhauses gleichzeitig auch die Wohnungen verkleinert. Statt 90 gibt es jetzt 139 Wohnungen. Dadurch blieben die Mieten trotz Umbau zum Passivenergie-Hochhaus fast gleich hoch, und die meisten früheren Bewohner konnten wieder ins Haus zurückkehren. Sie sehen also: Wenn wir auf soziale Nachhaltigkeit setzen, müssen wir Verhandlungen möglich machen, wo sich Problemdefinitionen verschieben und unerwartete Lösungen entstehen können. Daran beteiligen können sich Planungsfachleute, Sozialplaner, Behörden, Arbeitsgruppen in der Bevölkerung mit Workshops, Ergebniskonferenzen usw. Wichtig ist, dass mehr hineingetragen werden kann, als die Tools an Kriterien vorgeben, denn wirklich nachhaltige Lösungen müssen aus lokalen Bedingungen, Bedürfnissen und Möglichkeiten entwickelt werden.
TEC21: Nachhaltigkeit kann man also nicht planen, sondern nur zusammen suchen?
M.D.: Das ist doch Planung, zunächst einmal! Planen heisst zusammen suchen.
TEC21: Was bedeutet das für die Disziplin Städtebau?
M.D.: Der Städtebau nimmt oft soziale Themen auf und drückt sie in einem städtebaulichen Begriff aus, der dann kaum mehr sozialwissenschaftlich reflektiert wird. Zum Beispiel ‹Verdichtung›: Darüber diskutieren die Sozialwissenschaften seit über hundert Jahren. Übersetzt in deren Sprache heisst das ‹Nachbarschaft›. In den 1970er-Jahren wurden Nachbarschaften typologisiert und Zusammenhänge mit Bebauungsformen erforscht. Man hat unterschieden zwischen anomischen Nachbarschaften, wo sich die Leute kaum kennen, Stepping- Stone-Nachbarschaften, wo man sich bei Bedarf aushilft, und integrativen Nachbarschaften, deren Bewohner im Alltag viel zusammen machen. Unter dem Aspekt sozialer Nachhaltigkeit wäre es nun intelligent, zu überlegen, was integrative Nachbarschaften fördert. Wenn es uns gelingt, gute Modelle von Nachbarschaften zu entwerfen, dann wird die negativ konnotierte Dichte sekundär. Statt über Ausnützungsziffern sollte man darüber sprechen, welche zusätzlichen Dienstleistungen und Qualitäten dank höherer Dichte erst möglich werden. Dann kommt man auch auf die Idee, dass nicht immer das ganze Erdgeschoss an einen Supermarkt vermietet werden muss. Am besten ist ein Mix: Läden, Kleingewerbe, Cafés, Bibliotheken, Spielgruppen, Gemeinschaftsräume, auch Gemeinschaftsgärten usw. Letztlich geht es darum, die Häufigkeit und Intensität von Begegnungen zu fördern.
TEC21: Dafür verwenden Sie den Begriff ‹soziales Kapital›, der vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu geprägt wurde …
M.D.: Das soziale Kapital, gerne ‹Kitt› unserer Gesellschaft genannt, bezeichnet die Qualität von Beziehungen. Man unterscheidet zwischen verbindendem und überbrückendem sozialem Kapital. Ersteres schaffen Leute mit gleichen Interessen, die sich in Vereinen treffen. Das können wir ziemlich gut und tun es freiwillig. Das Herausfordernde ist das überbrückende soziale Kapital. Es entsteht, wenn Leute, die sich in Einkommen, Alter, sozialem Status, Herkunft, Kultur, Ethnie, Religion usw. unterscheiden, miteinander in Kontakt treten. Das ist seltener und schwierig zu fördern, aber wertvoll für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Soziales Kapital zu mehren, ist das Ziel von sozial nachhaltigen Massnahmen – vorhandenes soziales Kapital zu nutzen, ist der Weg dorthin. Bauten können soziales Kapital zerstören, etwa wenn Leute durch preissteigernde Renovationen aus ihrer Nachbarschaft vertrieben und damit Netzwerke auseinandergerissen werden. Architekturprojekte können aber auch zur Bildung von sozialem Kapital beitragen. Ein aktuelles Beispiel sind die Mehrgenerationenhäuser. Unverständlich finde ich, wenn solche Innovationen nur als Spielereien oder Nischenprodukte gesehen werden. Für Investoren würde es sich durchaus lohnen, systematisch in soziales Kapital zu investieren. Gewinne wären mehr Identifikation der Bewohner, weniger Fluktuation, mehr Verantwortung für die Umgebung, weniger Unterhaltsarbeiten usw. Und es würden höhere bauliche Dichten akzeptiert. Alternative Wohn-, Bewirtschaftungs- und Investorenmodelle sind vielversprechende Innovationen, der heutige Mainstream dagegen ist nicht zukunftsfähig. Hier frage ich mich, warum es von Bund und Kantonen, die ja viele Fördergelder für Energieeffizienz und erneuerbare Energien zahlen, nicht auch ein Förderprogramm für soziale Nachhaltigkeit gibt.
TEC21: Ist denn wirklich ein solcher Aufwand im Sozialen nötig, um etwa die 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen? Geht das nicht einfacher über verbesserte Technik und finanzielle Steuerungsmechanismen, etwa eine CO2-Abgabe?
M.D.: Es braucht ein richtiges Portfolio. Wenn wir an den Freizeitverkehr und die Flugreisen denken, ist doch deutlich, dass wir auch auf Lebensstile Einfluss nehmen müssen. Welchen Sinn hat es, im CO2-freien Haus auf der Couch zu sitzen und Pläne für den nächsten Last-Minute-Flug-Urlaub zu schmieden? Also müssen wir Anreize für weniger energieintensive Lebensstile schaffen, z. B. indem wir die Lebensqualität unserer Quartiere so stark erhöhen, dass wir nicht x-mal im Jahr wegfliegen wollen.
Anmerkung:
[01] M. Drilling, D. Blumer: Die soziale Dimension nachhaltiger Quartiere und Wohnsiedlungen. Zwischenbericht zu Händen des Bundesamtes für Wohnungswesen. Hochschule für Soziale Arbeit, FH Nordwestschweiz. Olten/Basel 2009TEC21, Fr., 2012.03.16
16. März 2012 Claudia Carle, Ruedi Weidmann
Wärmeversorgung: Potenziale der Quartiere
Die Stadt Zürich hat ein Wärmeversorgungskonzept für das Jahr 2050 erarbeitet. Es stellt für jedes Quartier die Entwicklung des Energiebedarfs der Gebäude dem Angebot an erneuerbaren Energien gegenüber und zeigt, dass die 2000-Watt-Ziele im Gebäudebereich mit forcierten Gebäudeerneuerungen und weitestmöglicher Nutzung erneuerbarer Energien erreichbar sind.
In der Stadt Zürich werden derzeit pro Kopf rund 5000 W Primärenergie verbraucht und Treibhausgasemissionen von rund 5.5 t verursacht. Rechnet man die – allerdings nur grob quantifizierbare – graue Energie in den Gütern und Dienstleistungen dazu, liegen die beiden Werte noch deutlich höher. Die seit 2008 in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich verankerten Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft (vgl. Kasten) sehen vor, den Primärenergieverbrauch langfristig auf 2000 W pro Kopf und den Treibhausgas-Ausstoss bereits bis 2050 auf 1 t CO2 pro Kopf zu reduzieren.
Im Rahmen verschiedener Projekte wurden mittlerweile die Grundlagen für Strategien und Massnahmen zur Umsetzung dieser Ziele erarbeitet. Dazu gehört ein 2000-Watt-kompatibles Wärmeversorgungskonzept für das Jahr 2050.1 Darin wurde im Auftrag der Stadt Zürich unter Einbezug der betroffenen Dienstabteilungen und der städtischen Energieanbieter (Fernwärme Zürich, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich [EWZ], Erdgas Zürich AG) räumlich differenziert ermittelt, welche Potenziale für die Wärmeversorgung der Stadt Zürich nutzbar gemacht werden können, und zwar auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. Das Konzept zeigt also, in welchen Gebieten der Stadt welche Energieeffizienzmassnahmen, Energieträger und Energiesysteme priorisiert werden sollen. Im Vordergrund standen dabei die gebäudegebundene Wärme- und Stromversorgung – ohne Elektromobilität. Aufseiten des Energieangebots lag der Fokus auf den lokalen Potenzialen für die Wärmeversorgung, weil Wärme im Vergleich zu Strom schlechter transportierbar ist.
Berücksichtigte Einflussfaktoren und Szenarien
Das Projekt berücksichtigt drei Haupteinflussfaktoren: die lokale Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, die durch städtebauliche Vorgaben beeinflusste bauliche und räumliche Entwicklung (Energiebezugfläche [EBF] pro ha) sowie die durch Erneuerungsmassnahmen beeinflusste Energieeffizienz (kWh/m2 EBF).
Betrachtet werden dabei verschiedene Szenarien, die sich in ihren Annahmen zu Erneuerungsrate und -tiefe des Gebäudeparks, zur Verbreitung von Wärmeversorgungsverbünden sowie zur Nutzung des Angebots von lokal vorhandenen erneuerbaren Energien unterscheiden (Abb. 1). Das Referenzszenario geht von einer moderaten Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien aus, die bis ins Jahr 2010 beschlossene Massnahmen mit berücksichtigt. Das Effizienzszenario, von dem es verschiedene Varianten gibt, setzt hingegen eine deutliche Steigerung in diesen Bereichen voraus. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten des Effizienzszenarios sind eher gering, sodass in der Folge nur noch die Variante a dargestellt wird. In allen Varianten spielen die fossilen Energieträger am Ende der Betrachtungsperiode im Jahr 2050 nur noch eine unterstützende Rolle.
Berücksichtigt wird auch die künftige Dynamik von Bevölkerung und Beschäftigten in der Stadt Zürich, wobei diesbezüglich alle Szenarien gleich behandelt werden.
Unterschiedliche Entwicklung je nach Stadtgebiet
Ein zentrales Element des Projekts ist die räumliche Differenzierung der untersuchten Einflussfaktoren, da sich die Energienachfrage lokal unterschiedlich entwickeln wird und das Angebot an erneuerbaren Wärmequellen sowie die bestehende energetische Infrastruktur je nach Stadtgebiet variieren. Die Entwicklung der Energienachfrage wird von der unterschiedlichen Zunahme der Gebäudeflächen bestimmt, die wiederum von der Ausschöpfung der verschiedenen Ausnutzungsreserven bzw. Verdichtungspotenziale abhängt. Die Entwicklung der Energieeffizienz der Gebäude wird zudem durch die Gebäudealter bestimmt, die unterschiedliche Erneuerungszeitpunkte und Effizienzgewinne zur Folge haben. Städtebauliche, architektonische und denkmalpflegerische Aspekte beeinflussen in den verschiedenen Zonen ebenfalls die Effizienzentwicklung sowie die Rück- und Neubautätigkeit.
Auch das Angebot an erneuerbarer Wärmeenergie ist stark lokal gebunden. Zudem ist bei der Wärme eine unmittelbare räumliche Nähe zwischen Angebot und Nachfrage wichtig. Durch eine räumlich differenzierte Untersuchung kann in den einzelnen Stadtgebieten die mutmassliche künftige lokale Wärmenachfrage mit den Schätzungen zum lokal verfügbaren Angebot an erneuerbarer Wärmeenergie verglichen werden. Um dieses optimal nutzen zu können, ist für die Abdeckung des Bedarfs nach Spitzenenergie ein gewisser, im Vergleich zur heutigen Wärmeversorgung aber massiv reduzierter Anteil fossiler Energien akzeptabel.
Entwicklung der Wärmenachfrage
Die Entwicklung des Energiebedarfs der Gebäude bis 2050 wurde mit dem Gebäudeparkmodell (GPM)4 abgeschätzt. Es basiert auf dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWZ) der Stadt Zürich, in dem alle Gebäude auf dem Stadtgebiet in einem geografischen Informationssystem (GIS) erfasst sind. Je nach Gebäudekategorie, Bauperiode, Denkmalschutzvor- gaben und Bauzone wurden die Gebäude in verschiedene Erneuerungstypen mit spezifischen Annahmen zur Erneuerung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik eingeteilt. Daraus ergaben sich räumlich differenzierte Erneuerungsmassnahmen und Effizienzgewinne. Der spezifische Energiebedarf wurde mit SIA 380/1 für eine überschaubare Anzahl typisierter Fälle berechnet und dann differenziert auf alle Gebäude hochgerechnet. Zudem wurden die Vorgaben aus dem Regionalen Entwicklungskonzept der Stadt Zürich (RES)2 zu den Potenzialen für bauliche Verdichtungen für jedes Stadtgebiet integriert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Wärmenachfrage im Effizienzszenario bis 2050 je nach Gebiet zwischen 35 bis 42 % sinkt (Abb. 2), im Referenzszenario nur um 15 bis 27 %. Je nach Gebiet wird die Entwicklung mehr oder weniger stark von den beiden gegenläufigen Faktoren Flächenwachstum und Effizienzentwicklung beeinflusst. In Gebieten mit viel Neubau- und Ersatzneubaupotenzial steigt die Energiebezugsfläche, dafür ist der Energieeffizienzstandard deutlich besser als bei bestehenden Bauten. Umgekehrt bleibt in Gebieten wie dem Stadtkern die Fläche etwa konstant, aber auch Veränderungen an den Bauten sind eingeschränkt, sodass die Einsparungen geringer sind. Darüber hinaus wurden Sensitivitätsrechnungen durchgeführt. Diese ergaben beispielsweise, dass eine stärkere Ausschöpfung der verfügbaren Reserven oder das hypothetische Weglassen von architektonischen, denkmalpflegerischen oder städtebaulichen Einschränkungen die Ergebnisse nicht wesentlich verändern.
Angebot an erneuerbaren Wärmequellen
Die Abschätzung der Angebotspotenziale von erneuerbarer Wärme basiert auf geografisch verorteten Daten zu ihren physischen Potenzialen und den Möglichkeiten für deren tatsächliche Nutzung (Abb. 3). Im Fokus stehen folgende Wärmequellen: Umgebungsluft, untiefe Geothermie, Grundwasser bzw. Oberflächengewässer und Abwasser für Wärmepumpenanwendungen, Solarenergie, Kehricht als Input für die Fernwärme, Holz und andere Biomasse, Biogas sowie tiefe Geothermie als langfristige Option.
Aufgrund der räumlichen Verfügbarkeiten und Einschränkungen für jede dieser Quellen sowie der Einflussfaktoren der Nachfrageentwicklung wurden verschiedene Gebietstypen definiert. Im bestehenden Fernwärmegebiet beispielsweise wird weiterhin von einer Abwärmenutzung der Kehrichtverbrennungsanlage ausgegangen. In Zürich-Altstetten lässt sich die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Werdhölzli wärmetechnisch nutzen, und in Seeund Limmatnähe bietet die Nutzung von Seewasser eine gute Basis für Wärmepumpennutzungen im Winter und effiziente Gebäudekühlung im Sommer. Auch der Grundwasserkörper zwischen der Zürcher Innenstadt und Zürich-Altstetten bietet gewisse energetische Potenziale. Voraussetzung für die Nutzung dieser Energiequellen sind neu zu erstellende Energieverbünde wie sie exemplarisch in kleinerem Ausmass in Zürich und auch in anderen Städten geplant sind oder bereits bestehen (z. B. in Genf, Basel, St. Gallen). In weiteren, vornehmlich dezentralen Quartieren wie z. B. Witikon, Zürichberg, Höngg, Affoltern oder Albisrieden haben Erdsonden-Wärmepumpen einen höheren Stellenwert. Es wurde jeweils angenommen, dass der Strombedarf für die Wärmepumpen zunehmend durch erneuerbare Elektrizität gedeckt wird.
2050 dominieren Wärmepumpen und Fernwärme
Vergleicht man nun die Nachfrageszenarien mit den geschätzten Potenzialen der lokal gebundenen Angebote, ergibt sich für 2050 für jede erneuerbare Energiequelle und im Total ein Nutzungsüberschuss oder -defizit pro Teilgebiet. Lokale Defizite werden mit lokal ungebundenen erneuerbaren Energien (v.a. Biogas und feste Biomasse) und geringfügig durch fossile Energieträger, vor allem zur Spitzendeckung, ausgeglichen.
Zu Beginn der Betrachtungsperiode im Jahr 2005 wurde die Wärmenachfrage (Raumheizung und Warmwasser) hauptsächlich durch Erdgas und Erdöl (85 %) und etwas Fernwärme gedeckt. Die beiden fossilen Energieträger werden bis 2050 in allen Szenarien zunehmend von anderen Energieträgern abgelöst (Abb. 5). 2050 wird die bis dann reduzierte Wärmenachfrage im Effizienzszenario nur noch zu rund 5 bis 10 % mit Öl und Erdgas gedeckt, während Wärmepumpen (Strom und Umweltwärme) sowie Fernwärme den höchsten Anteil aufweisen. Die Fernwärme steigt anteilsmässig um einen Drittel, wobei der Absatz absolut etwa konstant bleibt. Der Wärmepumpenanteil vervielfacht sich, allerdings ausgehend von einem tiefen Niveau. Zum Vergleich: im Referenzszenario verringern sich die Anteile der fossilen Brennstoffe ebenfalls, machen aber 2050 immer noch 65 % aus (Gas und Öl).
2000-Watt-ziele in Griffweite
Abbildung 6 zeigt die aus dem Effizienzszenario Variante a resultierende Entwicklung der Nachfrage für erneuerbare, nukleare und fossile Primärenergie sowie die Treibhausgasemissionen bis 2050. Die hier für die Gebäude der Stadt Zürich geschätzte Reduktion des Primärenergieverbrauchs ist mit rund 60 % deutlich grösser als die Schweizer 2000-Watt-Vorgabe für 2050 (–44 %). Dies gilt mit einer Reduktion von 86 % auch für die Treibhausgasemissionen (Schweizer Vorgabe: –77 %). Selbst die verschärfte Reduktionsanforderung der Gemeindeordnung der Stadt Zürich von 82 % liegt im Effizienzszenario in Griffweite. Die zu erwartende Nachfrageverschiebung hin zum Strom wirkt sich bezüglich Treibhausgasemissionen bei der unterstellten Strombeschaffung aus erneuerbaren Quellen5 nicht nachteilig aus.
Ob die Ziele im Gebäudebereich auch dann erreicht werden, wenn die eingangs erwähnten Systemgrenzen weiter gezogen werden, ist künftig noch genauer zu prüfen. Insbesondere stellt sich die Frage, ob Primärenergie und Treibhausgasemissionen in den Bereichen Mobilität (inkl. Infrastruktur) und Erstellung, namentlich bei den für die Zielerreichung erforderlichen baulichen Massnahmen, bis 2050 ebenfalls entsprechend reduziert werden können. Um diese und weitere Fragen in Richtung Umsetzung des Konzepts zu beantworten, sind verschiedene Vertiefungsprojekte bei noch offenen Punkten geplant. So beispielsweise im Bereich der Erdsondenpotenziale bei verdichteter Bauweise oder bei den effektiven Nutzungsmöglichkeiten des Seewassers, für welche im Moment die kantonalen Grundlagen überarbeitet werden. Das Konzept soll ausserdem die Grundlagen liefern für eine später allenfalls zu erstellende GIS-gestützte Informationsplattform zuhanden von Bauherrschaften, Planern und Anbietern von Energiedienstleistungen. Sie könnte die Akteure bei Gebäudeerneuerungen und Neubauten bei der Energieträgerwahl unterstützen und z. B. über verfügbare erneuerbare Energiequellen oder geplante Energieverbünde informieren. Auch die erforderlichen energiepolitischen Massnahmen zur Umsetzung des Konzepts sind in der Folge zu konkretisieren.TEC21, Fr., 2012.03.16
16. März 2012 Bruno Bébié, Martin Jakob