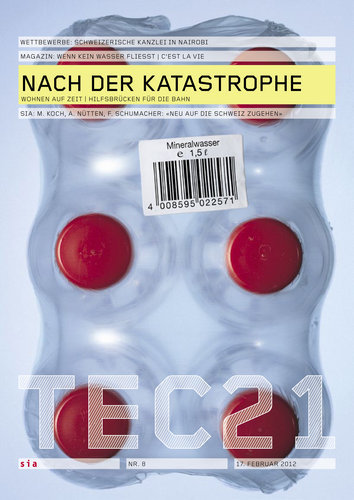Editorial
Die Schweiz ist auch deshalb ein wohlhabendes und stabiles Land, weil sie selten und in vergleichsweise geringem Ausmass von Katastrophen heimgesucht wurde. Ereignisse im Ausland (und die Statistik) erinnern aber immer wieder daran, dass Katastrophen jederzeit, hier und überall, eintreten können. Deshalb betrachten wir in dieser Ausgabe von TEC21 das Szenario eines Grossereignisses in der Schweiz.
Aus bautechnischer Sicht interessiert dabei die Frage, wie es nach der akuten Phase weitergeht, wie wir nach einer natürlichen oder anthropogenen Katastrophe wieder in einen geordneten Alltag zurückfinden, Strukturen wiederherstellen können. Diese glücklicherweise hypothetischen Fragen lassen sich nicht erschöpfend beantworten; einige Aspekte haben wir herausgegriffen. Sie betreffen die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nach Unterkunft, Trinkwasser und Mobilität.
Mit Unterkünften nach Katastrophen verbinden wir meist Zeltstädte, Barackensiedlungen oder überfüllte Turnhallen und Zivilschutzanlagen – Lebenssituationen, die in unserer Gesellschaft nach wenigen Tagen nicht mehr tragbar wären. Neue Häuser zu erstellen, würde aber zu lange dauern, und bei grossen Ereignissen wird sich nicht genügend leer stehender Wohnraum für alle Betroffenen finden lassen. In Japan und Italien – zwei häufig von Erdbeben betroffenen Ländern – realisierte neue Baukonzepte, die rasch verfügbar sind und trotzdem einen akzeptablen Lebensstandard bieten, könnten im Bedarfsfall auch in der Schweiz dazu beitragen, die Folgen einer Katastrophe effizient zu bewältigen («Wohnen auf Zeit»).
Die regelmässige Versorgung mit Trinkwasser ist für uns selbstverständlich; einige Stunden ohne fliessendes Wasser – etwa als Folge eines durch Frost verursachten Rohrbruchs – werden bereits als Zumutung empfunden. Was wäre aber, wenn während Tagen oder Monaten kein Wasser aus den Hähnen sprudelt? Damit dieses Szenario nach Katastrophen nicht eintritt, sorgen die Versorgungsunternehmen technisch und organisatorisch vor, was auch einheitliche gesetzliche Regelungen bedingt. Der Kanton Zürich nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein («Wenn kein Wasser fliesst»). Katastrophen unterbrechen Strassen- und Bahnverbindungen, gefährden die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern. Die schnelle Wiederherstellung der Verkehrsinfrastruktur ist deshalb von vitaler Bedeutung. Bei der Eisenbahn kann die Verwendung von bereits vorhandenen, kurzfristig verfügbaren Brücken entscheidend dazu beitragen («Hilfsbrücken für Eisenbahnen»).
Die Beispiele zeigen, dass unsere Gesellschaft auf bekannte technische Folgen von Katastrophen vorbereitet ist. Wir können aber nicht wissen, ob das ausreicht.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schweizerische Kanzlei in Nairobi
09 MAGAZIN
Wenn kein Wasser fliesst | C’est la vie | DGNB-Label fasst Fuss in der Schweiz
16 WOHNEN AUF ZEIT
Claudia Hildner
Shigeru Ban und Ruattistudio Architetti haben in den Katastrophengebieten von Nordostjapan bzw. Mittelitalien schnell erstellbare temporäre Wohnbauten realisiert. Darin wohnen obdachlos gewordene Opfer bis zum Wiederaufbau der Ortschaften.
22 HILFSBRÜCKEN FÜR DIE BAHN
Max Bosshard, Helmut Heimann, Aldo Rota
Für den Einsatz in Baustellen verfügen die SBB über mobile temporäre Eisenbahnbrücken. Diese genormten Stahlbauwerke können auch bei Katastrophen kurzfristig als Ersatz für kleinere zerstörte Brücken dienen.
28 SIA
Michael Koch, Andreas Nütten, Fritz Schumacher: «Neu auf die Schweiz zugehen!»
33 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Neun Liter Trinkwasser pro Person beträgt der empfohlene Notvorrat zur Überbrückung einer Notlage bei der Wasserversorgung (Foto: KEYSTONE/Hans Jörg Walter)
Wohnen auf Zeit
Ein neues Zuhause für Menschen, die alles verloren haben: Wenn Erdbeben oder Orkane das vertraute Umfeld zerstören, müssen die Betroffenen bis zum Wiederaufbau meist in temporären Unterkünften untergebracht werden. Zwei Beispiele aus Japan und Italien zeigen, welche Kriterien bei ihrem Entwurf zählen: Das von Shigeru Ban gegründete «Voluntary Architects’ Network» setzt in Onagawa auf kurze Bauzeit und gemeinschaftliche Einrichtungen, für die Mailänder Ruattistudio Architetti stehen in L’Aquila eine ansprechende Erscheinung und die flexible Nutzung im Vordergrund.
Nach Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürmen oder Vulkanausbrüchen kann es bis zum Wiederaufbau der zerstörten Strukturen mehrere Jahre, bisweilen Jahrzehnte dauern. Zwischen der ersten kurzfristigen Unterbringung in Zelten oder Turnhallen und der Rückkehr in die Heimatorte benötigen die Katastrophenopfer temporäre Unterkünfte, um im Winter und bei schlechtem Wetter sicher und gesund leben zu können. Für gefährdete Kommunen empfiehlt es sich, entsprechende Standorte schon im Vorfeld festzulegen und Grundstücke bereitzuhalten, auf denen sich schnell und ohne grossen bürokratischen Aufwand Unterkünfte errichten lassen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, temporäre Wohneinheiten bereitzustellen: Es können vorfabrizierte Standardlösungen – wie etwa Container oder Wohnmodule – angefordert und damit Siedlungen errichtet werden. Oder es können ausgewählte Planerteams die Aufgabe übernehmen, im Rahmen der Möglichkeiten geeignete Wohnlösungen zu schaffen. Zwei Beispiele aus Italien und Japan zeigen, wie temporäre Behausungen nach einer Katastrophe je nach klimatischem, topografischem und kulturellem Kontext unterschiedlich gestaltet sein können. Grundsätzlich sind die Situationen vergleichbar, da es sich bei beiden Nationen um industrialisierte Länder handelt. In Entwicklungsländern zieht man es hingegen oft vor, unmittelbar nach dem Ereignis mithilfe lokaler Materialien und traditioneller Handwerkstechniken sofort Häuser aufzustellen, die auf Dauer bewohnt werden können.
Container für Nordostjapan
Bei dem Tsunami in Nordostjapan im März 2011 sind gemäss offiziellen Angaben etwa 16000 Menschen umgekommen, über 3000 werden noch vermisst.[1] Annähernd 130000 Häuser sind vollständig zerstört worden, davon allein 80000 in der Präfektur Miyagi. Die Bereitstellung einer ausreichenden Menge an temporären Unterkünften verzögerte sich aufgrund des grossen Bedarfs und bürokratischer Hindernisse. Auch die Topografie Japans spielte eine Rolle: Die Verantwortlichen hatten sich für vorfabrizierte eingeschossige Wohnmodule entschieden, da diese sehr schnell realisiert werden können – ausreichend grosse ebene Bauplätze, auf denen diese Standardlösungen platziert werden konnten, standen vielerorts aber nicht zur Verfügung. So auch in der Gemeinde Onagawa in der Präfektur Miyagi, einer Ortschaft mit 10000 Einwohnern, in der der Tsunami etwa 4000 Häuser zerstört hatte. Eine Lösung für dieses Problem fand das Voluntary Architects’ Network (VAN), eine vom japanischen Architekten Shigeru Ban gegründete Organisation zur Unterstützung von Katastrophenopfern.
Als grundlegendes Modul wählten die Architekten von VAN Container für Überseetransporte, die sie aber nicht als eingeschossige Einheiten über die Fläche verteilten, sondern in zwei- bis dreigeschossigen Riegeln zusammenfassten. Diese Bauweise erforderte zwar weiterhin einen ebenen Baugrund, der aber wesentlich besser ausgenützt werden konnte. So konnten in Onagawa auf der Fläche eines Baseballfeldes[2] – da keine anderen freien Flächen zur Verfügung standen, hatte die Gemeinde beschlossen, dieses Sportfeld zu «opfern» – etwa 190 Familien ein neues Zuhause finden. Die Riegel sind schachbrettartig aufgebaut: Zwischen den einzelnen Containern ist jeweils ein leerer Zwischenraum angeordnet, der von einem einfachen Rahmen umschlossen wird. Dieser zusätzliche Raum ist an einer Schmalseite vollständig verglast; auf der anderen Seite befindet sich jeweils der Zugang zu den Wohnungen.
Ein Vorteil bei der Verwendung von Containern ist die kurze Bauzeit – die gesamte Siedlung wurde in etwa zweieinhalb Monaten errichtet. Die Bauten sind so ausgelegt, dass sie über längere Zeiträume als Unterkunft dienen können. Shigeru Ban schwebt vor, dass nicht mehr gebrauchte Einheiten für kommende Schadenereignisse bereitgehalten werden. Da grössere Erdbeben in Japan in regelmässigen Abständen zu erwarten sind, wäre eine solche «mobile» Siedlung durchaus sinnvoll.
Bescheidenes Raumangebot, dafür soziale Integration
Bei den Wohnungsgrössen orientierten sich VAN an den Dimensionen anderer in Nordostjapan bereits verwendeter Notunterkünfte: Es gibt drei Einheiten, die 20, 29 und 40 m² gross sind. Die kleinste Wohnung ist für einen oder zwei Bewohner gedacht, die mittlere Unterkunft soll drei oder vier Personen Platz bieten und das grösste Modul wird an Familien mit mehr als vier Mitgliedern vergeben. In weiten Teilen Europas mögen solche winzigen Wohnungen als eine Zumutung erscheinen – für japanische Verhältnisse sind sie nicht ungewöhnlich.
Die Wände bestehen aus Leichtbauplatten, die Böden sind mit Teppichfliesen belegt. Anders als bei den «herkömmlichen» Notunterkünften der Regierung entschieden sich die Architekten in Onagawa dazu, auch die Einrichtung der Wohnungen zu entwerfen. So wurden die Regale aus verdübeltem Brettsperrholz von Freiwilligen (Architekturstudierenden) zusammengebaut an die Wände geschraubt.[3] Damit sollten den Bewohnern Möbel zur Verfügung gestellt werden, deren Dimensionen im Gegensatz zu gekauften Standardmöbeln auf die schmalen Container abgestimmt sind.
Wichtig war dem VAN bei diesem Projekt, dass zusammen mit den Wohneinheiten auch gemeinschaftliche Einrichtungen bereitgestellt werden: Das Problem vieler temporärer Wohnsiedlungen ist, dass sie als reine «Schlafstädte» konzipiert werden und es keine Orte gibt, an denen man sich treffen, sich austauschen oder etwas veranstalten kann. In der Siedlung in Onagawa gibt es ein Zelt, das als Markthalle dient, ein Gemeinschaftshaus für Veranstaltungen und ein Atelier, in dem zum Beispiel Unterricht stattfinden kann. Ein solches Gesamtkonzept ist umso wichtiger, je länger Menschen in einer temporären Wohnsiedlung untergebracht sein müssen.
Holzbauten in den Abruzzen
Um eine Grössenordnung kleiner als in Nordostjapan erscheinen die Schäden, die das Erdbeben vom April 2009 in Mittelitalien verursacht hat. In der Stadt L’Aquila und ihrer Umgebung hatten die Erdstösse bis zu 15000 Gebäude beschädigt, die meisten davon in den östlich gelegenen Dörfern. Im Rahmen des «Progetto C.A.S.E.» wurden bald nach dem Beben auf geeigneten Baufeldern rund um L’Aquila erdbebensichere Betonplattformen geschaffen, auf denen die neuen temporären Wohnbauten errichtet werden sollten. Diese Bodenplatten ruhen mittels Gleitpendellagern, die die Energie eines Bebens aufnehmen, auf Stahlstützen. Dadurch wird die Betonplatte, auf der das Gebäude steht, von den Stützen und damit vom Baugrund entkoppelt (seismisch isoliert). Diese Lösung wurde gewählt, weil Gleitpendellager relativ preisgünstig sind, weil sie innert drei Wochen produziert und in einem Tag montiert werden können und weil sie für den realisierten Bautyp geeignet waren.
In einem speziellen Realisierungswettbewerb suchte man die entsprechenden Planungs-teams. Die Entwürfe der Teilnehmer wurden anhand eines Punktesystems bewertet: Zu den entscheidenden Kriterien zählten die Baukosten und die Realisierungszeit, beziehungsweise die Zahl der Gebäude, die bis zum Wintereinbruch verwirklicht werden konnten, aber auch die Energieeffizienz, die Ausnutzung des Grundstücks sowie die Flexibilität der Unterkünfte hinsichtlich einer möglichen späteren Nutzungsänderung.
Einer der Entwürfe, der in diesem Wettbewerb erfolgreich war und später verwirklicht wurde, stammt vom Planungsteam Ruattistudio Architetti aus Mailand. Da sie den genauen Ort, an dem das Projekt verwirklicht werden sollte, nicht kannten, entwickelten die Architekten ein standardisiertes Volumen mit einer Grundfläche von rund 20×58 m. Das ist die maximale Grösse der Plattformen, auf denen die neuen dreistöckigen Gebäude zu errichten waren.
Da manche dieser Betonplattformen aber, je nach Grundstücksgrösse, etwas kleiner erstellt wurden, sollten sich die entworfenen Gebäude bei Bedarf auch ohne viel Aufwand um ein paar Meter kürzen lassen. Es war auch geplant, die einzelnen Wohnmodule samt Erschlies-sung auf verschiedene Arten untereinander zu kombinieren. Die Laubengänge der Gebäude sind, soweit möglich, nach Süden ausgerichtet. Der von Ruattistudio Architetti entwickelte Gebäudetyp wurde schliesslich in drei Ortschaften rund um L’Aquila verwirklicht: Zwei der Riegel stehen in Tempera, drei in Roio Poggio und einer in Paganica. Die reine Bauzeit betrug 85 Tage, etwa gleich lang wie bei der Containerlösung in Nordostjapan, nur dass in dieser Zeit deutlich weniger Einheiten verwirklicht werden konnten. Die Umstände am konkreten Standort konnten die Architekten aus Zeitmangel in ihren Entwurf kaum einfliessen lassen – dennoch ist es gelungen, Wohneinheiten zu entwickeln, die einen eigenen Charakter haben und in ihrer Materialität hochwertig wirken. Ansprechender Ausbau, auch auf Dauer nutzbar
«Wir wollten keine Containerbauten, es sollte nicht nach einer temporären Lösung aussehen», sagt Juanita Ceva Valla von Ruattistudio. Die Wahl fiel daher auf eine Holzkonstruktion, die teilweise aus vorgefertigten tragenden Holzbauplatten und teilweise aus mit Gipskartonplatten bekleideten Sandwichelementen besteht. Die Böden sind mit Parkettlaminat belegt. Gespart wurde dort, wo es nicht wehtut: Die Erschliessung erfolgt wie bei dem Projekt in Onagawa über eine vorgesetzte Stahlkonstruktion, die Laubengänge bildet. Weisse Sichtschutzelemente lassen die Fassade in diesem Bereich lebendig, fast elegant wirken. Im Inneren ist die Decke im Rohbauzustand belassen worden, dafür wurde bei den Bädern auf Zellenlösungen verzichtet, die auf den temporären Charakter der Wohnungen hingewiesen hätten. Die reinen Baukosten für die sechs Gebäude betrugen rund 14 Mio. Euro, was mittleren Kosten von rund 2.3 Mio. Euro pro Haus entspricht.
Im Gegensatz zu den Containern in Nordostjapan, die eher eine Übergangslösung darstellen sollen, sind die Bauten in der Umgebung von L’Aquila im Hinblick auf eine spätere Zweitnutzung auf Dauer angelegt. Wenn die jetzigen Bewohner ausziehen, könnten die Wohnblöcke von Ruattistudio Architetti etwa in ein Studentenwohnheim umgebaut werden, denn die Innenwände lassen sich ohne grossen Aufwand versetzen. Bei den neuen Siedlungen rund um L’Aquila fehlt jedoch ein übergeordnetes städtebauliches Konzept mit Begegnungs- und Identifikationsorten. Da der Wiederaufbau der Altstadt von L’Aquila nur schleppend vorangeht, wären gemeinschaftliche Einrichtungen sowie eine gute Anbindung an die lokalen Zentren für das dauerhafte Funktionieren dieser Siedlungen sehr wichtig.
Es gibt keine Patentlösung
Die beiden Projekte in Italien und Japan haben einiges gemeinsam: Sie wurden in sehr kurzer Zeit entworfen und realisiert, sind ganz oder in Teilen vorgefertigt und haben eine ähnliche Struktur. Beide Projekte sind nicht von professionellen Krisenmanagern, sondern von Architektinnen und Architekten initiiert worden. Angesichts der Überforderung oder des Ungenügens der offiziellen Planungsinstanzen sind sie eigene Wege gegangen, um rasch zu helfen und unter erschwerten Bedingungen mehr als das Minimum an Lebensqualität zur Verfügung zu stellen. Angesichts des Ausmasses der Zerstörungen entsprechen die beschriebenen lokalen Projekte dem sprichwörtlichen Tropfen auf den heissen Stein; für die Umsetzung im grossen Massstab fehlen den Initianten (noch) die Mittel und der politische Einfluss. Wenn sich die Unterkünfte während einiger Jahre bewähren, ist die Hoffnung berechtigt, dass derartige Bauten breite Anerkennung finden und zu Standards für die Unterbringung von Katastrophenopfern werden. Für ihre Akzeptanz ist es wichtig, dass sie die lokalen kulturellen, topografischen und klimatischen Gegebenheiten berücksichtigen; deshalb kann es keine uniforme globale Lösung für die Architektur nach Katastrophen geben.
Anmerkungen:
[01] National Police Agency of Japan, www.npa.go.jp
[02] Approximativ ein Viertelkreis mit einem Radius von 90–120 m Länge mit einer Fläche zwischen 3400 und 11 300 m²
[03] Insgesamt arbeiteten 187 Freiwillige während zweieinhalb Monaten in Tagesschichten von 10 bis 20 Personen an diesem Projekt mitTEC21, Fr., 2012.02.17
17. Februar 2012 Claudia Hildner
Hilfsbrücken für die Bahn
Eisenbahnhilfsbrücken sorgen dafür, dass Bahnlinien nicht wegen Baustellen an Brücken unterbrochen werden müssen. Diese vormontierten Stahlbauwerke können in kurzen Sperrpausen auf vorbereiteten Lagern eingebaut werden und ermöglichen Bauarbeiten unter Bahnverkehr, ohne dass die Zugfahrenden viel davon merken. Die robusten und flexibel einsetzbaren Hilfsbrücken können aber auch kurzfristig abgerufen werden, wenn Bahnverbindungen durch ausserordentliche Ereignisse unterbrochen werden.
Bei natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen kann auch die Verkehrsinfrastruktur beeinträchtigt oder gar lahmgelegt werden. Insbesondere Brücken sind durch Hochwasser, Murgänge, Überschwemmungen, seltener durch Lawinen oder Bergstürze gefährdet. Erfahrungsgemäss hatten auch kleinere, noch nicht katastrophale Hochwasser immer wieder den Ausfall von Brücken zur Folge. Da Verkehrsverbindungen für die Wiederherstellung einer Industriegesellschaft nach einem Ereignis eine Schlüsselfunktion haben, ist der kurzfristige Ersatz ausgefallener Brücken eine dringliche Aufgabe des Bauwesens. Bei grossen Bauwerken wird dies zweifellos nicht einfach und vor allem nicht schnell möglich sein; bei kleineren Brücken ist die Wiederherstellung einer zumindest behelfsmässigen Verkehrsverbindung unter günstigen Umständen jedoch bereits nach wenigen Stunden möglich. Eine Eisenbahnbrücke ist meist anspruchsvoller und zeitaufwendiger zu ersetzen als eine Strassenbrücke, wo eine befahrbare Piste als Umgehung fürs Erste ausreichen kann.
Brücken für Baustellen
Eisenbahntrassees können in der Regel nicht so einfach und kurzfristig verlegt werden wie Strassen; so muss die Ersatzbrücke etwa am gleichen Ort stehen und ähnliche Dimensionen aufweisen wie das ursprüngliche Bauwerk. Für Brücken gibt es keine abrufbereiten Reservebrücken – der Ersatz einer zerstörten Eisenbahnbrücke ist eine Einzelanfertigung, die sich nur mit beträchtlichem Zeitaufwand realisieren lässt.
Für den schnellen Ersatz von Eisenbahnbrücken mit kleinen Spannweiten können hingegen die von den Schweizer Bahnbetreibern bei Baustellen verwendeten Hilfsbrücken unter einfachen topografischen Bedingungen eine kurzfristig verfügbare Lösung sein. Was sich bei Dutzenden von Baustellen bewährt hat (Abb. 2), könnte mit etwas Improvisation auch nach Katastrophen nützlich sein (Abb. 1). Und vor allem sind einsatzbereite Hilfsbrücken in ausreichender Anzahl gelagert (Abb. 5) und könnten praktisch über Nacht installiert werden (Abb. 7). Hier werden diese unentbehrlichen, aber kaum beachteten Baustelleninstallationen für einmal genauer betrachtet, da sie im Ereignisfall eine zentrale Rolle spielen können.
Vormontiert und am Stück transportiert
Der Brückenüberbau von Eisenbahnhilfsbrücken besteht üblicherweise aus vier einfeldrigen vollwandigen Längsträgern, von denen je zwei durch Querträger zu einem Zwillingsträger verbunden sind (Abb. 3, 5 und 8). Der Abstand der Querträger, die mittels HV-Stirnplatten- stössen mit den Längsträgern verschraubt sind und als Schienenauflager dienen, beträgt 60cm, was dem normalen Schwellenabstand auf der freien Strecke entspricht. Einige dieser Querträger können zur Stabilisierung der Zwillingsträger mit verstärkten HV-Stirnplattenstössen ausgebildet werden. Die beiden Zwillingsträger werden mittels Quersteifen, welche im Abstand von 1.8–2.4 m angeordnet sind, zur Gesamthilfsbrücke verbunden. Statisch wirkt eine Eisenbahnhilfsbrücke als Trägerrost mit biegeweich bis biegesteif angeschlossenen Querträgern. Bei einem Einsatz in der Kurve wird zwischen den beiden Zwillingsträgern zusätzlich ein Horizontalverband eingebaut. Der Spannweitenbereich von Eisenbahnhilfsbrücken reicht von ca. 6 bis 23 m. Eisenbahnhilfsbrücken werden, wenn immer möglich, ungeteilt und fertig montiert zur Einsatz- oder Baustelle geliefert. Je nach Baustelle sind eine oder mehrere Hilfsbrücken notwendig, die sowohl neben wie auch hintereinander (als Hilfsbrückenkette) angeordnet werden können (Abb. 1 und 2).
Einsatz von Hilfsbrücken
Eisenbahnhilfsbrücken sind sicherheitsrelevante Ingenieurbauwerke, die bezüglich Sicherheit des Bahnbetriebs den gleichen Kriterien genügen wie normale Bahnbrücken. Im Grundsatz ist auch unter Last ein möglichst kontinuierliches, der vorgesehenen Überfahrgeschwindigkeit entsprechendes Längenprofil des Gleises zu gewährleisten. Aufgrund der minimierten Bauhöhen weisen Eisenbahnhilfsbrücken gegenüber permanenten Eisenbahnbrückenbauwerken eine geringere Steifigkeit auf. Im Vergleich zu permanenten Brückenbauwerken werden grössere zulässige Verformungen von Brückenträger und Fundation und somit ein etwas geringerer Fahrkomfort akzeptiert.
Die maximal zulässige Überfahrgeschwindigkeit von Hilfsbrücken für Normalspurbahnen beträgt je nach Konstruktionstyp und Anordnung zwischen 50km/h und 100km/h. Für den Einsatz bei Meterspurbahnen gilt eine maximale Überfahrgeschwindigkeit von 60km/h.
Widerlager rasch erstellt
Bei gutem Baugrund kann die Hilfsbrücke mittels Holzschwellenfundament oder Betonfertigelement auf gewachsenem Baugrund flach gegründet werden. Das Flachfundament ist auf einer 2 bis 5cm dicken Schicht aus einem Sand-Zement-Gemisch (trockener Mörtel) oder Splitt aufzulegen. Quer zur Brückenachse wirkende Horizontalkräfte aus der Brücke werden über Anschlagwinkel in das Fundament eingeleitet. Die Mindestspannweite der Hilfsbrücke kann meist mit einer Böschungsneigung von 2:3 ermittelt werden. Im Geschwindigkeitsbereich bis 60km/h kann die Hilfsbrücke auf einem Holzschwellenfundament aufgelagert werden. Dieses sehr einfach und kurzfristig erstellbare Bauteil besteht aus einem Schwellenrost mit zwei ca. 3.0 m langen Querschwellen und mehreren ca. 2.5 m langen Längsschwellen. Bei Geschwindigkeiten über 60km/h werden anstelle der Holzschwellenfundamente vorgefertigte Betonfundamentplatten von 2.5 m in Längsrichtung der Schienen mal 3.0 m in Querrichtung verwendet (Abb. 6). Die Fundamentdicken liegen zwischen 0.35 m und 0.50 m. Bei schlechten Baugrundverhältnissen und im Geschwindigkeitsbereich von 80 bis 100km/h sind Tiefgründungen (Schlitz- oder Pfahlfundamente) erforderlich. Auch rasch erstellbare Baugrubenabschlüsse wie Pfahl-, Rühl- oder Spundwände können für die Auflagerung von Hilfsbrücken verwendet werden. Die Fundamenttiefe von Schlitzfundamenten ist auf ungefähr 2.0 bis 3.0 m (bzw. 3.0 bis 4.0 m ab Schienenunterkante) zu begrenzen. Bei hohen Anforderungen an das Setzungsverhalten der Gründungsbauwerke sind Pfahlfundationen (Bohrpfahl- oder Mikropfahlfundation) auszuführen. Der Auflagerriegel für die Hilfsbrücke kann als Beton- oder Stahlträger ausgeführt werden. Wird die Hilfsbrücke auf Stahlspundwände abgestützt, wird als Hilfsbrückenauflager in der Regel ein Walzträgerprofil mit verkeilter Holzschwelle (Brückenlager) aufgeschweisst.
Stützen aus dem Baukasten
Bei Hilfsbrückenketten werden die Zwischenauflager der Brücke in der Regel auf normierten Stahljochen ausgeführt. Diese Stahljoche sind räumliche Fachwerkstützen mit zum Teil biegesteifen Rahmenriegeln im oberen Jochbereich und mit typischen Stützenabständen von 150cm in Querrichtung und 95cm in Längsrichtung (Abb. 4). Für die Berechnung der Joche, der Verankerungen und der Fundamente ist die Einwirkung «Anfahren und Bremsen» zu berücksichtigen. Für die Aufnahme grosser Zentrifugalkräfte sind eventuell zusätzliche Verstrebungen notwendig. Stahljoche werden stets auf Ortbetonfundamenten verankert. In schlechtem Baugrund sind, analog zu den Widerlagern, allenfalls Pfahlfundationen für die Joche erforderlich. Beidseitig der Brücken sind Dienststege mit Holzbelag und Suvakonformen Geländern eingebaut. Alle tragenden Verbindungen der Hilfsbrücken und der Stahljoche sind mit voll vorgespannten, hochfesten Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 ausgeführt.
Literatur:
Teile dieses Beitrags beruhen auf Auszügen aus dem Regelwerk RTE 21590 «Hilfsbrücken für Eisenbahnen», herausgegeben vom Verband öffentlicher Verkehr, Technik Bahn. Zu beziehen bei VSS Zürich, www.vss.ch Vgl. auch: Strasse und Verkehr 6/2006.TEC21, Fr., 2012.02.17
17. Februar 2012 Max Bosshard, Helmut Heimann, Aldo Rota