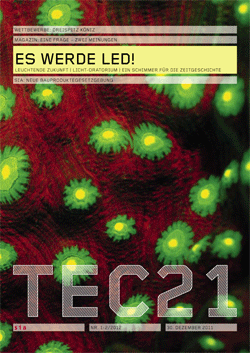Editorial
Die in diesem Lichtheft genauer betrachtete Thematik der LED (Licht emittierende Dioden) und der OLED (organische LED) hat sowohl eine soziale und gesundheitliche Tragweite als auch gestalterische und technische Aspekte. Denkt man an Weihnachts- und Prestigebeleuchtungen, so kommen auch Emotionen hinzu. Das hat zur Folge, dass Herstellerfirmen ihre Labors für die Zusammenarbeit mit Designern und ArchitektInnen öffnen. Sie sind auf Aufsehen erregende Produkte und Beleuchtungsprojekte angewiesen, so zum Beispiel die Neubeleuchtung der Pyramiden des Louvre, bei der die ineffizienten Halogenlampen durch tausende von LED ersetzt wurden.
Nach der Grundlagenforschung, die meist von staatlichen Forschungsanstalten betrieben wird, haben bei der Weiterentwicklung der Produkte – sowohl was die etablierte LED-Technologie als auch die weniger weit entwickelte OLED-Forschung betrifft – grosse Unternehmen wie Toshiba, Philips und Osram die Nase vorne. Noch steckt die OLED-Forschung, die geradezu revolutionäre Änderungen verspricht, in den Kinderschuhen, und die Technologie ist teuer. Verschiedene Probleme müssen gelöst werden (z.B. Oxidation, Beständigkeit gegenüber Sonnenlicht), aber Mittel und Wille dazu sind vorhanden.
Wenn bei der Produkteentwicklung auch gesellschaftliche und nicht nur kommerzielle Aspekte berücksichtigt werden, dann können alle Beteiligten profitieren – doch der Grat ist schmal. Es geht um einen beachtlichen Zukunftsmarkt: weg von der Glühbirne, hin zu Energie sparenden, selbstleuchtenden, organisch geformten Raumoberflächen und zu dynamischer Beleuchtung, die im Extremfall über die Steuerung der spektralen Zusammensetzung des Lichts in den Stoffwechsel von Menschen eingreift. Technisch ist das kein Problem – nur sollten vor deren Anwendung gesetzliche Bestimmungen und Langzeitergebnisse zu Auswirkungen auf die Gesundheit vorliegen.
ExpertInnen aus der Lichtforschung sprechen sich durchwegs für eine solide Produkte- und Projektentwicklung aus. Denn nur das führt zu gutem Licht, was zuallererst einen sozialen Zweck (z.B. gesundheitliche oder sicherheitstechnische Aspekte) erfüllt und erst in zweiter Linie Prestigewert für Prunkbauten hat. Zwei gegensätzliche Beispiele des Bonner Lichtplanungsbüros Licht Kunst Licht, die wir in diesem Heft vorstellen – das 21 m hohe, luftige Kirchenschiff der Dortmunder Liebfrauenkirche («Licht-Oratorium») und ein kleines Museum in Zürich («Ein Schimmer für die Zeitgeschichte») –, lassen erahnen, welches Spektrum an Möglichkeiten LED eröffnen. Der Artikel «Leuchtende Zukunft» schliesslich zeichnet Rahmenbedingungen auf und gibt Hinweise auf mögliches Potenzial, aber auch auf Gefahren der neuen Technologien.
Danielle Fischer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Dreispitz Köniz
10 PERSÖNLICH
Eine Frage – zwei Meinungen
12 MAGAZIN
LED-Beleuchtung im Tunnel Lungern
16 LEUCHTENDE ZUKUNFT
Ralf Michel
Entwicklungen im LED- und im OLED-Bereich werfen gestalterische und gesellschaftliche Fragen auf, die über die Technik hinausgehen.
19 LICHT-ORATORIUM
Klaus Englert
Im Rahmen der Umgestaltung der Dortmunder Liebfrauenkirche zu einer Grabeskirche hat Licht Kunst Licht eine der Funktion angemessene, stimmungsvolle Beleuchtung konzipiert.
23 EIN SCHIMMER FÜR DIE ZEITGESCHICHTE
Danielle Fischer
Das Beispiel eines Uhrenmuseums zeigt, wie differenziert LED in der Innenraumbeleuchtung eingesetzt werden können.
28 SIA
Neue Bauproduktegesetzgebung
31 FIRMEN
33 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Leuchtende Zukunft
Die Vor- und Nachteile der LED- und der weitgehend neuen OLED-Technologie sind vielfältig. Dass es aber nicht nur um Beleuchtungsaspekte «einer schönen neuen Welt» geht, sondern auch um soziale, gesundheitliche und ethische Fragen ebenso wie gestalterische Herausforderungen, zeigen die aktuellen Entwicklungen und die damit verbundenen Forschungen.
Die alte Glühbirne habe ausgedient, Halogen- und Fluoreszenzleuchten würden künftig abgeschaltet; die Zukunft gehöre den LED und in zehn Jahren den organischen LED (OLED). Diese gebetsmühlenartig wiederholten Ankündigungen sind Ausdruck einer komplexen Situation, deren Taktgeber die technologischen Entwicklungen sowie das Bemühen um die Implementierung nachhaltiger Systeme und Konzepte sind. Und so sehen sich die Hersteller mit der Herausforderung konfrontiert, neue Produkte und Steuerungssysteme zu entwickeln. Die Übersetzung in den Gebrauch müssen Designer, ArchitektInnen und Lichtplaner leisten. Designern mangelt es jedoch an Erfahrungswerten, und den Bauherren fehlt zuweilen die Sicherheit, ob und wie sich ihre teuren Investitionen auf längere Sicht lohnen.
Die Vorteile der LED
Wirft man einen Blick auf die markanten Charaktereigenschaften der LED, so lassen sich die Herausforderungen für Designer, Innenarchitekten und Lichtplaner davon ableiten:
– LED ermöglichen im Weiss- und im RGB-Bereich fast jede spektrale Zusammensetzung des Lichts – im Idealfall mit einer Leuchte. Innenarchitekten müssen lernen, diese Möglichkeiten kalkuliert einzusetzen. Zu den Wechselwirkungen zwischen dynamischem Licht und farbigen Oberflächen existieren Erfahrungswerte, aber keine systematische Methode, wie sie von den Farb- Licht- Forschern um Ulrich Bachmann (LED-ColourLab) [2] gefordert wurde.
– LED verursachen fast keine Hitze im Lichtkegel, müssen aber nach hinten gekühlt werden. Die Designer sind daher gefordert, sich umzustellen und die Fragen nach dem Körper-haften des Lichts neu zu beantworten. Insbesondere mit den sich abzeichnenden Entwicklungen der flächigen OLED erleben die Industriedesigner einen Paradigmenwechsel bezüglich der Gestaltung. Die Integration des Lichts in Möbel und Architektur ist künftig einer der Hauptfaktoren, welche die Gestaltung bestimmen.
– Die Steuerung erfolgt elektronisch für jede LED. Der Komplexität dieser Möglichkeit wohnen viele Herausforderungen an die Gestaltung inne.
– Die ökonomischen und die gestalterischen Vorteile liegen auf der Hand: grosse Farbsättigung und Farbdynamik bei kleiner Lichtquelle; hohe Lebensdauer (bis zu 50 000 h), hohe Energieeffizienz, UV-freies Licht, kaum Wärmeabstrahlung im Lichtkegel, dabei dimmbar und ohne Anlaufverhalten.
Interessengruppen und Gebäudebeleuchtung
Die Hamburger Lichtdesignerin Ulrike Brandi meint, Beleuchtung habe nicht den kommerziellen Charakter eines Gebäudes zu verstärken, sondern sei in erster Linie eine soziale Aufgabe. Diese sieht sie darin, dass die Menschen sich in den Räumen wohlfühlen sollen. Damit wäre der Massstab für das Design ausgesprochen. Klaus Krippendorff, Designer, Kommunikationswissenschaftler, Kybernetiker und Professor an der «Annenberg School for Communication in Philadelphia», bringt den Anspruch auf den Punkt, indem er nicht die Gestaltung der Form, sondern die Integration der Bedürfnisse von Interessengruppen als Merkmal beschreibt – das sind jene Menschen, die Architektur als Wohn-, Arbeits- oder Verkaufsraum nutzen. Weitere Gruppen sind die Bauherren, die Hersteller von Leuchten, die Designerinnen und die Innenarchitekten. Eine Auswahl der Forschungsthemen mag die immer noch existierenden Unsicherheiten skizzieren, die es im Bereich LED gibt:
– Welche Auswirkungen haben die relativ hohen Anteile des blauen Lichts auf Kinderaugen?
– Wie wirkt sich der Blaulichtanteil auf Ausstellungsexponate aus?
– Wie wirken sich dynamische spektrale Zusammensetzungen auf die Aufmerksamkeit aus?
– Wie wirken sich dynamische Raumlichtbedingungen auf die Befindlichkeit von Arbeitern und Arbeiterinnen aus, und wird die nächtliche Schlafqualität beeinflusst?
– Wie kann das Zusammenspiel von Tageslichtnutzung und intelligenter Steuerung den Energieverbrauch reduzieren?
Das technisch Mögliche und die Absatzmärkte
An dieser Stelle ist es sinnvoll, die Eckdaten von Leuchtenherstellern zu betrachten, um eine Ahnung davon zu bekommen, wie sich der Markt jenseits modischer Trends entwickelt. Im jüngsten Nachhaltigkeitsbericht der Zumtobel-Gruppe wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung hin zum Einsatz von LED-Technologie und von intelligent gesteuerten Beleuchtungsanlagen gehen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies für die Beleuchtungsindustrie die wichtigen Wachstumsimpulse der kommenden Jahre bringt. So soll bis 2014/15 ein Drittel des Umsatzes aus LED-Produkten erzielt werden, während er im ablaufenden Geschäftsjahr erst bei 8.2 % lag. Deshalb werden die Gelder für Forschung und Entwicklung zum grossen Teil für LED und OLED eingesetzt. Bei anderen Herstellern sehen die Prognosen vergleichbar aus. Die neue Aussenbeleuchtung des Louvres in Paris, welche die Eingangspyramiden und die Fassade des Pavillon Colbert mit 3200 LED erhellt, ist kein Zufall: Der Elektronikkonzern Toshiba will, nachdem er bereits 2010 mit ersten LEDProdukten Fuss gefasst hat, endgültig mit der Technologie nach Europa expandieren.
Zukunftspotenzial Oled
Die OLED – Organic Light Emitting Diode – ist eine sehr dünnfilmige organische Leuchtdiode oder anders ausgedrückt, eine selbstemittierende Fläche. Das Licht wird mittels organischer Schichten erzeugt, die durch einen elektrischen Strom zum Leuchten angeregt werden. Dieser Effekt wird Elektrophosphoreszenz genannt. Die organischen Schichten bestehen aus kurzkettigen – bei den OLED – oder langkettigen Polymeren bei den PLED. Die OLED erzeugt bei geringem Stromverbrauch eine hohe Leuchtdichte. Wegen ihrer organischen Eigenschaft lässt sich die OLED künftig günstiger produzieren als LED. Die OLED-Technologie wurde für Bildschirme, Fernseher, Monitore, Displays etc. genutzt. In einem Interview für das Deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung sagt Dietrich Bertram von OLED Development bei Philips, dass sich Wohnen in der Zukunft insofern verändern werde, als dass Leuchten durch OLED ersetzt werden, die an Decke und Wänden aufgeklebt werden und dem Raum Tiefe verleihen. In 10 bis 15 Jahren werde es im Hochpreissegment Fernseher geben, die man in der Tapete integrieren kann und leuchtende Rollos oder Vorhänge. Von der Technologie werden weitreichende Auswirkungen auf die Gestaltung von Räumen erwartet. OLED ist flächig, blendfrei und diffus und lässt sich nicht auf einen leuchtenden Punkt wie bei der LED zurückführen. Bis dies zum Standard gehört, werden noch etliche Jahre vergehen, und ob OLED-Tapeten und -Fenster die Stubenleuchte aus dem Innenraum verdrängen oder nur neue Möglichkeiten eröffnen, wird sich zeigen. Auch wird ein Forschungsziel die Preissenkung der Produkte sein, um sie für die Allgemeinheit erschwinglich zu machen.
Vom Punkt zur Fläche
Heiko Bartels, Professor für Produktdesign an der Bauhaus-Universität in Weimar, führte im Frühling dieses Jahres einen Workshop[3] mit Studierenden im Lumiblade Creative Lab von Philips in Aachen4 durch. Firmen sind offenbar auf die Ideen von Innenarchitektinnen und Designern angewiesen, weshalb sie Kreative zu Workshops empfangen. Immerhin treibt die niederländische Firma die technische Entwicklung voran und hat bekannt gegeben, dass sie 40 Mio. Euro in die OLED-Entwicklung investieren wird. Heiko Bartels ahnt, warum die Firmen nach gestalterischen Lösungen suchen: «Die flächig leuchtenden und dünn verarbeiteten organischen LED stellen die bisherige Nutzung des künstlichen Lichts fundamental infrage. » Der Designprofessor kritisiert auch die bis heute weitgehend undifferenzierte Nutzung von Licht. Wenn auch nicht viele Lichtgestalter seiner Position zustimmen mögen, so ist sein nächster Hinweis sicher richtig: «Die selbstleuchtenden Oberflächen werden die Wahrnehmung von Räumen fundamental verändern, und die Leuchten als Objekte werden zunehmend in Möbel und in die Architektur integriert werden.»
Anmerkungen:
[01] www.chronobiology.ch: Das Institut erforscht u.a. Schlafzyklen, Cognitive Performance, Formatierung von Erinnerung, Thermoregulation
[02] Zu den Arbeiten von Ulrich Bachmann und zu der LED-Lichttechnik und ihren Steuerungsmöglichkeiten vgl. TEC21, 10/2011
[03] «Vom Punkt zur Fläche», Bauhaus Weimar: www.uni-weimar.de/summaery/2011/projekte/by_id/93
[04] www.newscenter.philips.com/de_de/standard/news/lighting/20110210_oled_workshops_im_philips_ lumiblade_creative_lab.wpdTEC21, So., 2012.01.01
01. Januar 2012 Ralf Michel