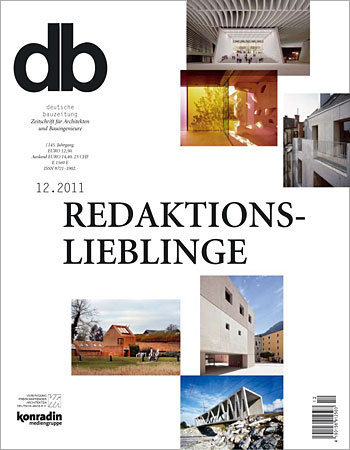Editorial
Martin Höchst schätzt an seinem Lieblingsprojekt am Zürichsee die ruhige Stärke, die es auch dank seiner präzisen Detaillierung ausstrahlt. (S. 32) | mh
Christine Fritzenwallner hat ihren inzwischen vierten Redaktionsliebling seit db 12/2008 diesmal in Form eines Brückentragwerks in Vorarlberg gefunden. Sowohl die Architektur im »Ländle« als auch die der Architekten begeistern sie schon lange. (S. 38) | cf
Nach Seebüll, Föhr und Südtirol entdeckte Ulrike Kunkel ihr diesjähriges Lieblingsprojekt auf einer Rundreise durch China: Ein Opern- und Theaterbau, wie ein Felsmassiv von tief hängenden Wolken umspielt. (S. 18) | uk
Eine innerstädtische Nachverdichtung konnte auch in diesem Jahr Barbara Mäurle begeistern. In der Konstanzer Altstadt hatte sie Gelegenheit, mit dem Architekten sowie mit fast allen Mietern des Wohn- und Geschäftshauses über das Leben zwischen Sichtbetonwänden zu diskutieren. (S. 54) | bm
In ihrem Urlaub in England genoss Dagmar Ruhnau nicht nur die Landschaft, sondern auch den Umgang eines britischen Büros mit Industriedenkmalen. Nach dem Besuch einer alten Mälzerei war sie so angetan, dass sie sich nicht auf nur ein Gebäude konzentrieren mochte. (S. 44 ) | dr
Den Beweis dafür, dass gute Gestaltung keiner teuren Materialien, sondern nur guter Ideen bedarf, musste Achim Geissinger diesmal gar nicht in Slowenien suchen. Er wurde bereits in Tirol fündig. (S. 26) | ge
Umwölkte Felsen
(SUBTITLE) Grand Theater in Qingdao (CN)
Ikonische Kulturbauten sind gemeinhin nicht unbedingt das, was man vom Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner erwartet. Dass das Büro auch diese Spielart der Architektur beherrscht, beweist das Ende 2010 fertiggestellte Grand Theater in der ostchinesischen Millionenstadt Qingdao. Beispielhaft gelang es hier, eine vom genius loci inspirierte Metaphorik in eine markante architektonische Form zu bringen.
Die Umgebung der Stadt Qingdao gehört zu den bekanntesten Landschaften Chinas. Die schnell wachsende Metropole am Gelben Meer, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein deutscher Kolonial-Handelsstützpunkt und Hauptstadt des »Deutschen Schutzgebiets Kiautschou« war, ist ein beliebtes Seebad und der nahe gelegene Berg Laoshan gehört zu den heiligen Bergen Chinas. Seinen mystisch-geheimnisvollen Charakter verdankt er wesentlich einer klimatischen Besonderheit: Wegen der Nähe zum Meer nämlich sind seine Gipfel oft in Wolken gehüllt und genau so ist der Berg durch zahlreiche Abbildungen ins kollektive Gedächtnis des Land eingegangen.
Von dieser auf den Ort bezogenen landschaftlichen Charakteristik ließen sich gmp beim Entwurf des als Grand Theater bezeichneten Gebäudekomplexes leiten. Aus dem Bild umwölkter bzw. von Wolken durchzogener Berggipfel generierten sie eine metaphorisch aufgeladene und zugleich funktional überzeugende architektonische Form, die Identifikationspotenzial bietet und einen hohen Wiedererkennungswert besitzt.
Das aus einem internationalen, 2004 durchgeführten Wettbewerb hervorgegangene Grand Theater von Qingdao umfasst ein Opernhaus, einen Konzert- sowie einen Multifunktionssaal, außerdem ein Medienzentrum und ein Hotel mit Restaurant. Um das umfangreiche Programm zu bewältigen, entschlossen sich die Architekten, den Komplex in vier Baukörper mit jeweils rautenförmigem Grundriss zu gliedern. Zwei annähernd gleich große Volumen nehmen die Oper respektive den Konzert- und Multifunktionssaal auf. Zwei deutlich kleinere Körper beherbergen das Medienzentrum und das Hotel. Zusammengehalten wird der Komplex auf struktureller Ebene durch einen gemeinsamen Sockelbereich sowie durch eine zwischen den Volumen aufgespannte und über sie hinausragende Dachzone. Auf der gestalterischen Ebene dient diesem Zweck ein aus der Region stammender hellgrauer Granitstein, der hier als Fassadenbekleidung und als Bodenbelag im Außenraum sowie in den Foyers Verwendung findet.
Inszenierung des Landschaftlichen
Als Solitär inmitten eines neu geschaffenen Grünzugs gelegen, der sich vom Ufer des Gelben Meers bis zum Fuß des Laoshan erstreckt, thematisiert der Entwurf für das Grand Theater die landschaftlichen Reize der Stadt, die sich aus dem Gegensatz von Meer und Berg ergeben. Dies gelingt v. a. durch die Anlage des 4,5 m hohen Gebäudesockel auf dem gleichsam wie auf einem Hochplateau die einzelnen Baukörper platziert sind. Zwischen den Volumen ergibt sich so ein über breite Freitreppen erschlossener, überaus großzügig dimensionierter »Terrassenraum«. Von dieser als Plaza bezeichneten Plattform aus, die als allgemein zugänglicher öffentlicher Platz konzipiert ist, bietet sich ein architektonisch gerahmter und inszenierter Blick auf die Naturphänomene der Umgebung. Nach Süden hin rückt das Gelbe Meer in den Fokus des Betrachters, nach Norden das Massiv des Laoshan. Der Sockel leistet aber noch weit mehr: Zum einen nimmt er sekundäre Funktionen wie Anlieferung, Umkleiden und Proberäume auf, zum anderen ermöglicht er eine ganz selbstverständlich wirkende Trennung des Publikums- und des internen Verkehrs.
Das markanteste Merkmal des Grand Theater ist freilich sein Dach. Wie eine riesige Pergola überspannt es, stützenfrei und bisweilen enorm weit auskragend, den gesamten Komplex. Abgeleitet vom Bild einer zwischen den Berggipfeln dahinziehenden Wolke, die in eine architektonische Form transferiert wurde, scheint es tatsächlich zwischen den Baukörpern des Komplexes zu schweben. Die rippenartig gegliederte Struktur des nach dem Prinzip eines Flächentragwerks konstruierten Fächerdachs – im Kern ein mit Naturstein ummantelter Stahl-Leichtbau – verschleiert dabei erfolgreich seine wahre Dimension. Immerhin beträgt seine Dicke an der Vorderkante bereits 4 m und wächst an den Stellen, an denen 60 m überspannt werden müssen, auf bis zu 7 m an.
Nichts weniger als eine selbstverliebte konstruktive Spielerei, dient das »Wolkendach« neben seinen ideellen Werten recht handfesten Zwecken: Es beschirmt die darunter liegende Plaza und spendet dabei den v. a. in der Sommerzeit willkommenen luftigen Schatten, durch den die Aufenthaltsqualität der Besucherterrasse sichergestellt wird.
Genau damit leistet es auch einen Beitrag zum Energiekonzept des Komplexes. Klimaschutz ist mittlerweile in China nicht weniger gefragt als im Westen und die entsprechende Bilanz des Neubaus ist schon deshalb günstig, weil die solide gedämmten Fassaden relativ wenige Öffnungen besitzen und der Sonneneintrag entsprechend gering ausfällt. Eine Solarthermie-Anlage auf den Dachflächen der Baukörper tut ein Übriges, um dem ökologischen Anspruch der Bauherrschaft gerecht zu werden.
Gross aber nicht monumental
Die Dimensionen des Grand Theater sind – v. a. aus mitteleuropäischer Perspektive betrachtet – gewaltig. Aber einmal abgesehen von der Tatsache, dass Größe relativ ist und in China eine andere Maßstäblichkeit gilt als hierzulande, gelang es gmp, mit architektonischen Mitteln jeden Eindruck von kalter Monumentalität zu vermeiden. Dazu leistet die sorgfältige, oft fast filigrane Detaillierung des Gebäudes einen wesentlichen Beitrag. Die leicht geneigten Außenwände mit ihrem abgetreppten, horizontal geschichteten Steinkleid, die vielfach abgerundeten Ecken und Kanten der Baukörper, die Feingliedrigkeit des Dachfächers, die fast demonstrative Anti-Monumentalität bestimmter architektonischer Elemente wie etwa der gläsernen Geländerbrüstungen und nicht zuletzt das ausgefeilte Beleuchtungskonzept – im Zusammenspiel nehmen sie dem Gebäude alles vermeintlich Schwere und Bedrohliche. Hinzu kommt, dass die Architekten in den Foyerbereichen und bei der Erschließung der Hauptsäle auf repräsentative, Ehrfurcht heischende Gesten verzichteten. Ganz im Gegensatz zur Großzügigkeit der Plaza sind hier die räumlichen Dimensionen, nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen, in erster Linie von funktionaler Notwendigkeit bestimmt.
Herzstück des »Felsenmassivs«
Die Herzstücke des Komplexes sind die beiden großen Säle für musikalische Darbietungen, das Operntheater und der Konzertsaal. Sie beherrschen jeweils einen der Hauptbaukörper und setzen sich gestalterisch deutlich voneinander ab. Eines ist ihnen freilich gemeinsam: Die Innen- und Außenhüllen der Säle wurden formal in beiden Fällen gleich behandelt. Schon von der Plaza aus ist so dank der großflächig verglasten Foyers die unterschiedliche Materialisierung bzw. Farbstimmung der Säle ersichtlich. Der Opernsaal, bei dessen Bau Betonfertigteile zum Einsatz kamen, ist in dunklem Rot und in Schwarz gehalten. Das folgt klassischen (westlichen) Vorbildern, nimmt Bezug auf den emotionalen und dramatischen Charakter der Oper und weckt zugleich Assoziationen an chinesische Lackarbeiten. Typologisch betraten die Architekten hier kein Neuland. Sie schufen eine traditionelle Guckkastenbühne und einen 1 600 Personen fassenden Zuschauerraum mit zwei hufeisenförmigen Rängen.
Auch der für 1 200 Besucher ausgelegte Konzertsaal entspricht in seiner Struktur der klassischen Typologie derartiger Räume, bei der sich Konzertpodium und Zuschauerbereich gegenüberliegen. Ganz anders als das Operntheater präsentiert sich der Konzertsaal als vergleichsweise nüchterner Holzkörper. Die Inspirationsquelle für seine Ulmenholz-Vertäfelung, die Wärme und Wertigkeit zugleich ausstrahlt, war der Korpus einer Violine. Die Holzpaneele, die das Motiv der horizontalen Schichtung der Außenfassade wieder aufnehmen, prägen aber nur den unteren Bereich des Saals. In seiner oberen Zone erregen ondulierende Gipskartonbekleidungen der Wände die Aufmerksamkeit des Publikums. Effektvoll unterstützt vom Beleuchtungskonzept, verleihen sie dem Saal Dynamik und festliche Eleganz. Ob die Besucher in den gewellten Wänden das ihnen zugrunde liegende Motiv entdecken – das von der Brandung geschaffene Sandrelief am nahe gelegenen Strand, sei dahingestellt.
Versteht sich, dass bei der Gestaltung und Detaillierung der beiden Säle akustischen Belangen höchste Priorität eingeräumt wurde. Die funktionalen Aspekte drängen sich aber nie in den Vorderrund, sondern ordnen sich harmonisch in den Gesamteindruck ein. Das lässt sich beispielhaft an der von gmp eigens für dieses Projekt entwickelten Saalbestuhlung ablesen. Sie dient dem Komfort des Publikums, sorgt für eine ausgewogene Raumakustik und enthält zugleich die geräuschlos funktionierende Belüftung der Säle.
Mit dem Grand Theater in Qingdao ist es dem Büro von Gerkan, Marg und Partner in bemerkenswerterweise gelungen, einen Kulturkomplex zu schaffen, der bei aller Größe und Monumentalität, dennoch den menschlichen Maßstab wahrt.db, Mo., 2011.12.05
05. Dezember 2011 Ulrike Kunkel
Gegenstück, kein Gegenteil
(SUBTITLE) Erweiterung der Hauptschule in Rattenberg (A)
Der prominent im mittelalterlichen Stadtgefüge sitzende Neubau zeigt sich mit seiner Sichtbetonoberfläche dezidiert zeitgenössisch, passt sich durch seine Proportionen und seine sparsame Gliederung aber schlüssig in die Umgebung ein. Zum räumlichen Konzept gehört die geschickte und höchst ökonomische Mehrfachnutzung der Erschließungszone während des Ganztagsbetriebs der Schule. Die Angemessenheit der Mittel ist als Leitbild des Entwurfs direkt erlebbar und lässt trotz aller gestalterischen Disziplin den Spaß nicht außer Acht.
In solchem Umfeld ist zeitgenössisches Bauen ein gestalterisches Wagnis. Die kleinste Stadtgemeinde Österreichs mit etwa 400 Einwohnern besteht im Grunde aus nicht viel mehr als ihrer malerischen Altstadt. Das historische Erscheinungsbild darf nicht gestört werden, denn man lebt vom Tagestourismus, man bietet beschauliche Einkehr, verkauft Schmuck und Kunsthandwerk aus Glas. Aus jeder Ecke weht es den Besucher heimelig an.
Den Endpunkt einer der beiden Straßenachsen bildete bislang ein Gebäude der örtlichen Feuerwehr. Es hielt den Hof des ehemaligen Augustinerklosters besetzt und eignete sich keineswegs als Point de vue. Als es darum ging, die im Klostergebäude untergebrachte Hauptschule zu erweitern, war dieser Bau deshalb schnell drangegeben und aus dem Architektenwettbewerb die im Grunde einzige sinnfällige und letztlich glückliche Lösung herausgesucht.
Tradition ins Heute überführt
Kern der Bauaufgabe war, einerseits Raum für die Schulspeisung, die Nachmittagsbetreuung und zwei Unterrichtseinheiten zu schaffen, und andererseits dafür eine Form zu finden, die sich zwar als zeitgenössische Zutat zu erkennen gibt, gleichzeitig aber nicht zu stark aus dem in sich sehr einheitlichen Stadtbild heraustritt.
Der vom Innsbrucker Architekten Daniel Fügenschuh entworfene, hochrechteckige Baukörper nimmt gut die Hälfte des Schulhofs ein und lässt den historischen Bestand nahezu unangetastet. Trotz der Verengung auf einen schmalen Streifen bleibt genügend Hofraum übrig, der erstaunlicherweise nicht schlauchartig wirkt, dafür aber die Aufmerksamkeit auf den Hauptzugang im Altbau lenkt. Das gesamte EG ist von Nutzung freigehalten und dem Außenraum als überdachter Freibereich zugeschlagen. In seiner Kubatur und Proportion entspricht der Neubau der Körnung der Umgebungsbebauung, typischer Inn-Salzach-Architektur aus simplen Quadern ohne Giebel oder nur mit Andeutungen davon, mit flach geneigten Satteldächern meist ohne Überstand. Wie bei der Nachbarbebauung überwiegt bei dem massigen Baukörper der Wandanteil stark, nur wenige, recht kleine Fenster durchbrechen die fein gegliederten Flächen. Arbeitsfugen teilen sie in einzelne Felder auf, von denen einzelne schalglatt belassen, andere poliert oder maschinell gestockt wurden. Trotz aller gestalterischen Strenge ergibt sich daraus ein lebendiges Fassadenbild. Beide Schalen des Baukörpers wurden in kleinen Fertigungsabschnitten aus Ortbeton hergestellt – ein Verfahren, das den Bauunternehmer sehr gefordert, wenn nicht überfordert hat; einige Kanten sind bereits ausgebrochen.
Das Material rüttelt an den Sehgewohnheiten der Rattenberger Bürger, sind sie doch farbig gefasste Putzflächen und sparsame Ornamentik gewohnt, zumindest was die Schauseiten ihrer Altstadthäuser angeht – dahinter findet sich eine durchaus reichhaltige Palette von Grau. Wer genau hinschaut, entdeckt im Betonzuschlag des Neubaus einen leicht rötlichen Ton. Er stammt vom »Tiroler Rot«, einer Marmorsorte, die im Nachbarort Kramsach abgebaut wird, wiederum einer der vier Gemeinden, aus denen sich die weit über 300 Schüler des Hauptschulverbands rekrutieren.
Der Neubau antwortet somit auf vielschichtige Weise auf die Anforderungen, die das Bundesdenkmalamt in seiner Stellungnahme aufgestellt hatte: Gegenstand des architektonischen Diskurses solle Kontinuität im Sinne eines Weiterbauens sein; gesucht sei ein Gegenstück, kein Gegenteil.
Einfach – überlegt – schön
Die Rückseite des Neubaus verläuft in einigem Abstand parallel zu dem 1973 an das Kloster angebauten Turnhallentrakt und ist mit ihm über einen verglasten Zwischenraum verbunden. Dieser weitet sich im EG zu einem lichtdurchfluteten Foyer für die Turnhalle auf und bietet im Geschoss darüber Raum für die frei auf der Galerieebene stehende Kücheneinheit und reichlich Gelegenheit zum Sitzen, Sehen und Gesehenwerden. Der angrenzende Hallenraum ist von der Galerie nur durch einige Stützen, verglaste Brüstungen und ein Ballfangnetz getrennt. Ihm gegenüber greift die Galerieebene weit in den Neubau hinein, wo Tische zur Mittagsverpflegung Platz finden, die Sanitärbereiche und ein raumhoch verglaster Bereich für die Nachmittagsbetreuung angrenzen. Diese Durchdringung ist funktional sehr zu begrüßen, lässt sie die Erschließungsfläche des OGs doch zu einem räumlich differenzierten, insgesamt aber offenen Kommunikationsraum mit vielerlei Nutzungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten werden. Allerdings schwächen die großflächige Öffnung der Wand und die unterschiedlich tiefen Einschnitte in den Baukörper die Idee des monolithischen Quaders. Das ist leicht zu verschmerzen, denn vor Ort treten in der Wahrnehmung andere Aspekte in den Vordergrund. Der Umgang mit den Details lässt an der Freude teilhaben, mit der das Architektenteam ganz offenbar beim Gestalten zugange war. Es wird mit rahmenloser Verglasung gearbeitet, alle Materialanschlüsse sind bündig und wohlüberlegt, die Achsmaße unterschiedlicher Bauteile aufeinander abgestimmt. Zum großen Teil ist mit wirklich einfachen Mitteln ein hohes Maß an Gestaltqualität erreicht worden. Im Zusammenspiel mit den glatten Betonoberflächen, dem Glas und den goldbraun gestrichenen Stahlelementen von Dach, Brüstungen und Randabschlüssen wirken der Kautschukboden und selbst die als Deckenuntersicht eingesetzten Holzwolle-Leichtbauplatten nicht billig, sondern bilden dazu einen lebendigen Kontrast. Mit simplen Kniffen wurden die Umkleide- und Nassräume veredelt: Die schwarzen Türen üben sich in vornehmer Zurückhaltung, aus der reichhaltigen Palette von Standardfliesen wurden einzelne Töne zu Farbfamilien zusammengestellt und differenzieren nun Vorräume, Duschen und WCs. Einzelne Trennwände bestehen dort, wo sie keine tragenden Funktion haben, aus schwarzsatiniertem Glas. Im OG dagegen, wo sich ein Unterrichtsraum und der Werkraum befinden, herrscht Sichtbeton vor. Dort hat man mit der Schalung gespielt, die Schalbretter leicht geneigt und so ein dreidimensionales Streifenmuster erzeugt, das – passend zu Schulzweig und Unterricht – die Handwerklichkeit des Bauprozesses anschaulich vor Augen führt. Wer die z. T. erstaunlich kleinen Fenster öffnet, muss nicht mit einem ins Zimmer stehenden Flügel rechnen, sondern schiebt diesen innerhalb der Fassadenebene zur Seite in eine eigens dafür freigelassene Aussparung im Beton. Gewaltige Oberlichter lassen Helligkeit hereinströmen und lenken den Blick entweder auf das gaubengeschmückte Klosterdach oder die Türme der Kirche. Die oberste Schicht des Neubaus ist als fünfte Fassade gedacht und mit einem Granitbelag ausgestattet – denn der Aussichtspunkt auf dem Burghügel ist nah und mit einem Fernglas lässt sich jedes Detail leicht erkennen.
Die bestehende Sporthalle nebenan hat nicht nur eine Auffrischung erfahren, sondern wurde auch um einen niedrigen, vollverglasten Vorbau erweitert. Er bietet Raum für Turngeräte und lässt sich über Schiebeelemente zum Gartenhof auf der Rückseite hin öffnen. Helligkeit und Außenbezug kann der Saal gut gebrauchen, denn er wird von verschiedenen Vereinen auch zu festlichen Anlässen und für kulturelle Veranstaltungen genutzt – neuerdings auf einem Boden aus Robinienholz. Außerdem besteht nun die Möglichkeit, die vorhandene, über einen Wärmetauscher geführte, aber zu schwach ausgelegte Lüftungsanlage per natürlicher Querlüftung zu unterstützen – trotzdem wird es sommers im angrenzenden Foyer schnell sehr warm. In der Heizperiode wird die Schule über eine Gastherme versorgt, die auch das örtliche Nahwärmenetz speist.
Ein noch höheres Maß an gestalterischer Aufgeräumtheit wäre sicher möglich gewesen und hätte dem Raum gut getan. Auch in der an sich diszipliniert ausgearbeiteten Straßenansicht des Foyers ist ein wenig zu viel los: Das Bild aus Fallrohren, Sockel, Fassadenriegeln, Treppenpodest und komplexer Innenraumperspektive lässt sich nur schwer beruhigen. Auch hat der Flaschner – ganz der örtlichen Tradition entsprechend – recht geräumige Einlauftöpfe für die Fallrohre gebogen und ihnen ein Sternmotiv eingeprägt. Doch das alles ist kein Beinbruch, denn der klar gestaltete Betonkörper, die Mehrfachbelegung von Verkehrsflächen und v. a. die Angemessenheit der gestalterischen Mittel im Großen wie im Kleinen haben zu einer optimalen Lösung für die Bauaufgabe und den heiklen Standort geführt. Und – darüber freuen sich Architekt und Bürgermeister ganz besonders – das Budget wurde nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten. Das Wagnis ist auf ganzer Linie geglückt.db, Mo., 2011.12.05
05. Dezember 2011 Achim Geissinger
verknüpfte Bauwerke
Erweiterung Hauptschule Rattenberg
Geschützt, nicht geschlossen
(SUBTITLE) Friedhofsgebäude in Erlenbach (CH)
Der Pavillon auf dem kleinen Friedhof, direkt am Zürichsee gelegen, schafft die Gratwanderung, sowohl ganz alltäglichen Anforderungen als auch der sensiblen Situation des Abschiednehmens von Verstorbenen mehr als gerecht zu werden. Trotz Kompaktheit finden Tod und Trauer hier einen fein austarierten und zeitgemäßen Rahmen.
Der ehemalige Winzerort Erlenbach hat sich zur begehrten und sehr teuren Wohnstätte vor den Toren Zürichs gewandelt. 15 S-Bahn-Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, am sonnenverwöhnten Ufer des Zürichsees, eroberten in den letzten Jahren zunehmend Wohngebiete die steil ansteigenden ehemaligen Weinhänge. Das eher dörfliche Zentrum des Orts wird durch die stark befahrene Hauptstraße durchtrennt. Zwischen ihr und dem herrlichen Seeufer liegt neben der reformierten Kirche auch der kleine Friedhof der mittlerweile knapp 6 000 Einwohner zählenden Gemeinde. Das neugotische Gotteshaus markiert den Haupteingang des konfessionslosen Friedhofs und schließt gleichzeitig die gepflegte Anlage nach Norden zwischen Seeufer und Seestraße ab. Mit reichlich Grün bestanden, staffeln sich die Gräberfelder bis zum befestigten Seeufer mit kleinem Bootshafen hinab. Als zurückgenommenes Pendant zur Kirche erstreckt sich seit 2010 ein neuer eingeschossiger Baukörper entlang der Grundstücksgrenze im Süden. Ein Wandsegment des abgerissenen Vorgängerbaus aus den frühen 70er Jahren entlang der Seestraße blieb erhalten und wurde in die vor Verkehrslärm und Blicken schützende Friedhofsmauer integriert. Da das vormalige Aufbahrungs- und Infrastrukturgebäude aus den frühen 70er Jahren stark renovierungsbedürftig war und funktionelle Mängel aufwies, schrieb die Gemeinde 2007 einen begrenzt offenen Wettbewerb mit sechs ausgewählten Zuladungen aus. Zu dem bis dahin zur Verfügung stehenden Raumprogramm – Infrastrukturräumen für Friedhofsbesucher, Gärtner und Bestatter und zwei Aufbahrungsräumen – kam eine weitere Nutzung hinzu: Ein Aufenthaltsraum soll es Trauernden ermöglichen, über längere Zeit in der Nähe ihrer Verstorbenen zu verweilen oder mit anderen Hinterbliebenen zusammen zu sein.
Ordnende Zurückhaltung
Das vorgeschlagene Konzept der Architekten Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler aus Zürich überzeugte die Jury auch durch die Kompaktheit des Baukörpers und dessen sorgsame Setzung auf dem am Wasser gelegenen Friedhof. Ausrichtung und Proportion des 2010 fertiggestellten Gebäudes orientieren sich an der Struktur und Lage des Areals und unterstützten das Vorgefundene ordnend. So ist der Eingang zu den öffentlich frequentierten Räumen, der sich durch eine Nische an der westlichen Längsseite zu erkennen gibt, bereits vom gegenüberliegenden Friedhofs-Haupteingang zu sehen. Zur Seestraße und an der vom Friedhof abgewandten Seite liegen die Anlieferungen der Gärtner- und Bestatterräume, welche in einen Fußweg hinunter zum Seeufer münden. Spaziergänger, aber auch Badende, können so etwas abseits des Friedhofsgeschehens an den See und den kleinen Bootshafen gelangen. Knicke der Außenkante des realisierten langgestreckten Bauvolumens weiten den Blick auf den See oder verengen eine Anlieferung zu einem Weg.
Leichtbeton und farbiges Licht
Trotz gegensätzlicher Materialien strahlt das Gebäude Homogenität und Ruhe aus, was u. a. von der betonten horizontalen Schichtung herrührt. Zwischen dem hangaufwärts eingegrabenen Sockel und einem Flachdach mit ungewöhnlich hoher Attika, beides aus Sichtbeton, schließt ein raumhohes Band aus dunklem Glas die Seiten. An dreien von ihnen folgen unsichtbar gehaltene Scheiben unterschiedlicher Breite und Farbe bündig der parallelen Außenkante von Boden und Decke. An der Schmalseite zum See hin tritt die tragend wirkende Glasfassade knapp 5 m zurück. Deren vermeintlich statische Rolle – den Großteil der Lasten tragen die von außen nicht sichtbaren Innenwände – übernehmen zwei kräftige, ornamental perforierte Betonscheiben, die so einen geschützten Außenraum definieren. Das Zusammenspiel aus verunklärter Lastabtragung und skulpturaler Formensprache verleiht dem Gebäudeäußeren die abstrakte Wirkung eines würdevollen aber doch nahbaren Objekts. Um eine derartige Klarheit zu erzielen, entwickelten die Architekten die minimierten Fassadenanschlüsse des Gebäudes konsequent durch. Dank dieser Arbeit sieht man der Gebäudehülle die unterschiedlichen Anforderungen an Temperierung, Belüftung usw. dahinter nicht an. Auch der Einsatz des Betons ist deutlich differenzierter als der eher raue Eindruck vermuten lässt: Die Attika und Teile des Sockels wurden aus Leichtbeton, die perforierten Wandsegmente aus glasfaserverstärktem Beton gegossen.
Beim Betreten des Gebäudes umfängt den Nutzer, gleich ob Gärtner, Bestatter oder Trauernden, farbiges Licht. Betonoberflächen von tragenden Innenwänden und Böden sind je nach Raum in warme bis kühle Farben getaucht. Auch der Grad der Transparenz des Isolierglases variiert von durchlässig bis opak, und wurde auf das jeweilige Diskretionsbedürfnis der Räume abgestimmt. So ist es den Architekten gelungen, jedem Bereich eine angemessene Stimmung zu verleihen, die von hygienisch rein und abgeschlossen (Bestatter) bis wärmend mit Bezug zum See (Aufenthaltsbereich) reicht. Ungefärbtes zenitales Licht hingegen erhellt die beiden Aufbahrungsräume im Zentrum des Gebäudes. Dass deren Holzbekleidung von Dacheinschnitt über Wände bis hin zum Aufbahrungssockel wie aus einem Guss wirken, ist kein Zufall. »Der ausführende Tischler hat keine Mühe gescheut, einen geeigneten Walnussbaum in der Schweiz zu finden, um sämtliche edel gemaserten Oberflächen aus einem Stamm herstellen zu können«, so die Projektarchitektin Regula Zwicky. Neben dem wärmenden Charakter des Holzes sollen Nischen für persönliche Dinge des Aufgebahrten und Sitzbänke für die Besucher die Aneignung des Raums erleichtern. Bereits im Vorraum zeichnet sich die Besonderheit der Aufbahrungsräume als hölzerner Wandabschnitt mit bündiger Tür zwischen Sichtbeton ab. Die Abwärme aus der Entlüftung der beiden Räume kommt mittels Wärmepumpe der Fußbodenheizung zugute. Im angrenzenden Aufenthaltsraum, der dreiseitig verglast ist, treffen schließlich alle Gestaltungselemente und Materialien aufeinander: eine Wand, die Decke und die Küchenzeile in Holz, der Boden aus geschliffenem Beton, Gläser in warmen Farbtönen mit unterschiedlichen Transparenzen und der Freibereich mit Blick auf den See gerahmt von den expressiven Wandscheiben – geradezu opulent im Vergleich zu den anderen monofunktionalen Bereichen. Die Bandbreite der Gestaltungsmittel, so scheint es jedoch, steht stellvertretend für die komplexen Anforderungen an den Raum: Beim Auf- und Innehalten der Trauernden treffen unterschiedliche Bedürfnisse nach Ruhe, Schutz oder Geborgenheit aber auch nach Austausch und Neuorientierung aufeinander. Es scheint gelungen: Die Qualitäten des Gebäudes würden von den Nutzern nach anfänglicher Skepsis angenommen und geschätzt, so eine Friedhofsgärtnerin vor Ort. Mittlerweile halten immer wieder Erlenbacher ihre Trauerfeiern im kleinen Kreis auf der Terrasse des Pavillons am See ab, statt sich in den beiden großen Kirchen vor Ort etwas verlassen vorzukommen.
Nach Jahrzehnten des Vermeidens und Ausblendens entwickelt sich zunehmend ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Tod und Trauer in der Gesellschaft. Dieser Vervollständigung des Lebens gilt es konfessionsübergreifend gültige, sinnliche und ästhetisch angemessene Räume zu bieten. In Erlenbach auf dem Friedhof am See wurde das wegweisend umgesetztdb, Mo., 2011.12.05
05. Dezember 2011 Martin Höchst