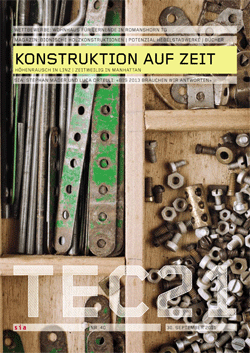Editorial
TEC21 stellt in dieser Ausgabe Bauwerke mit befristeter Nutzungsdauer vor: einen Rundgang aus Holzstegen und -brücken über die Linzer Dachlandschaft («Höhenrausch in Linz») und einen Pavillon aus carbonfaserver-stärktem Kunststoff (CFK) in einer Baulücke in New York («Zeitweilig in Manhattan»). Sie stillen nicht etwa als Übergangsobjekte einen akuten Bedarf, zum Beispiel an Wohnraum oder Arbeitsplätzen, und sie sind keine Platzhalter für spätere, solider ausgeführte Versionen, wie es bei temporären Bauwerken oft der Fall ist. Sie sind vielmehr zwei auffällige, auf Zeit gebaute Konstruktionen, die den öffentlichen Raum besetzend Menschen anlo-cken sollen und nach einer definierten Zeitspanne wieder rückgebaut werden.
Die Holzkonstruktionen im österreichischen Linz sind eine auf anderthalb Jahre ausgelegte Intervention, die die Masse ansprechen und sie auf Kunst aufmerksam machen soll. Der Informationspavillon wiederum ist eine mobi-le Installation, die jeweils während weniger Wochen in urbanen Zentren – nebenbei: den momentan potenziell grössten Absatzmärkten des beteiligten Automobilkonzerns – die Masse anziehen und dazu anregen soll, sich über Nachhaltigkeit zu informieren. Beide Bauwerke sind aber nicht nur Marketinginstrumente, sondern auch technisch sehr interessant: einerseits, weil sie wegen ihrer befristeten Nutzungsdauer mehr Freiheit in der kon-struktiven Ausführung zulassen als permanente Bauwerke. Andererseits, weil ein Material neu in einem Bereich der Bauindustrie eingesetzt und damit experimentiert wird, was der Forschung und Weiterentwicklung dient.
Weitere, in der Rubrik «Magazin» präsentierte temporäre Bauten stellen Prototypen dar für digital entworfene Holzkonstruktionen. Die Studierenden aus Zürich entwickeln aus kurzen Stäben («Holzbau: Potenzial Hebelstab-werke») und diejenigen aus Stutt-gart aus dünnen Holzplatten («Bionische Holzkonstruktion») Tragwerke mit möglichst grosser Spannweite.
Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Wohnhaus für Lernende in Romanshorn TG
10 MAGAZIN
Bionische Holzkonstruktion | Holzbau: Potenzial Hebelstabwerke | Heute hier, morgen fort
16 HÖHENRAUSCH IN LINZ
Clementine van Rooden
Die Ingenieure von Conzett Bronzini Gartmann haben in Linz zwei Holzbrücken gebaut, die einen Rundgang über die Dächer der Innenstadt erschliessen und für anderthalb Jahre ungewohnte Blicke eröffnen.
21 ZEITWEILIG IN MANHATTAN
Martin Joos, Josef Kurath, Rebecca von Büren, Alvine Wiedstruck
Der Pavillon in Manhattan ist eine Begeg-nungsstätte für Diskussionen und Veranstaltungen. Dabei steht das temporäre Bauwerk genauso für interdisziplinäre Teams, die neue Technologien diskutieren und Lösungen für Anwendungen entwickeln.
28 SIA
Stephan Mäder und Luca Ortelli: «Bis 2013 brauchen wir Antworten»
32 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Höhenrausch in Linz
Ein Holzsteg führt über die Dächer von Linz in Österreich und eröffnet ungewohnte Blicke auf die Stadt. Kürzlich erweiterten die Ingenieure von Conzett Bronzini Gartmann den Rundgang mit zwei Holzbrücken. Roh belassen und in ihrer Erscheinung an traditionelle Lehrgerüste erinnernd, zeigt sich die Holzkonstruktion als das, was sie ist: ein temporäres Bauwerk.
Das japanische Architekturbüro Atelier Bow-Wow entwarf die Erschliessung der Dachlandschaft für die Kulturhauptstadt Linz 2009 (Abb. 1). Das Offene Kulturhaus des Landes Oberösterreich wollte damit unzugängliche Stadträume öffnen, sie mit Kunst bestücken und ungewöhnliche Blicke auf den Standort freigeben. Das Projekt war so erfolgreich, dass der verästelte Gehweg nun unter dem Namen «Höhenrausch.2» erweitert wurde: Zusätzliche Holzstege über die Dächer der Innenstadt und zwei spektakuläre Holzbrücken über einen tiefen Innenhof erschliessen einen neuen Rundgang. Die von den Ingenieuren von Conzett Bronzini Gartmann entwickelten Brückenkonstruktionen, die seit Mai 2011 begehbar sind, schliessen dabei nahtlos an das modulare Stegsystem des Ateliers Bow-Wow an.
Das Umfeld bestimmt das Konzept
Von weitem sichtbar klammern sich die beiden Holzbrücken an einen der beiden Türme der barocken Ursulinenkirche in der Innenstadt. Sie wurden in nur einer Woche aufgebaut. Die erste Brücke verbindet das Dach des Einkaufzentrums Passage mit dem Kirchturm (Abb. 1), die zweite Brücke führt wieder zurück aufs Dach des Warenhauses. Auf dieser Brücke öffnet sich der Blick in die Landstrasse, die Linzer Einkaufsmeile (Abb. 2).
So leichtfüssig sich die Konstruktionen in dieser urbanen Umgebung zeigen, so schwierig war es, sie in das komplexe Umfeld einzufügen. Ursprünglich dachte die Bauherrschaft an Hängebrücken, doch die Ingenieure wollten das Tragwerk an die Bedingungen vor Ort anpassen. Diese ergaben sich aus der engmaschigen Anordnung der umliegenden Bauwerke, der Substanz der bestehenden Gebäude und des Kirchgemäuers sowie den Anliegen der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner. Diese Einschränkungen waren so präzise vorgegeben, dass sich das Tragwerk aus ihnen heraus definierte – eine andere Lösung wäre gemäss den Ingenieuren nicht möglich gewesen. Vor allem die Lagerung der Brücken bestimmte das Tragwerkskonzept: Die Konstruktion im Bestand abzustützen und zu verankern, war geometrisch anspruchsvoll. Die Vermessungsarbeiten vor Ort schufen wichtige Grundlagen, sodass Neues nur wenige Zentimeter von Altem getrennt aufgerichtet werden konnte. Die Lagerungs- und Verankerungsanschlüsse sollten zudem reversibel angefertigt werden. Nach dem Rückbau in anderthalb Jahren wird nichts mehr sichtbar sein.
Spreng- und Stützwerk betten sich in die Dachlandschaft
Eine Brücke wurde als Stützwerk, die andere als Sprengwerk ausgebildet. Auf diese Weise konnten die wenigen Lagerungsmöglichkeiten genutzt werden und die vielen Stellen, wo eine Lastabtragung unmöglich oder zumindest fraglich war, unberührt bleiben. So ist das Stützwerk vom Dach des Einkaufszentrums zur Ursulinenkirche ein etwa 25 m hoher Pfeiler, von dem aus der Gehweg auf zwei Seiten auskragt. Die Brückenenden drücken praktisch nicht auf das Kaufhaus bzw. auf die Kirche – so wird die bestehende Bausubstanz von ungewünschten Zugkräften verschont und dennoch als Halterung gegen horizontale Kräfte wie zum Beispiel Windeinwirkungen genutzt.
Tragkonstruktion des Stützwerks
Der Gehweg des Stützwerks ruht auf einem 8° längs geneigten, 22.4 m weit gespannten, in regelmässigen Abständen aufgeständerten Brettschichtholzträger, der mit einem Längsträger aus Vollholz schubfest verbunden ist (Abb. 6 und 8). Dieser Brückenträger dient der seitlichen Stabilisierung und ist auf der Seite des Kirchturms horizontal und vertikal über eine Plattformkonstruktion gelagert – eine Übergangskonstruktion, die die Auflagerkräfte aus den beiden Brücken und dem aus dem Glockenturm auskragenden Balkon gleichmässig in die Kirchturmmauern einleitet (Abb. 5). Auf der Seite des Einkaufszentrums ist der Brückenträger auf Stahlschuhen gelagert, die die Horizontallasten quer zur Brücke in die bestehende Decke einleiten, sie aber vertikal praktisch nicht belasten. Der Brückenpfeiler ist als Fächertragwerk ausgebildet und besteht aus zwei Teilen: Fächerung und Stützturm. Die Fächerung aus Streben und Andreaskreuzdiagonalen fängt den geneigten Brückenträger auf und hält die Geländerpfosten. Der Stützenturm besteht aus vier Fachwerkebenen. In Querrichtung setzt er sich aus zwei Böcken (räumliche Fachwerke) mit 24 m durchschnittlicher Höhe und 4 m Breite zusammen; in Brückenlängsrichtung ist er aus zwei 24 m hohen und 4 m breiten Fachwerken zusammengestellt. Der Turm lagert auf vier Stahlschuhen, die in vorfabrizierten, seitlich im Boden gehaltenen Betonsockeln verankert sind (Abb. 9). Das Gewicht der Betonsockel gewährleistet eine begrenzte vertikale Einspannung des Turms.
Tragkonstruktion des Sprengwerks
Der Querschnitt des Sprengwerkgehwegs ist der gleiche wie derjenige des Stützwerks (Abb. 8). Die Sprengwerkpfeiler (Abb. 7) bestehen aus in Querrichtung steifen, bis 12 m hohen und 5.4 m breiten Böcken, die mit unterschiedlicher Neigung den Brettschichtholzträger auffangen und die Geländerpfosten halten. Auf der Terrasse des Einkaufszentrums stehen die Böcke auf zwei Stahlschuhen, welche die horizontalen und vertikalen Kräfte in die bestehende Attikadecke einleiten. Ausserdem fängt der Brettschichtholzträger hier die Anschlussbrücke auskragend auf (Abb. 2). Die Böcke auf der Seite des Kirchturms sind speziell gelagert: Die beiden Pfeilerfüsse stehen nicht auf dem Turmgesimse – es ist zu schwach –, sondern hängen an zwei 10.6 m langen Zugstangen (Abb. 4). Diese ziehen die vertikalen Zugkräfte vor dem Auflager bis auf die obere Kante des Kirchturmfensters hinauf und leiten sie dort in die Plattformkonstruktion ein. Die zwei Konsolen aus Brettschichtholz bei den Pfeilerfüssen sorgen dafür, dass das System nicht schaukelt. Sie leiten die horizontalen Druckkräfte über eine Aufstandsfläche von 500 × 500 mm in die Kirchturmwände.
Assoziation zwischen Temporärem Bauwerk und Gerüst
Die Nutzungsdauer von nur anderthalb Jahren war wegweisend für Planung und Ausführung. Die Ingenieure mussten nicht in der gleichen Weise auf die Dauerhaftigkeit achten wie bei einer bleibenden Holzbrücke. Es war kein schützendes Holzdach notwendig, man musste die Bauteile nicht auswechselbar planen oder darauf bedacht sein, dass die Konstruktion jederzeit ohne Hilfskonstruktionen ergänzt werden kann.
Jede Brückenkonstruktion beinhaltet nur einen verleimten Holzträger. Alle anderen Hölzer sind aus Fichten-Vollholz und können somit weiterverwendet werden. Der Einsatz von Vollholz hat gemäss den Ingenieuren zu einer gerüstähnlichen Konstruktion geführt. Sie erinnert an die Lehrgerüste, wie sie Richard Coray[1] Anfang des 20. Jahrhunderts konstruiert hat. Diese waren ebenfalls nur für eine begrenzte Zeit installiert und einfach zu demontieren.
Aus einem anderen Blickwinkel sehen
Die Stege bleiben den Besuchern und Besucherinnen bis Ende 2012 erhalten – gerade dieses Temporäre macht den Reiz des Bauwerks aus. Es erweitert die Wahrnehmung des Standortes, lässt ungewohnte Blicke in alle Himmelsrichtungen zu, rückt Details in die Nähe, die sonst weit weg und unerreichbar sind. Der Glockenturm der Ursulinenkirche, von unten klein, wirkt oben auf der Brücke gross. Die Dachlandschaft zeigt sich plötzlich in ungewohnter Schärfe. Dieser Wechsel von Massstab und Perspektive wirkt unmittelbar auf die Besucherinnen und Besucher. Ihn spürbar zu machen, war die Absicht der Bauherrschaft. Das funktioniert nicht zuletzt auch für die Ingenieurkonstruktion selber. So zeigen der Holzsteg und die beiden Brücken an diesem ungewöhnlichen Ort Details so anschaulich, wie es sonst selten zu sehen ist. Das macht den Rundgang zu einem Lehrpfad für Statik und konstruktive Lösungen.
Anmerkung:
[01] Richard Coray (1869 bis 1946) war ein Schweizer Zimmermann und Gerüstbauer. Seine Lehrgerüste ermöglichten den Bau weit gespannter Brücken aus Beton (vgl. Lehrgerüst der Salginatobelbrücke) und gelten als technische und handwerkliche MeisterwerkeTEC21, Fr., 2011.09.30
30. September 2011 Clementine Hegner-van Rooden
Zeitweilig in Manhattan
In einer Baulücke an der Houston Street in Manhattan steht seit Anfang August 2011 ein Pavillon aus carbonfaserverstärktem Kunststoff. Die Begegnungsstätte, in der Veranstaltungen für die Öffentlichkeit stattfinden, wird Mitte Oktober rückgebaut und in Berlin aufgebaut, bis sie nach Mumbai umzieht. Dieses erste von drei «BMW Guggenheim Labs» wurde vom Architekturbüro Atelier Bow-Wow entworfen, und das Schweizer Unternehmen Nüssli setzte die architektonischen Ideen um. Unterstützung holten sie sich bei den Schweizer Bauingenieuren von Staubli, Kurath und Partner.
Die Solomon-Guggenheim-Stiftung in New York – die Betreiberorganisation der Guggenheim- Museen – schickt in den nächsten sechs Jahren drei mobile Labore um die Welt. Jeder Pavillon ist nacheinander zwei Jahre lang unterwegs und in drei Städten stationiert (vgl. Kasten nebenan). Die temporären und mobilen Bauwerke sollen dabei der Gesellschaft einen Ort bieten, wo sie verschiedene Themen wie das Zusammenleben der Menschen in Städten diskutieren kann. Der erste Zweijahreszyklus findet zum Thema «Confronting Comfort » statt und widmet sich der Erforschung des individuellen und kollektiven Komforts sowie der dringenden Notwendigkeit ökologischer und sozialer Verantwortung.
Aufgeständerter Pavillon vielfältig nutzbar
Für diese Initiative mit dem Namen «BMW Guggenheim Lab» lud die Stiftung im Herbst 2010 die japanischen Architekten des Ateliers Bow-Wow ein, den ersten Pavillon zu entwickeln. Vorgabe des Auftraggebers an die Architekten war, dass der Pavillon eine anpassungsfähige Infrastruktur bietet, in der Workshops, Ausstellungen, Fachvorträge und Quartierfeste durchgeführt werden können. In einem interdisziplinären Team sollen ausserdem neue Technologien für die Bauindustrie diskutiert und Lösungen entwickelt werden.
Da sich der Pavillon am ersten Standort präzise in die schmale Baulücke zwischen alten Häusern einbettet (Abb. 1), entwarfen die Architekten ein Konzept für ein aufgeständertes mobiles Bauwerk, in dem – ähnlich einer Theaterbühne – die Requisiten hochgezogen und heruntergelassen werden können. Modulare Bühnen hängen an Seilen, und Stühle und Tische sind über den Köpfen der Besuchenden untergebracht. Die eingeschränkte Nutzfläche kann so vielfältig genutzt werden.
Tragelemente aus Carbonfaserverstärktem Kunststoff
Das Tragwerk wurde aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) hergestellt. Die Architekten setzten – unterstützt von der Bauherrschaft – bewusst auf dieses Material, das im Bauwesen erst als Verstärkungselement Fuss fasst, sonst aber noch kaum eingesetzt wird. Um die tragwerksspezifischen Aspekte zu analysieren und festlegen zu können, suchten Architekten und Bauherrschaft die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen Nüssli, das Erfahrungen mit temporären und modularen Bauten hat. Unterstützt von den Bauingenieuren von Staubli, Kurath und Partner aus Zürich, legte das Projektteam das statische Konzept fest – abgestimmt auf die Transport-, Montage- und Standortbedingungen.
Die Projektbeteiligten verglichen internationale Gesetzgebungen miteinander, eruierten die massgebenden Lasten und Lastfälle und bestimmten die Lieferanten für die Hauptgewerke, die in der Lage waren, innerhalb von drei Monaten projektspezifische Lösungen zu entwickeln und zu produzieren. In kurzer Zeit brachten sie die Ideen des Architekten mit dem Budget des Auftraggebers und den produktionsbedingten und montagetechnischen Randbedingungen in Einklang.
Tragwerk, Konstruktion und Details
Der Pavillon ist 8 m hoch und hat einen Grundriss von 30 m auf 6 m (Abb. 3). Das Tragwerk aus CFK besteht aus einem Raumfachwerk, das auf sechs Stützen steht (Abb. 4). Die Fachwerkstäbe sind nicht wie üblich nur in Längs-, sondern auch in Querrichtung belastet; um die Montage der Einbauelemente flexibel zu halten, sollten die Kräfte nicht nur über die Fachwerkknoten, sondern auch über die Profillängen eingeleitet werden. Die gekreuzten Verbände bestehen aus vorgespannten Stahlseilen und steifen die Gesamtkonstruktion flächenweise aus (Abb. 4). Die in Querrichtung mit Aufdopplungen biegesteif ausgeführten CFK-Stützen enthalten aus Brandschutzgründen und wegen ihrer Schlag- respektive Anprallempfindlichkeit einen Stahlkern. Das Stahlprofil dient im Brandfall als Rückfallebene, da Carbon zwar bei erhöhten Temperaturen seine Festigkeit behält, die Matrix des CFK aber verkohlt. In Längsrichtung sind die gelenkig gelagerten Stützen mit Stahlseilen zum Boden abgespannt (Abb. 5).
Die CFK-Stäbe wurden in einem modifizierten Wickelverfahren hergestellt. Da die massgebende Tragrichtung auch quer zur Profilachse erfolgt, wurden die Fasern nicht nur längs in 2°-Richtung, sondern zusätzlich im 45°- und 85°-Winkel gewickelt (Abb. 7), womit die Bauingenieure die Profildimensionen optimieren konnten. Es sind Vierkantrohre mit Querschnitten von 200/140/11.6 mm bis 130/130/5.4 mm, an deren Enden Stahlanschlussteile platziert sind. Diese sind mittels Stahlstangen im Innern der CFK-Profile untereinander verspannt (Abb. 6). So können die verschweissten Laschen Zug-, Druck- und Querkräfte aufnehmen. Die gegenseitige Verspannung der Knoten ist eine einfache mechanische Verbindung.
Sie leitet keine zusätzlichen, ungünstigen Kräfte wie Zwängungen und Lochleibung in den CFK-Stab, die das Material an den heiklen Endbereichen zusätzlich belasten und schwächen würden. Der Spalt zwischen CFK-Rohr und Stahlinsert ist mit einem speziellen Kleber verfüllt, der örtliche Spannungsspitzen verhindert. Eine kraftübertragende Klebeverbindung war in diesem Fall nicht möglich, da sie in der Bauindustrie allgemein unüblich ist und es daher schwierig ist, eine Genehmigung dafür zu erhalten. In der gegebenen Zeit war es auch nicht möglich, solche Knoten ausreichend zu testen.
Montage in Manhattan
Nach der Herstellung der Profile in den Werken von Carbofibretec führte das Herstellerunternehmen Ende Mai 2011 einen Probeaufbau in der Halle in Friedrichshafen durch. Er gab dem Projektteam und der Montagecrew die Gewissheit, dass das geplante Montagekonzept tatsächlich umsetzbar ist. Nach einer sorgfältigen Verpackung der CFK-Profile in gepolsterte Transportkisten erfolgte die Verschiffung der fünf Seefrachtcontainer nach New York. Durch- schnittlich sechs Monteure bauten den Pavillon in knapp vier Wochen vor Ort auf. Zuerst wurde am Boden das Obergeschoss zusammen- und das wasserdichte Membrandach aufgesetzt. Danach wurde das 16 t schwere Skelett mit einem Kran angehoben und die Stützen darunter montiert (Abb. 8). Diese Phase war der kritischste Moment im Montageablauf, da aufgrund der engen Platzverhältnisse die Gefahr bestand, dass die auf Schlageinwirkung empfindlichen CFK-Profile ihre Tragwirkung infolge eines Anpralls verlieren könnten.
Das Potenzial ist da
Mit dem Einsatz von CFK in diesem – experimentellen – Bauwerk gewannen die Projektbeteiligten Bauingenieurinnen und Bauingenieure neue Erkenntnisse zum Tragverhalten des Materials, die die Forschung und Weiterentwicklung kanalisieren. Eine Erkenntnis sticht dabei heraus: Quer zur Faser ist CFK noch schwächer als befürchtet (Abb. 10 und Kasten oben). Die Umsetzung dieses Projektes zeigt aber auch, dass sich die Kosten der Carbonfasern stark reduziert haben. Das Potenzial für den Einsatz von CFK im Hochbau steigt damit an. Die Vorteile des Werkstoffes wie sein kleines spezifisches Gewicht, seine geringe Korrosions- und Ermüdungsanfälligkeit sowie seine positiven Eigenschaften bezüglich Nachhaltigkeit können so im Hochbau vermehrt genutzt werden – wenn auch nur für ganz spezifische Fälle, wo sie auch tatsächlich zum Tragen kommen.TEC21, Fr., 2011.09.30
30. September 2011 Martin Joos, Josef Kurath, Rebecca von Büren, Alvine Wiedstruck