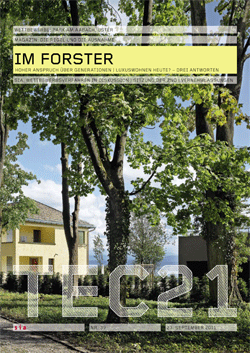Editorial
Als der Zürcher Physiker und Bankierssohn Gustav Adolf Tobler-Blumer 1890 mehrere Grundstücke in Fluntern als Sitz für ein Sommerhaus über der Stadt erwarb, existierten in der Gegend nur einige Bauernhöfe. 40 Jahre später – der Zürichberg hatte sich bereits als Gebiet für gehobenes Wohnen etabliert – liess Gustav Adolfs Tochter Helene hier ein Haus für sich und ihre Familie errichten.
Zeit- und ortstypisch war der Ansatz der Architekten Henauer & Witschi, die die Villa im Landhausstil entwarfen und ausführten: Sie platzierten den Bau so auf dem Grundstück, dass er von aussen kaum sichtbar war. Die einfache Putzfassade und der geschwungene Grundriss liessen die tatsächlich sehr grosszügigen Dimensionen und die extravagante, genau auf die Bedürfnisse der Bauherrschaft abgestimmte Innenausstattung des Baus kaum erahnen – wohlhabend zu sein, genügte, den Wohlstand zeigen brauchte man nicht. Dank der Neigung des Terrains und der Bepflanzung der Grundstücksränder gelang es, die nähere Umgebung des Parks auszublenden. So entstand ein der Stadt scheinbar weit entrückter Ort mit einem spektakulären Weitblick über See und Alpen.
Über 70 Jahre lang blieb die Villa der einzige Wohnbau auf dem sechs Fussballfelder grossen Gelände. 2003 ent-schlossen sich die Eigentümerfamilien, längst nicht mehr in Zürich sesshaft, den Park zu verdichten. Die praktisch originalgetreu erhaltene Villa sollte indes als Zürcher Familiensitz bestehen bleiben und wurde vom Architekturbüro Pfister Schiess Tropeano & Partner in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sorgfältig restauriert («Hoher Anspruch über Generationen»).
Auch die aktuelle Bebauung entspricht dem Zeitgeist. Auf der Basis eines Gestaltungsplans realisierten drei Archi-tekturbüros hier auf drei Baufeldern Projekte, die sich an ebenfalls drei verschiedene Zielgruppen wenden: Luxus-wohnungen im Bau von Richter et Dahl Rocha, Wohnungen für die Nachfamilienphase in den Bauten von Jakob Steib Architekten sowie Studios und Familienwohnungen im Bau von EM2N. Die insgesamt 54 Mietwohnungen bieten ein Kaleidoskop an Grundrissen und teilweise spannende räumliche Lösungen. Sie bezeugen aber auch eine gewisse Ratlosigkeit hinsichtlich der Frage, was luxuriöses Wohnen heute bedeutet. Grosse Räume? Viel Glas?
Die Prioritäten haben sich verschoben. Deutlich wird dies im Vergleich mit der Villa: Einst wurde in der Aussendar-stellung das Understatement gesucht, während das Innere massgeschneidert und elegant daherkam. Jetzt gilt das Gegenteil: Der Innenausbau aller Bauten mit Parkettböden und weissen Wand- und Deckenflächen wirkt aus-tauschbar – dafür sind die Neubauten bereits von weitem im Stadtbild zu erkennen («Luxuswohnen heute? – Drei Antworten»).
Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Park am Aabach, Uster
12 PERSÖNLICH
Gewagtes Tun
14 MAGAZIN
Die Regel und die Ausnahme
18 HOHER ANSPRUCH ÜBER GENERATIONEN
Michael Hanak
Park und Villa Im Forster in Zürich gehören hinsichtlich Dimension und Ausstattung zu einer vergangenen Ära. Pfister Schiess Tropeano & Partner setzten den Bau aus den 1930er-Jahren sorgfältig instand.
24 LUXUSWOHNEN HEUTE? – DREI ANTWORTEN
Martin Tschanz
Von 2008 bis 2011 wurde das Grundstück der Villa Im Forster baulich verdichtet. Drei Architekturbüros realisierten an drei Orten insgesamt 54 Mietwohnungen.
33 SIA
Wettbewerbsverfahren in Diskussion | Baudynamikstipendium | Sitzung der ZNO | Vernehmlassungen | Einfluss der Wärmespeicherfähigkeit | Veranstaltungen
36 MESSE
Die internationale Wohn- und Möbelausstellung «Neue Räume» findet dieses Jahr zum 6. Mal in Zürich Oerlikon statt.
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Hoher Anspruch über Generationen
Der Park der Villa Im Forster bildet mit 45 000 m² Fläche das grösste zusammenhängende Privatgrundstück am Zürichberg, 1890 entstand hier der erste Bau. Die damaligen Bewohner wandten sich, typisch für die Zeit, bewusst von der Stadt ab. Auch die 1929–1931 auf dem Gelände erbaute Villa ist Ausdruck dieses ambivalenten Verhältnisses: Während sich Fassade und Volumetrie des Baus im Landhausstil präsentieren, herrschen im Inneren Grosszügigkeit und urbaner Luxus. Von 2008 bis 2011, im Zuge der teilweisen Verdichtung des Grundstücks, setzte das Zürcher Architekturbüro Pfister Schiess Tropeano & Partner die Villa sorgfältig instand – ein denkmalpflegerischer Glücksfall.
Das Areal befindet sich an bester Aussichtslage am Hang des Zürichbergs und war bis vor kurzem mit nur wenigen Gebäuden bebaut. Im oberen Bereich nahe der Forsterstrasse standen neben der Villa das Garagengebäude beim seitlichen Mittelbergsteig und das Gärtnerhaus an der Ecke zur Zürichbergstrasse (Abb. 2). Diese Nebengebäude sind nun neuen Mehrfamilienhäusern gewichen. In der südöstlichen Ecke des weiten Strassengevierts steht nach wie vor das älteste Haus des Anwesens, das Chalet Tobler. Hier beginnt die Geschichte des Forster-Areals.
Ein Stück Stadtgeschichte
Als das Chalet an der Zürichbergstrasse 117 im Jahr 1891 bezogen wurde, war die Umgebung noch weitgehend unbebaut. Nur wenige Weiler und einzelne Höfe besetzten den Südhang ausserhalb der Stadt. Dank der naturnahen Höhenlage entstanden hier Ende des 19. Jahrhunderts Kurhäuser und Sanatorien. 1893 wurde Fluntern zusammen mit anderen umliegenden Dörfern eingemeindet und die Erschliessung des Zürichbergs vorangetrieben. Der Eigentümer des Grundstücks, Gustav Adolf Tobler-Blumer, entstammte einer Bankiersfamilie, wirkte am Polytechnikum und lebte mit seiner Familie in der Villa Tobler am Rande der Altstadt. Das von einem Wäldchen umgebene Holzhaus am Zürichberg, wo seine Vorfahren ein grosses Stück Land erworben hatten, diente der Familie als Sommer- und Wochenendhaus, abseits der städtischen Hektik. Man erzählt, dass Tobler jeweils vom Bauern, der das Grundstück oberhalb des Chalets bewirtschaftete, mit dem Traktor abgeholt und zu seinem Ferienhaus chauffiert wurde.[1] Als Architekt des Sommerhauses wurde Jacques Gros gewählt, der 1890 in Zürich sein eigenes Büro eröffnet hatte und in der Folge diverse Wohnhäuser am Zürichberg ausführte – sein bekanntestes Werk ist das Grand Hotel Dolder. Mit seinen aus Holz konstruierten oder zumindest mit geschnitzten Holzverzierungen versehenen Bauten entsprach Gros der sehnsüchtigen Idealisierung alpiner Architektur, die sich damals im Schweizer Holzstil niederschlug. Helene Tobler, Gustav Adolfs Tochter, liess 1929 für sich und ihre Familie ein Stück weit neben dem Chalet ein herrschaftliches Wohnhaus errichten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Zürichberg als bevorzugtes Wohngebiet grossbürgerlicher Ansprüche etabliert.
Ein besonderes Haus
Die Villa Im Forster wurde von den Zürcher Architekten Henauer & Witschi geplant und ausgeführt. Das Bauvorhaben war etwas Besonderes: Nicht nur war das Baugelände sehr weitläufig und waren die zur Verfügung gestellten Mittel sehr grosszügig. Die Architekten hatten anscheinend auch weitgehende Freiheiten und konnten aus dem Vollen schöpfen. Grund lage dafür bildete ein gutes Einvernehmen zwischen Bauherrschaft und Architekten, was für Henauer & Witschi «in höchstem Mass verpflichtend sein musste», wie sie selbst festhielten.[2]
Das Raumprogramm beinhaltete die übliche repräsentative Raumfolge von Esszimmer, Salon und Wohnzimmer, die als Enfilade aneinandergereiht sind. Diese Haupträume im Erdgeschoss sind von der Halle aus erreichbar, die sich nach dem Haupteingang erstreckt.
Zusätzlich kam ein kleines Esszimmer vor dem Office und der Küche hinzu. Westlich schliesst nahtlos der Angestelltentrakt an, der einen separaten Eingang und ein eigenes Treppenhaus besitzt. Die nach Süden vorgelagerte Gartenterrasse weitet sich östlich des Hauses zum Bereich mit dem Schwimmbassin, das rückwärtig von einem gedeckten Wandelgang eingefasst wird. Im Obergeschoss sind die Schlafzimmer vor dem hallenartigen Gang nebeneinander gelegt. Fast jedem Schlafraum ist ein eigenes Badezimmer zugeordnet, das die Nachbarzimmer jeweils verbindet. Während sich die einen Zimmer auf die Sonnenterrasse an der Südfront öffnen, ist dem Boudoir am Ende des Ganges eine Loggia vorgelagert. Ein Gästezimmer, das auf der Hofseite im Obergeschoss, und eine Turnhalle, die im Untergeschoss untergebracht ist, ergänzen das generöse Raumangebot.
Ein Hauptmerkmal des Entwurfes bildet der gebogene Grundriss. Dieser ist nicht etwa direkt aus der Topografie abgeleitet, denn der Hang verläuft ziemlich gleichmässig. Vielmehr nutzt das Haus die hervorragende Aussichtslage und vereint mit der Krümmung die Fernblicke zur Stadt und zum See. Hangseitig setzt sich der Schwung des Gebäudes im Wandelgang vor dem Schwimmbassin fort und fasst die Vorfahrt zu einem hofartigen Vorplatz, der mit einem Rondell gestaltet wurde. Bemerkenswert ist, dass die radiale Geometrie in jedem der Haupträume zum Ausdruck kommt und sich in den Parkettmustern niederschlägt. Den Mittelpunkt des Kreisringausschnittes und zugleich das Scharnier zwischen dem gebogenen Haupttrakt und dem geraden Angestelltentrakt bildet das runde Treppenhaus, das neben dem Haupteingang in den Hofbereich vorsteht.
Auffallend ist die Divergenz zwischen äusserem und innerem Eindruck. Von aussen wirkt das Haus unauffällig, beinahe bescheiden. Dazu trägt nicht zuletzt die effektvolle Krümmung der Fassaden bei, die diese optisch verkürzt. Die niedrige, lagernde Ausdehnung in der Art eines Landhauses entbehrt jeglichen pompösen Gebarens. Im Innern entfalten sich allerdings räumliche Grosszügigkeit und materieller Luxus. Nicht nur die Dimensionen, sondern auch die individuelle Ausgestaltung zeichnet die Räume aus. Hier finden sich qualitativ hochwertige Materialien und gekonnte handwerkliche Verarbeitung und Ausführung.
Zurückhaltende Moderne
Stilistisch steht die Villa Im Foster an der Schwelle zur Moderne. In den 1920er-Jahren bestimmten noch neubarocke Palais und neuklassizistische Paläste den privaten Wohnhausbau am Zürichberg. Um 1930 erzielte die Avantgarde des Neuen Bauens mit ihrer Forderungen nach Luft, Licht und Sonne, aber auch nach einer Entledigung von Repräsentation und Bauschmuck einen grundsätzlichen Richtungswechsel. Aufgeschlossene Architekten und Architektinnen entwarfen nun für gutbürgerliche Bauherrschaften Wohnhäuser, deren Sachlichkeit den Verzicht auf Symmetrie und gliedernde Elemente mit einschloss.[3] Als zeitgemäss galten im Villenbau eine von modischem Dekor befreite Einfachheit sowie die Verbindung der Innenräume mit dem Wohngarten.
Beim Wohnhaus Im Forster mischten Henauer & Witschi virtuos traditionelle und moderne Architekturelemente. Die gelb gestrichenen Aussenwände mit grober Putzstruktur und das mit Valmalenco-Granitplatten eingedeckte Satteldach nehmen Bezug auf die nationale Bautradition. Der Grundriss mit der Enfilade und die Aufteilung in Wohn- und Schlafgeschoss folgen dem herkömmlichen Schema im Villenbau. Einen Ausdruck von Modernität erheischen hingegen die dynamischen Rundungen in der Gesamtform, aber auch in der Eingangsnische und an der Terrassenkante. Zum Vokabular des Neuen Bauens gehören ferner die breiten, sprossenlosen Fenster ohne Klappläden, die sich teilweise schieben oder gar versenken lassen. Radikalere Elemente wie ein Flachdach oder Fensterbänder kommen aber nicht vor. Vielmehr haftet einigen Elementen, wie der pergamentenen Auskleidung des Wohnraums und der metallenen Fenstereinfassung im Salon, ein Hauch des ebenfalls zeittypischen Art déco an. Einen weiteren Höhepunkt bedeuten die Wandgemälde mit bukolischen Motiven von Karl Walser im grossen Esszimmer (Abb. 14). In der ausführlichen Publikation, die das Haus 1935 in der Zeitschrift «Das Werk» erfuhr, bekennen sich die Architekten zu einer «bewusst einfachen äusseren Gestaltung» und stellen die «Durchbildung aller Einzelheiten entsprechend den modernen Wohnbedürfnissen» in den Vordergrund.[4]
Walter Henauer und Ernst Witschi, die von 1913 bis 1939 ein Architekturbüro in Zürich führten, waren aufgeschlossene, wenn auch nicht avantgardistische Architekten, die den Umbruch in der modernen Architektur mitvollzogen. Merkmale ihrer Bauten sind prägnante kubische Kompositionen, klare geometrische Grundformen und straffe Linienführungen. Ihr bekanntestes Werk ist die 1929/30 erbaute Zürcher Börse, die mit der Villa Im Forster den runden Treppenturm und die Verwendung von Glasbausteinwänden gemeinsam hat.[5]
Bewahrende Instandsetzung
Dass die Villa Im Forster heute in ihrer ursprünglichen Gestalt und Struktur völlig intakt dasteht, kann als denkmalpflegerischer Glücksfall bezeichnet werden. Als die heutigen Eigentümer, die den Familienhauptsitz geerbt hatten, an die Neuplanung des umgebenden Areals gingen, stand für sie fest, dass das Haus in seiner ganzen Eigenart und mit all seinen Qualitäten bewahrt werden sollte. Natürlich spielten dabei emotionale Werte eine wichtige Rolle. Dank dem guten Gebäudeunterhalt waren das Äussere wie das Innere sowohl in der Struktur als auch im Detail weitgehend unverändert erhalten geblieben. Alle Gebäude auf dem Grundstück standen im Inventar der städtischen Denkmalpflege. Im Zuge der Planung einigten sich die Beteiligten mit der Denkmalpflege darauf, die Villa als Herzstück der Anlage zu restaurieren; die auf der ganzen Welt verstreuten Mitglieder der Besitzerfamilien wollen das Haus weiterhin als Domizil für ihre Aufenthalte in Zürich nutzen. Dafür wurden das Garagengebäude, die Gärtnerei sowie das Chalet Tobler aus dem Schutz entlassen. Für die Instandsetzung des Wohnhauses schlug die Denkmalpflege der Bauherrschaft mögliche Architekten vor. Zur Vorbereitung der Planung erarbeitete das Zürcher Architekturbüro Pfister Schiess Tropeano & Partner eine Bestandsaufnahme und einen Massnahmenkatalog. Gemeinsam mit der Denkmalpflege wurde jeder Raum einer Schutzkategorie zugeteilt: integraler Schutz inklusive Einrichtung für besonders wertvolle Interieurs, konzeptioneller Schutz für wesentliche Raumausstattungen oder genereller Raumschutz für wichtige Raumstrukturen. Nur die Innenräume des Angestelltentrakts wurden keinem Schutz unterstellt. Schliesslich erfolgte ein Direktauftrag an das Büro.
Während der 2008 bis 2010 mithilfe zahlreicher Spezialisten durchgeführten Arbeiten legten die Architekten ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Restaurierung der Gesellschaftsräume im Erdgeschoss und der Privaträume im Obergeschoss. Die meist intakten Oberflächen und Bestandteile wurden gesäubert, schadhafte Stellen repariert. Sämtliche Installationen wurden erneuert und die zahlreichen technischen Finessen überholt. Die bunte Farbpalette für die Teppiche und Tapeten in den Räumen wurde, immer im Dialog mit den Auftraggebern, soweit als möglich wiederhergestellt. Nur die bereits früher veränderte Küche wurde neu gestaltet.
Zudem wurde der Angestelltentrakt, der vom Haupthaus getrennt werden sollte, als eigene Wohnung ausgebaut. Die Herausforderung lag vor allem darin, die vielen verschiedenen Materialien, Beschläge und Ausstattungselemente instand zu setzen und dafür qualifizierte Handwerker zu finden.
So erstrahlt die Villa Im Forster in altem Glanz. Das Nussbaumholz des Parketts und der Türen verströmt eine vornehme Atmosphäre. Das Spiegelglas der Fenster sorgt für Brillanz. Die Fensterrahmen aus Eichenholz sind instand gesetzt. Die mit neuem Ziegenleder bespannten Paneele (vgl. S. 17) verleihen dem Wohnzimmer seine besondere Anmutung. Das Panoramafenster im mit Blisterahorn ausgekleideten kleinen Esszimmer kann wieder auf Knopfdruck versenkt werden. In der Summe entspricht die Sanierung dem State of the Art und dem ursprünglichen hohen ästhetischen Anspruch.
Anmerkungen:
[01] Claudia Fischer-Karrer, Detailinventar «Zürichbergstrasse 117, Chalet Tobler», Zürich 2003 (unpubliziert)
[02 und 04] Werk, Nr. 2, 1935, S. 33
[03] Beispiele sind die Häuser Susenbergstrasse 93–97 (Karl Moser) und 101 (Lux Guyer) sowie Restelbergstrasse 97 (Otto Rudolf Salvisberg)
[05] Zur gleichen Zeit realisierten Henauer & Witschi das Klubhaus des Golfklubs in Zumikon, den der Bauherr der Villa mitbegründete. Dieser war auch Auftraggeber für die an die Börse anschliessenden Geschäftshäuser Schanzenhof (1926/27) und Schanzenegg (1933/34).TEC21, Fr., 2011.09.23
23. September 2011 Michael Hanak