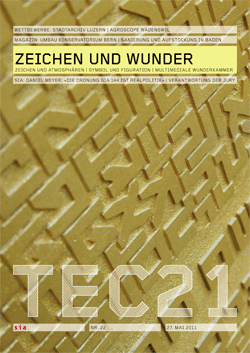Editorial
«Es geschehen noch Zeichen und Wunder» ist ein geflügeltes Wort, das auf biblische Quellen zurückgeht. Durch «Zeichen und Wunder» offenbarte sich Gott seinem Volk Israel. Der brennende Dornbusch, das Fanal zum Exodus, erschien, so wie im Tanach1 erzählt, Mose auf dem Berg Horeb, wo Gott ihm seinen Namen, JHWH, mitteilte.
Wunder bedürfen der Deutung, und diese nimmt die Form von Zeichen an. Das Wunder ist ohne die Zeichen nicht zu verstehen. In der jüdischen Tradition ist die Schrift mehr als nur eine Form des Zeichens, dem willkürlich eine Bedeutung zugeordnet wird. Die Schrift ist selbst das, was sie bezeichnet, die Buchstaben sind reale Objekte, die die Verbindung zu Gott herstellen. Der jüdische, in Serbien geborene Autor David Albahari lässt in «Die Ohrfeige» Menschengruppen auftreten, «die mit ihren Körpern die erforderlichen Gebete schreiben sollten», auf dass sie gerettet würden, «um in einem Prozess, in dem die Buchstaben durch Menschenleiber gebildet werden, einen Verteidigungsschild zu erschaffen»2. Die Schrift und die Thora bilden aber auch einen räumlichen Kontext. Die neue Synagoge in Mainz ist ein Raum, der einen solchen Schritt verkörpert («Symbol und Figuration»). Und sie ist Anschauung dessen, dass wir «ja im Prinzip auch Werke, welche eine semantische Strategie verfolgen, ‹atmosphärisch› erleben (könnten), die Zeichen haben ja auch ihre Materialität» («Zeichen und Atmosphären»). Worte, die nicht ihrer Form nach, sondern ihres Klangs wegen das sind, was sie bezeichnen, sind lautmalerisch. Sie bedürfen keiner Erklärung, evozieren per se eine Atmosphäre. Die meisten Begriffe aber bedürfen einer kulturellen Prägung, um mehr zu sein als Namen. «Madeleine» ist ein solcher Name. Für den Protagonisten in Marcel Prousts «Suche nach der verlorenen Zeit» aber beschwört er eine synästhetische Erinnerung der Stadt Combray in all ihren Einzelheiten herauf.3 Auf diese Weise funktioniert die Ausstellung «Theatergarten Bestiarium», ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Skulptur, Musik, Fotografie, Film und Theater («Multimediale Wunderkammer»). Es versöhnt «die semiotische Deutung der Zeichen und die synästhetische Wahrnehmung der Atmosphären», für die Ákos Moravánszky plädiert.
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neues Stadtarchiv für Luzern | Eingang Agroscope Wädenswil
10 PERSÖNLICH
Rudolf Fässler: «Werte zu erhalten, begleitet mein Leben»
12 MAGAZIN
Umbau Konservatorium Bern | Sanierung und Aufstockung in Baden | Holz – Zwischenlager für CO2 | Geschichte der Denkmalpflege | Glasnost statt Kalter Krieg | Bücher
26 ZEICHEN UND ATMOSPHÄREN
Ákos Moravánszky Bedarf Architektur der interpretatorischen Deutung, oder soll sie rein intuitiv erfasst werden? Ein Plädoyer für eine Ver-söhnung von semiotischer Deutung der Zeichen und synästhetischer Wahrnehmung der Atmosphären.
29 SYMBOL UND FIGURATION
Christian Holl Die neue Synagoge in Mainz von Manuel Herz thematisiert die Beziehung zwischen Form und Inhalt, Symbol und Figuration und verweist auf ein heute oft ungenutztes architektonisches Ausdruckspotenzial.
34 MULTIMEDIALE WUNDERKAMMER
Rahel Hartmann Schweizer Die Ausstellung «Theatergarten Bestiarium» stachelt die Imagination an. Angefüllt mit Architektur, Skulptur, Mu-sik, Fotografie und Film ist sie atmosphärisch dicht und symbolisch verästelt.
42 SIA
Daniel Meyer: «Die Ordnung SIA 144 ist Realpolitik» | Verantwortung der Jury | Stärkere Öffnung des SIA
48 PRODUKTE
50 FIRMEN
51 WEITERBILDUNG
61 IMPRESSUM
62 VERANSTALTUNGEN
Zeichen und Atmosphären
Bedarf Architektur der interpretatorischen Deutung, oder soll sie rein intuitiv erfasst werden? Die zitierfreudige Postmoderne von Michael Graves oder Charles Moore bewirkte mit der Zeit Überdruss und wurde abgelöst vom Streben nach einer «atmosphärischen Architektur», die unmittelbar sinnlich erlebbar sein sollte. Diese wiederum lief Gefahr, in Kunstschamanentum zu kippen. Der Autor des folgenden Essays plädiert für eine Versöhnung zwischen semiotischer Deutung der Zeichen und synästhetischer Wahrnehmung der Atmosphären.
Es ist der erste Augenblick der Betrachtung, der die ganze Bedeutung eines Werkes offenbart, und nicht, was darauf folgt, wenn man auf das Werk mit einem leeren Blick zurückschaut. Der amerikanische Kunstkritiker Clement Greenberg vertrat jedenfalls diese Meinung: Die Essenz des Ganzen wird im ersten Moment der Begegnung sofort erfasst, die weitere Analyse bringt keine wesentlichen Erkenntnisse mehr, die ersten Eindrücke werden nur durch eine Sequenz von weiteren Betrachtungen ergänzt. Der glückliche Augenblick bleibt bis heute eine Art Utopie des unmittelbaren Sehens von Angesicht zu Angesicht, die leibliche Wahrnehmung des Raums «an sich», mit allen Sinnen, unverstellt durch Reflexion, Ideologien oder Bilder anderer uns bekannter Räume aus der Geschichte oder privater Erinnerung.
«Jenseits der Zeichen» war der Zwischentitel des ersten Kapitels, «Eine Anschauung der Dinge», in der 1998 erstmals publizierten Textsammlung «Architektur Denken» von Peter Zumthor; der Text war ursprünglich Teil eines im November 1988 in Santa Monica gehaltenen Vortrags. Mit dem gleichen Titel hat Bruno Reichlin 2001 einen Aufsatz im Themenheft «Differenz und Identität» der Zeitschrift «Der Architekt» veröffentlicht. Er berichtet in diesem Essay von dem «wachsenden Widerwillen» der jüngeren Architektengeneration «gegenüber jeglichem theoretischen Konstrukt, jeder Schlussfolgerung oder Erklärung, die sowohl die schöpferische Sinngebung in der Projektierungsphase als auch die kritische Rezeption des Werkes in einem rationalen Diskurs zu erfassen versucht…».[1]
Maschinerie der Interpretation
Worauf Rechlin hier anspielt, ist die semiotische Analyse, die in den 1970er- und 1980er-Jahren auch in der Schweizer Architektur einflussreich wurde. Semiotik war geeignet, die sprachlichen Defizite der Moderne zu kritisieren: ihre Unfähigkeit, eine Bedeutung zu kommunizieren, welche die Stadtbewohner entschlüsseln und verstehen können. Zeichen lesen – literarische Texte, Werbung, Körpersprache, medizinische Symptome und nicht zuletzt Architektur, das war das Gebiet der Semiotik. Sie hat sich in kurzer Zeit zu einer Wissenschaft zur Deutung der verschiedensten Phänomene von der Alltagskultur bis zum Städtebau entwickelt. Egal, ob eine Säule, ein Portal, ein Wohnhaus oder ein Stadtbezirk, die Semiotik hat eine Methodologie und eine Begrifflichkeit entwickelt, die ihre Grundlagen in Ferdinand de Saussures «Cours de linguistique général» (1906–11) fand. In den 1990er-Jahren wirkte diese Lehre bereits wie eine gut geölte Maschinerie, die fähig ist, die verschiedensten Werke interpretativ zu bearbeiten, ohne ihre Qualitäten beurteilen zu können. Besonders die zitierfreudige Postmoderne von Michael Graves oder Charles Moore hat gezeigt, dass die Anwendung literarischer Kriterien auf die Architektur, wie Charles Jencks es vorexerzierte, zu keinen zufriedenstellenden Resultaten führt. Das spätere Werk von Aldo Rossi, wie das Bonnefantenmuseum in Maastricht (1990) oder der Technologiepark Fondo Toce (1993), vermochte nicht einmal seine früheren Anhänger zu überzeugen.
Kunst Schamanentum und der warme Bauch der Architektur
Bruno Reichlin wollte der mit der Semiotik unzufriedenen jüngeren Generation ihre Stimme geben, kontrastierte im zitierten Aufsatz die Rationalität der Methode mit der ihnen gesuchten«Wärme». Er stellte die Gründe für deren Unzufriedenheit mit viel Empathie dar, wollte andererseits seine Kritik nicht unterdrücken. Vor allem nicht, wenn er hinter den markigen Worten von einer neuen Ästhetik der Unmittelbarkeit und Präsenz einen alten Antiintellektualismus und Kunstschamanentum vermutete. Er bemerkte in seinem Aufsatz, dass die alten Spekulationen über Synästhesie, welche subjektivistischen Ansätzen in der Ästhetik den Weg ebnen sollen, einen durchaus ideologischen Charakter haben.
Ein modellhaftes Beispiel der «atmosphärischen Architektur» war der Schweizer Pavillon für die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover von Peter Zumthor. Das Aufeinanderprojizieren der Sinneseindrücke im Zumthors Ausstellungspavillon «Klangkörper Schweiz», der Holzgeruch, Tast- und Geschmackerlebnisse vermittelte,[2] schuf eine Atmosphäre, die Teilnahme versprach. Durch Hören der Free-Alpen-Jazzklänge von Hans Koch, durch Riechen, Schmecken der Bündner Gerstensuppe und Tasten der rohen Holzflächen sollte man von einer deutlichen Präsenz ergriffen werden. Ein Bewusstseinszustand wurde hervorgerufen, der sich vom Objekt nicht distanzierte, sondern unreflektiert und ganz körperlich blieb. Das ist es wohl, was Reichlin als die Vereinigung mit dem«warmen Bauch der Architektur» bezeichnete und was jenem Phänomen entspricht, das der Philosoph Gernot Böhme als Atmosphäre beschrieb. Böhme wollte damit etwas zur Sprache bringen, was weder als rein subjektiv noch als rein objektiv ausgewiesen werden kann. Atmosphären werden erspürt, gefühlt und sind doch als das, was uns umgibt, was uns von aussen an- und berührt, überaus real. Böhme spricht deshalb auch von «quasi-objektiven Gefühlen». In seinem Text «Über Synästhesien » definierte Böhme Atmosphäre als den «primären und in gewisser Weise grundlegenden Gegenstand der Wahrnehmung», das Ganze,«in das alles Einzelne, das man dann je nach Aufmerksamkeit und Analyse daraus hervorheben kann, eingebettet ist». Er verband Atmosphären mit der«Ekstase der Dinge»: Ein Ding, wie etwa ein blauer Krug, zeigt seine Präsenz, indem es «aus sich heraustritt».[3] Er gab einige Beispiele: «Man kommt aus belebter Strasse und betritt einen Kirchenraum. Oder man betritt eine noch unbekannte Wohnung. Oder man hält zur Rast bei einer Autofahrt an, geht ein paar Schritte, und plötzlich öffnet sich der Blick auf das Meer. In solchen anfänglichen Situationen wird deutlich, dass, was zuerst […] wahrgenommen wird, in gewisser Weise der Raum selbst ist. Dabei ist aber mit Raum nicht etwa im kantischen Sinne die reine Anschauung des Ausser- und Nebeneinanders gemeint, sondern die affektiv getönte Enge oder Weite, in die man hineintritt, das Fluidum, das einem entgegenschlägt. Wir nennen es in Anlehnung an die Terminologie von Hermann Schmitz die Atmosphäre. […] Man wird Dinge erkennen, man wird Farben benennen, Gerüche identifizieren. Wichtig ist, dass dann jedes einzelne […] von der Atmosphäre getönt ist. Die Möbel drängen sich in kleinbürgerlicher Enge, das Blau des Himmels scheint zu fliehen, die leeren Bänke der Kirche laden zur Andacht ein. So jedenfalls erfährt es der Wahrnehmende. Der ästhetische Arbeiter weiss es auch anders. Er weiss nämlich, wie er durch Raumgestaltung, durch Farben, durch Requisiten Atmosphären erzeugen kann.»[4] In Böhmes Argumentation werden durch die Ästhetik der Atmosphären sowohl Subjekt/Objekt- als auch Hochkultur/Trivialkultur-Divisionen überwunden. Künstler, Designer, Schaufensterdekorateure und ihre Zimmer dekorierende Teenager sind gleichsam «ästhetische Arbeiter»[5]. Das Problem ist, dass er in seinen Schriften historisch und kulturell unspezifische Situationen verwendet: «Man betritt eine Wohnung, und es schlägt einem eine kleinbürgerliche Atmosphäre entgegen. Man betritt eine Kirche, und man fühlt sich von einer heiligen Dämmerung umfangen. Man erblickt das Meer und ist wie fortgerissen in die Ferne. Erst auf diesem Hintergrund bzw. in dieser Atmosphäre wird man dann Einzelheiten unterscheiden. »6 Er bemerkt zwar die «ästhetische Haltung» des erfahrenden Subjekts, diese Haltung wird jedoch in seiner Analyse nicht weiter untersucht, nicht einmal wirklich berücksichtigt. Es wird angenommen, es gäbe eine affektive Einstimmung auf ein atmosphärisches Ding, bar jeder kulturellen Prägung – als wären Atmosphären für jeden in gleicher Weise erfahrbar.
Vom ersten Augenblick zum Blick zurück
Es ist aber offensichtlich, dass der Unterschied zwischen der von Böhme so bezeichneten «kleinbürgerlichen Atmosphäre» und dem «gestimmten Raum» des Schweizer Pavillons oder eines Wohnhauses eben nicht als Beweis dienen kann, dass diese Architekturen bar jeglicher kulturell vermittelten Bedeutung wirken. Eine genaue Analyse der Umstände, wie etwas«atmosphärisch» wahrgenommen wird, ist notwendig. Wir könnten ja im Prinzip auch Werke, die eine semantische Strategie verfolgen, «atmosphärisch» erleben, die Zeichen haben ja auch ihre Materialität. Welche Art von Wissen muss der Besucher mitbringen, um in der Atmosphäre des Pavillons die Schweiz zu erkennen? Die Kommentare der Besucher, ihre Versuche, das Gebäude als Ausdruck einer «Schweizer Identität» zu verstehen, haben gezeigt, dass Semiotik die Intentionen der Besucher beeinflusst, wie sie solche atmosphärische, immersive Umgebungen «lesen» wollen.
Solche Überlegungen legen es nahe, die synästhetische Wahrnehmung der Atmosphären und die semiotische Deutung der Zeichen nicht als zwei sich widersprechende, diametral entgegengesetzte Vorschläge zu betrachten. Semiotik in der Architektur muss sich nicht nach dem Modell der Sprache orientieren, sondern die Frage der Wahrnehmnung der Umwelt allgemeiner fassen, etwa so, wie Jacob von Uexküll die Lebenswelten der Tiere, ihre Merk- und Wirkräume untersuchte. Andererseits darf die ästhetische Theorie der Atmosphären nicht bei Greenbergs «erstem Augenblick» bleiben, sondern muss den weiteren Prozess der Reflexion untersuchen, der kulturell vermittelt und nicht «jenseits der Zeichen» stattfindet.
Anmerkungen:
[01] Bruno Reichlin: «Jenseits der Zeichen», in: Der Architekt. März 2001, S. 62
[02] Roderick Hönig (Hg.): Klangkörperbuch. Lexikon zum Pavillon der Schweizerischen Eidgenossenschaft an der Expo 2000 in Hannover. Birkhäuser, Basel 2000, S. 45
[03] Gernot Böhme: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, S. 32f.
[04] Böhme, «Über Synästhesien», in: Daidalos 41. 1991, S. 26–36, hier S. 35
[05] Böhme, Atmosphäre (wie Anm. 3), 21f.
[06] Böhme, «Über Synästhesien» (wie Anm. 4), Abb. 11TEC21, Fr., 2011.05.27
27. Mai 2011 Ákos Moravánszky
Symbol und Figuration
Die neue Synagoge in Mainz von Manuel Herz ist nicht nur ein spektakulärer Neubau. Er thematisiert, wie Architektur produziert wird, welche Beziehung zwischen Form und Inhalt, Symbol und Figuration spielen könnte – verweist damit auf ein heute oft ungenutztes architektonisches Ausdruckspotenzial.
Der Frage nach der Farbe des Synagogenraums weicht der Architekt Manuel Herz aus – sie sei eine eigens angefertigte Mischung, die keinen Namen habe. Sie ist weder Braun noch Gelb, weder Gold noch Bronze und trägt doch von allem etwas in sich. Die Strategie bei der Farbwahl ist symptomatisch für den Entwurf der neuen Synagoge in Mainz, die im September 2010 nach nicht einmal zweijähriger Bauzeit eröffnet wurde. Einer eindeutigen Zuweisung von Bedeutung entzieht sich das Gebäude, soll es sich entziehen. Aber nicht durch eine grösstmögliche Neutralität – im Gegenteil: Nicht neutral soll die neue Synagoge sein, sondern eine Vielfalt von Assoziationen, von Zusammenhängen herstellen, von Lesarten ermöglichen. Die Synagoge von Mainz ist narrativ, sie ist figurativ, aber sie behauptet nichts, sie schafft einen Raum, der jenseits der Narration besteht, der in der Figuration und in der Form Heimat und Trost, Kritik und Denkanstoss zugleich ist.
Die Sprache als Objekt der Welterkundung
Wenn auch in kurzer Zeit gebaut, so reicht die Geschichte der Mainzer Synagoge doch weit zurück. Nach 1945 zählte die Jüdische Gemeinde von Mainz, im 11. und 12. Jahrhundert einer der Mittelpunkte jüdischen Geisteslebens überhaupt, nur noch wenige Mitglieder. Das änderte sich substanziell erst mit der Öffnung von Osteuropa: Namentlich durch Zuzüge aus der ehemaligen Sowjetunion wuchs die Gemeinde auf über 1000 Mitglieder an. Ein Wettbewerb für einen Synagogenneubau wurde ausgeschrieben und 1999 zugunsten des damals gerade 30 Jahre alten Manuel Herz entschieden. Schon Jahre zuvor war der Ort in einem innenstadtnahen Gründerzeitviertel, an dem die 1912 erbaute und 1938 zerstörte Hauptsynagoge gestanden hatte, zum Bauplatz für die neue Synagoge bestimmt worden.
Finanzierungsschwierigkeiten zögerten den Bau hinaus, und mag man auch die Spuren der 1990er-Jahre, allen voran die Syntax Daniel Libeskinds, in der neuen Synagoge erkennen, so hat sie 2010 nichts an Aktualität eingebüsst. Diese Qualität ist nicht zuletzt dem sorgsam entwickelten und durchdachten Konzept zu verdanken. Das zeigt sich bereits in der städtebaulichen Konfiguration.
An zwei Seiten setzt die Synagoge die Baufluchten der Randbebauung des trapezförmigen Blocks fort, wird aber an der dritten so eingeknickt, dass ein Platz vor der Synagoge entsteht, der das Ensemble einbindet, aber auch dessen besonderer Bedeutung gerecht wird (Abb. 2). Die 1988 wiederentdeckten und rekonstruierten Säulenreste des zerstörten Altbaus sind nun Teil dieses Platzes, verbinden Geschichte und Gegenwart ohne Pathos (Abb. 16). Die neue Synagoge umschliesst einen lauschigen Hof, um den sich die angegliederten Wohnungen, die Büroräume, die Schul- und Besprechungszimmer sowie die Räume des Kindergartens legen. Durch die Anordnung des Gebäudes können Sicherheitszäune und Absperrungen auf ein kaum sichtbares Minimum reduziert werden. So recht selbstverständ lich ist das jüdische Leben in Deutschland eben doch noch nicht wieder geworden. Auch wenn Kubatur und Fassadenfarbe mit der Umgebung und den strassenbegleitenden Platanen angenehm harmonieren – dass hier ein aussergewöhnliches Gebäude steht, ist nicht zu übersehen. Die geknickte und gefaltete Gebäudeform ist aus den fünf hebräischen Buchstaben abgeleitet, die für «Qadushah» stehen. Qadushah bedeutet Segnung, Heiligung oder Erhöhung. Dabei ist die Schrift in der jüdischen Tradition, in der die Form der Buchstaben als von Gott gegeben verstanden wird, deutlich mehr als nur eine Form des Zeichens, dem willkürlich eine Bedeutung zugeordnet wird. Die Form selbst und das, was sie bedeutet, bilden eine Einheit: Die Schrift ist selbst das, was sie bezeichnet, die Buchstaben sind reale Objekte, die die Verbindung zu Gott herstellen, sie ermöglichen die konkrete Herstellung von Sinnzusammenhängen, die sich nicht in der Semantik erschöpfen.
Dabei spielt eine wichtige Rolle, dass die Schrift und die Thora selbst einen räumlichen Kontext bilden. Für die Juden in der Diaspora, verstreut in aller Herren Ländern, stellen sie den gemeinsamen Raum her, in dem sich die Gemeinschaften der Gläubigen durch die Sprache, durch das Lesen der Thora begegnen. Zwischen konkretem Ort und diesem Raum jenseits der realen Erfahrung vermittelt die Mainzer Synagoge: Das geschriebene Wort wird zum realen Ort und verweist auf die Existenz der weltweiten spirituellen Gemeinschaft. Villem Flusser hat diese Komplexität vielleicht am besten zusammengefasst, wenn er von der Sprache als einem «Möglichkeitsfeld, aus dem die Welt wird» spricht, sie als «symbolische Form, als Wohnort des Seins, als Enthüllung und Verhüllung, als Kommunikationsmittel, als Feld der Unsterblichkeit, als Kunstwerk, als Eroberung des Chaos» beschreibt.
Korrespondenzen zwischen Innen und Aussen
Den beiden aus dem Schriftzug sich ergebenden Hochpunkten sind im Innern die Gemeinschaftsräume zugeordnet, unter dem einen liegt ein Versammlungsraum, die Synagoge wird von einem auskragenden Keil markiert, in dem sich das Widderhorn wiedererkennen lässt – es steht für den Bund Gottes mit den Menschen, der Widder war von Abraham anstelle seines Sohnes geopfert worden. Das Blasen des Widderhorns ruft die Gemeinde zusammen, sein Schall soll die Himmelstore öffnen können.
Der Dinglichkeit der Schrift und der Sprache ist auch die Fassade verpflichtet: Es scheint, als seien in sie Rillen eingeritzt, die sich um die unregelmässigen Formen der Fenster legen. Tatsächlich setzt sich die Fassade aus zu Feldern gefügten, trapezförmigen Keramikelementen zusammen, massiv in den Randbereichen der Felder, profiliert in den Mitten. Glänzend glasiert mit einem dunklen Grün, ergeben sich je nach Licht und Standpunkt raffinierte Lichtspiele, Grafiken, Flächen, spiegeln sich Farben und Stimmungen der Umgebung. Durch eine mit Schriftzeichen versehene Tür kommt man ins Innere (Abb. 17). Ein zweigeschossiges, expressives Foyer mit einer schrägen Treppe und schiefen Ebenen öffnet sich, verknüpft den Gemeinschaftsraum für etwa 300 Personen und die weiteren Gemeinderäume zur Rechten mit dem Synagogenraum zur Linken, geradeaus kommt man in den Hof. Die Synagoge ist kein Raum einer durch Segnung inhärenten Heiligkeit, wie das bei christlichen Kirchen der Fall ist – das Gemeindeleben kann und soll sich direkt und unmittelbar in all seiner Vitalität begegnen und befruchten.
Dass die Nutzung der Räume und die Form des Gebäudes sich wunderbar ergänzen, zeigen die beiden Gemeinschaftsräume. Der Versammlungsraum wird von einem aufsteigenden Volumen geprägt, das ihm Grosszügigkeit verleiht, der hintere Bereich hingegen ist flacher und intimer, für kleinere Gruppen lässt sich der Raum auch teilen.
Der durch voluminöse Möbel und breite Brüstungen mächtig wirkende Synagogenraum verbindet zwei Raumideen (Abb. 1). Die Orientierung nach Osten, nach Jerusalem, verlangt nach einer Ausrichtung des Raums, die Praxis der Nutzung, die stärker als in der christlichen Liturgie dem Gemeinschaftlichen verpflichtet ist, hingegen Zentralität. Herz verbindet diese beiden Ansprüche miteinander, indem er den Raum durch das Licht, das durch das gewaltige Widderhorn wie durch eine Schütte in den Raum fliesst, ausrichtet, das Licht aber an den zentralen Punkt in der Mitte, auf das Vorlesepult, fallen lässt. Raumform, Lichtführung und äussere Form werden mit überraschender Selbstverständlichkeit zur Deckung gebracht. In die umlaufende Galerie wurde eine Bibliothek integriert, die Oberflächen sind von einem in Stuck gegossenen Ornament aus hebräischen Buchstaben bedeckt, aus denen sich immer wieder Gebete, Bibelstellen und Piyutim herauslösen – religiöse Dichtungen, die Mainzer Rabbiner während des Mittelalters verfasst hatten. Sie berichten von der Liebe zur Thora, aber auch von der Zerstörung der Gemeinden in der Zeit der Kreuzzüge – es sind diese Zeichen, die auch auf den Genozid im 20. Jahrhundert verweisen, ohne dass die Erinnerung an den Holocaust Macht über den zuversichtlichen Geist des Hauses gewinnt.
Diskurspotenzial durch Synthese
Man mag an den durch die Aussenform vor allem den Wohnungen oder den Nebenräumen auferlegten Zwängen mäkeln, sich fragen, ob man die Form der Fenster innen durch dunkle Rahmen hätte betonen und die Öffnungen damit kleiner erscheinen lassen müssen – aber damit geht man am Wesen dieses Hauses vorbei, das mehr ist als ein Nutzbau. Das Verhältnis zwischen Inhalt und Form stellt sich komplexer dar, als dass es sich mit «deckungsgleich» übersetzen liesse. Die Synagoge zeigt, welches Potenzial Architektur hat, wenn man darauf verzichtet, Figuration und Symbolik, Form und Nutzung getrennt voneinander verstehen zu wollen. Architektur bekommt damit eine Kraft, die anregen kann, die eine Kritik an der banalen Einordnung in einen als Gesetz missverstandenen Kontext formuliert. Diese Architektur reibt sich an der Weigerung vieler Bauten, vieler Architekten, Zeichen und Formen auf ihre Relevanz und ihre Bedeutung hin zu befragen und aktiviert damit ein brachliegendes gesellschaftliches Diskurspotenzial.
Bedauerlich ist, dass sich dieses Potenzial meist nur in Sonderbauten, namentlich denen mit jüdischem Bezug, manifestiert – die Sonderrolle der Juden wird damit zum einen betont, wenn sie nicht gleichzeitig von einer Form der Normalität im Alltag, durch jüdische Läden oder Restaurants begleitet wird. Zum anderen wird die widerständige Kraft der Architektur durch die Sonderrolle wieder geglättet. Und trotzdem: Dieses Haus erzählt von einem Verständnis von Architektur, zu dem uns der Zugang schwerfällt – weil man gelernt hat, ihre Aspekte analytisch voneinander zu trennen, anstatt sie als Einheit zu verstehen. Herz wehrt sich gegen eindeutige Zuweisungen, die im gebauten Wort eine Monokausalität von Entwurfsentscheidung und Formfindung sehen wollen, weil man damit die Qualität der Architektur verkennt. Dieses Misstrauen ist verständlich, wird aber durch das Werk entkräftet: Das Haus spricht für sich selbst.TEC21, Fr., 2011.05.27
27. Mai 2011 Christian Holl