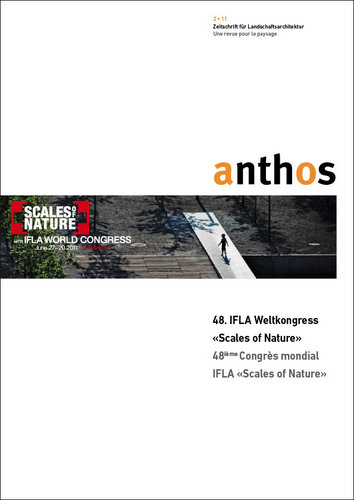Editorial
Die Herausforderungen für die Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung scheinen zunehmend komplexer zu werden. Immer mehr Menschen ziehen in Städte und die sich ausbreitenden Agglomerationsräume. Gleichzeitig ist eine urbane Lebensweise längst nicht mehr nur auf urbane Räume beschränkt. Wo immer mehr Menschen auf enger werdendem Raum leben, bei steigenden Bedürfnissen an die Wohnfläche, an Ver- und Entsorgung, Freizeitangebote sowie die Qualität der Landschaft, sind die gestalterischen Disziplinen in besonderem Masse gefordert. In den vergangenen Jahren rückten Fragen der nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Landschaften ebenso in den Vordergrund wie jene nach ihrer Geschichtlichkeit und Einzigartigkeit sowie ihrem Potenzial an Identität und Identifikationsmöglichkeiten der Bevölkerung.
Das Motto des 48. IFLA-Weltkongresses «Scales of Nature. From Urban Landscapes to Alpine Gardens», der vom 27. bis 29. Juni 2011 in Zürich stattfindet, öffnet den weiten thematischen Fächer aktueller Herausforderungen. Einerseits im Hinblick auf die zu bearbeitenden räumlichen Massstäbe und andererseits auf die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Räume für ihre künftige Entwicklung. Wie unterschiedlich die Schwerpunkte und Themenfelder im internationalen Kontext gewichtet werden, zeigen die Beiträge der Hauptredner des Kongresses, die anthos ihre Standpunkte in kurzen Thesen zur Verfügung gestellt haben. So global die Themen aber sind, so lokal muss häufig nach einer Lösung gesucht werden. Wie die Profis von morgen an komplexe Aufgaben herangehen zeigen die drei Gewinnerarbeiten des diesjährigen «Student Landscape Architecture Design Competition » zum Thema «Urbane Grenzen» («Urban boundaries»), den die Abteilung Landschaftsarchitektur an der Hochschule für Technik Rapperswil HSR durchgeführt hat. Da Lösungen für komplexe Probleme vielfach aber nicht auf der Hand liegen, sondern Gegenstand aufwändiger Forschungen sind, beleuchtet ein Beitrag die aktuelle Situation der Schweiz auch im Hinblick auf die heutige und künftige Forschungslandschaft.
Diese anthos-Ausgabe erscheint begleitend zum IFLA-Weltkongress; parallel dazu erscheint eine englischsprachige Sonderausgabe, die der Kongressmappe beiliegt. Es ist für anthos eine grosse Freude und Ehre sowie eine schöne Fortsetzung einer langen Tradition, den Kongress als nationaler Medienpartner zu begleiten.
Sabine Wolf