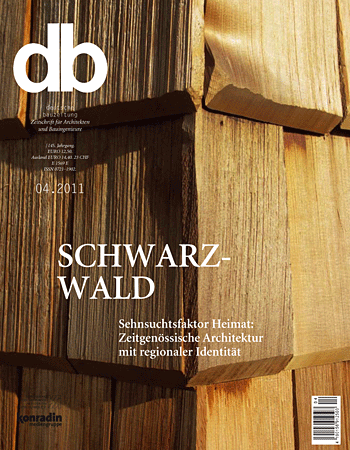Editorial
Wie zeitgenössische Architektur mit regionaler Identität verbinden? Danach fragte bereits 1999 der Schwarzwaldverein e. V. im Rahmen seines Architekten-Wettbewerbs »Schwarzwaldhof der Zukunft« und fand überzeugende Antworten; ebenso wie die Architektenkammer Baden-Württemberg, die 2010 gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Freiburg erstmals den Preis »Neues Bauen im Schwarzwald« vergab. Die Ergebnisse der Wettbewerbe und auch unsere, für dieses Heft ausgewählten Beispiele belegen das hohe Innovationspotenzial, das auch in tradierten Techniken und über die Jahrhunderte geformten Typologien steckt. Kein Widerspruch – wie sogar Sigfried Giedion 1956 in seinem Aufsatz »Über den neuen Regionalismus« vertrat. Auf unserer »Entdeckungstour« durch den Schwarzwald gehen wir der Frage nach »Regionalem Bauen« und »Heimat« nach und stellen Ihnen Projekte und Büros vor, die respektvoll mit dem vorhandenen Orts- und Landschaftsbild umgehen und dabei dennoch eine eigenständige, moderne Architektursprache entwickeln. Projekte, die an regionaltypische Materialien und Techniken anknüpfen und die energie- und ressourcenschonend umgesetzt sind. Architekturen also, die den Kultur- und Landschaftsraum Schwarzwald bereichern und nachhaltig fördern. | Ulrike Kunkel