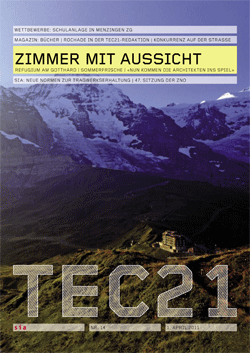Editorial
Reisen, rasten, verweilen ... Während vieler Jahrhunderte waren grössere Ortswechsel zweckgebunden, dienten der Wallfahrt oder dem Handel. Reisen als Selbstzweck entwickelte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Freizeitkultur. Der Alpenraum als Reiseziel wurde zunächst von englischen Touristen entdeckt, die ihn während ihrer «grand tour» auf dem Weg nach Italien durchquerten und als «playground of Europe» mit Erstbesteigungen und Ski auch eroberten.
Diese TEC21-Ausgabe spannt den Bogen von der einfachen Herberge, die den Reisenden seit Jahrhunderten eine geschützte Unterkunft auf der Gotthardpasshöhe bietet, über ein zum Kurhotel avanciertes Berggasthaus aus der Frühzeit des Alpentourismus bis zu einem lokal stark ver-wurzelten ehemaligen Kurhaus am Zürichsee, das sich als Seminarhotel neu erfindet, ohne den Bezug zur lokalen Bevölkerung zu verlieren. Allen drei Projekten gemein ist ihre besondere Planungsgeschichte: Bei Umbau und Erweiterung des alten Hospizes auf dem Gotthardpass gelang Architekten und Ingenieuren durch die vereinte Entwicklung von Tragwerk und Architektur ein Bau, der von den extremen Witterungsverhältnis-sen erzählt und sich perfekt einpasst in diesen mit Bedeutungen aufgeladenen und von Ingenieurbauwerken geprägten Ort («Refugium am Gott-hard»).
Den geografischen und zeitlichen Parametern angemessen ist auch die Sanierung des Hotels «Maderanertal» im Kanton Uri. Das älteste noch erhaltene Gästebuch des ehemaligen Kurhotels stammt aus dem Jahr 1870 – und ist gefüllt mit Namen zeitgenössischer Prominenz, die das Hotel als Sommerfrische nutzte. In den letzten Jahren geriet die Anlage in Vergessenheit, eine Sanierung weckte sie 2008 wieder aus dem Dorn-röschenschlaf. Die Beteiligten entschieden sich für ein Vorgehen, das der abgelegenen Lage und den kurzen Baufenstern Rechnung trägt: Ge-baut wird in Etappen und erst, wenn die Finanzierung gesichert ist. Durch die behutsame und gleichzeitig pragmatische Planung konnte eine dem Ort angemessene Qualität wiedergewonnen werden («Sommerfrische, wiederbelebt»).
Dass sich die Wertschätzung von Architektur und damit der Rolle des Architekten als «mastermind» eines Projekts bei den verschiedenen Betei-ligten eines Bauvorhabens fundamental unterscheiden kann, zeigt dagegen der Artikel zum Bau des Hotels «Belvoir» in Rüschlikon am Zürich-see. Das ehemalige Kurhaus, das zeitweise Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler gehörte und sich später jahrzehntelang im Besitz der Gemeinde befand, wurde in den letzten zwei Jahren rundum erneuert. Dabei stellte sich auch die Frage nach dem Anteil der Architektur am Erfolg eines Hotelbetriebs («Nun kommen die Architekten ins Spiel»).
Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schulanlage in Menzingen ZG
12 MAGAZIN
Bücher | Rochade in der TEC21-Redaktion | Hotels – In Kürze | Konkurrenz auf der Strasse
18 REFUGIUM
AM GOTTHARD
Jürgen Tietz, Rolf Bachofner Das alte Hospiz auf dem Gotthardpass wurde umgebaut und erweitert. Architekten und Ingenieure schufen ein Bauwerk, das der Bedeutung des Ortes gerecht wird.
25 SOMMERFRISCHE,
WIEDERBELEBT
Tina Cieslik Das Hotel «Maderanertal» in Uri stammt aus dem 19. Jahrhundert. Planung und Ausführung der Sanierung berücksichtigten des-sen abgelegene Lage, die kurzen Baufenster und den
engen finanziellen Rahmen.
29 «NUN KOMMEN DIE ARCHITEKTEN INS SPIEL»
Albert Kirchengast Der Bau des Hotels «Belvoir» in Rüschlikon zeigt auf, wie Architektur unter-schiedlich wahrgenommen wird und welches Spannungsfeld sich daraus ergibt.
34 SIA
Neue Normen zur Tragwerkserhaltung | 47. Sitzung der ZNO
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Refugium am Gotthard
Das alte Hospiz auf dem Gotthardpass wurde in den Jahren 2008 bis 2010 zum 3-Sterne-Hotel umgebaut und erweitert. Die Architekten Miller & Maranta und die Bauingenieure Conzett Bronzini Gartmann schufen in enger Zusammenarbeit ein modernes Bauwerk, das wirkt, als habe es schon immer an diesem Ort existiert. Es bettet sich selbstverständlich in den räumlichen und historischen Kontext ein, und seine Schlichtheit widerspiegelt sich in Architektur und Tragwerk.
Die Passhöhe des St. Gotthard ist einer der bedeutenden Schweizer Erinnerungsorte, der zugleich eine europäische Dimension besitzt: Der Pass markiert eine der wichtigsten ökonomischen und kulturellen alpinen Schnittstellen zwischen Norden und Süden – ein Drehkreuz, das mit der neuen Röhre des Gotthardtunnels bis heute nichts an seiner verkehrstechnischen Bedeutung eingebüsst hat. Doch der seit Jahrhunderten andauernde über- und unterirdische Ausbau des Gotthards steht nicht nur für die Verbindung zwischen dem deutsch- und dem italienischsprachigen Raum, sondern auch für die daraus erwachsenden Gefährdungen. Erfahrbar wird dies an den Befestigungsanlagen des schweizerischen Reduits, das auch auf dem Gotthard als Sicherung eines unverbrüchlichen Innersten der Schweiz in Zeiten der Bedrohung gilt. Seine vielschichtige Bedeutung sieht man dem kleinen städtebaulichen Ensemble auf der Passhöhe jedoch auf den ersten Blick nicht unbedingt an. Es setzt sich aus der alten Sust, einst Güterumschlagplatz und heute Museum, dem Hotel «St. Gotthard» und dem Hospiz St. Gotthard zusammen (Abb. 1). Trotz ihrem jahrhundertelangen Bestehen sind die Bauten auf der Passhöhe durch ihre stete Transformation gekennzeichnet. Besonders deutlich wird dies am alten Hospiz, dem baulichen Herzstück der Passhöhe (vgl. Kasten S. 20). Von 2008 bis 2010 wurde das Hospiz umgebaut, renoviert und über eine Dachaufstockung erweitert. Damit hat der Bau seine historische Funktion als Gästehaus zurückerhalten. Mehr noch: Das Hospiz ist selbst zum Berg geworden, kantig ragt es auf der einen Seite empor, und steil stürzt es auf der anderen hinab, während das 25 t schwere Bleidach trutzig schwer auf ihm lagert.
Neue Stahlbetonstruktur in Bestand eingebettet
Den 2005 ausgelobten Studienauftrag zum Umbau des Hospizes gewannen die Basler Architekten Miller & Maranta mit einem Projekt, das die klimatische Ausgesetztheit des bestehenden Volumens thematisiert und die beiden Nutzungen – Hotel und Kapelle – unter einem Dach vereint, die Typologien aber ablesbar belässt.
Ein wichtiger Teil des Entwurfes besteht in der Aufstockung des Daches um eineinhalb Geschosse. Dadurch konnte nicht nur die nötige Fläche für den Hotelbetrieb – 14 Zimmer mit 30 Betten – gewonnen werden, die neue Steilheit des Daches verschafft dem denkmalgeschützten Bau auch innerhalb des Ensembles eine stärkere Präsenz. Im Inneren intervenierten die Architekten, die bereits in der Entwurfsphase eng mit den Ingenieuren von Conzett Bronzini Gartmann zusammenarbeiteten: Die Raumstruktur von 1905 war für einen zeitgemässen Hotelbetrieb nicht geeignet. Daher liessen sie die innere Struktur bis auf das erste Obergeschoss zurückbauen. Innenwände und Dachkonstruktion wurden vollständig abgebrochen, die Fassaden aus gemauerten Steinen blieben dagegen stehen. Ebenso wurden die teilweise mit Stahlprofilen bewehrten Betondecken über dem Erdgeschoss rückgebaut, weil der Stahl stark korrodiert war. Im Südteil blieben lediglich die Steintreppe und die steinerne Fassade mit den historischen Fenstern samt Beschlägen in den unteren Geschossen erhalten, im Nordteil die in den 1980er-Jahren renovierte Kapelle mit ihrer gewölbten Decke. Die bestehenden Mauerwerkswände waren teils mehrschichtig und drohten beim Abbruch auseinanderzufallen. Mit vorbetonierten und bewehrten Wänden konnte man sie sichern und tragfähig machen. Im Bereich der Fenster ersetzte man die morschen Holzstürze durch solche aus Stahlbeton, und über den ersten beiden Geschossen wurde innerhalb der Fassaden eine Holzkonstruktion in Ständer-Bohlen-Bauweise eingefügt. Diese Konstruktion – Innenwände aus Ständern mit Ausfachungen aus liegenden Bohlen, eingefügt in massives Mauerwerk – wird aus Brandschutzgründen im Kanton Uri seit dem 15. Jahrhundert verwendet und besitzt gegenüber anderen Holzkonstruktionen wie dem Strickbau den Vorteil, dass sie aufgrund der vertikalen Pfosten weniger schwindet. Die Trockenbauweise und die Vorfertigung der Elemente im Tal erlaubten eine kurze Montagezeit auf der Baustelle. Zudem optimiert die Holzkonstruktion als isolierende Schicht das Gebäude energetisch. Der Zwischenraum zwischen Holz und Aussenwänden wurde zusätzlich gedämmt.
Die neu erstellten Tragwerkselemente – die ergänzten Aussenwände und das Treppenhaus, das bis ins 4. Obergeschoss den Süd- vom Nordteil des Gebäudes trennt – sind vor Ort unter teilweise unwirtlichen Witterungsbedingungen konventionell in Stahlbeton erstellt worden. Sie stabilisieren zusammen mit den massigen bestehenden Mauerwerkswänden in den unteren Geschossen das Gebäude. Die Decken über Erd- und 1. Obergeschoss wurden mit Stahlbeton erstellt, deren Auflager befinden sich auf den neuen Innenwänden aus Beton und über eingespitzte Nocken in den Aussenwänden aus Mauerwerk. Die Nocken sitzen in den vertikal durchlaufenden Wandpartien, damit die Fensterstürze nicht zusätzlich belastet werden.
Präzise Ausführung und ständige Kontrolle
Das Gebäude weist im Grundriss und im Schnitt eine durch den Bestand vorgegebene unregelmässige Geometrie auf, was eine grosse Anzahl an Betonieretappen bedingte. Die Rohbauetappen der Holzeinbauten waren örtlich voneinander getrennt; Nord- und Südteil wurden unabhängig voneinander hochgezogen und treffen sich erst im 5. Obergeschoss. Deshalb erarbeiteten die Bauingenieure eine Datei, in der sie alle Geometriedaten verwalteten und die komplexen Zusammenhänge prüften. Über ein durch eine professionelle Bauvermessung erstelltes Messsystem konnten sie die Ist- und Solllagen der Absteck- und Kontrollpunkte ständig miteinander vergleichen und, falls erforderlich, Massnahmen ergreifen.
Vorgefertigtes Innenleben aus Holz
Die neue Holzkonstruktion, die in die massive Hülle gesetzt ist, reicht bis unters Dach (Abb. 11 und 13) und überzeugt durch ihre handwerkliche Präzision. Die Konstruktion ist unbehandelt im Inneren sichtbar und trägt die Eigen-, Auf- und Nutzlasten sowie die Dachlasten bis auf die Stahlbetondecke über dem 2. Obergeschoss auf der Südseite respektive die Stahl-Beton-Verbundträger auf der Nordseite ab. Die im Werk vorfabrizierten Elemente beinhalteten die Tragkonstruktion, die Schalung der Innenverkleidung, die Dämmungen, Beplankungen und Elektroinstallationen sowie die Ausholzungen für die Sanitärgeräte. Sie weisen also einen hohen Vorfertigungsgrad auf – gerechtfertigt durch die geplante kurze Montagezeit von nur zehn Tagen im September, während der mit schlechtem Wetter gerechnet werden musste. Die Vorfabrikation war vor dem Start der Abbrucharbeiten bereits abgeschlossen.
Die vertikal durchlaufenden Ständer in der Holzkonstruktion sind lediglich durch Stirnholzstösse unterbrochen. Indem die Bauingenieure auf die Schichtung von liegendem Holz verzichteten – was schwindanfälliger ist –, werden die Setzungsdifferenzen der Holzeinbauten gegenüber der Betonkonstruktion minimiert (Abb. 14). Das Stützen-Träger-System wird durch eingeschlitzte Bleche und Stabdübel zusammengehalten und durch die sie umfassende Betonkonstruktion stabilisiert. Die gesamte Holztragkonstruktion weist über die Beplankung aus Holzwerkstoffplatten zwar ebenfalls eine eigene Stabilität auf, diese haben die Bauingenieure aber rechnerisch nicht berücksichtigt.
Die Dachkonstruktion besteht aus Pfetten, die über den Hauptachsen der darunter liegenden Holzkonstruktion angeordnet sind. Auf diesen Pfetten wurden Sparren und Schifter montiert (Abb. 15). Die Sparren weisen einen für diese Höhenlage ungewöhnlich grossen Abstand von über einem Meter auf, wodurch die Gauben dazwischengesetzt werden konnten und auf im Anschluss aufwendige Auswechslungen verzichtet werden konnte. Die Sparrenabstände werden durch eine doppelt geführte Dachschalung von je 30 mm Stärke überbrückt, zwischen der sich die Unterdachfolie und die Konterlattung befinden.
Drei Jahre Bauzeit – zwei kleine Zeitfenster
Der Gotthardpass ist etwa ab Anfang Mai bis Mitte Oktober geöffnet, in der restlichen Zeit besteht kein fahrbarer Zugang. Zudem ist in dieser Höhenlage während des ganzen Sommers kurzfristig mit Schneefall zu rechnen. Diese Witterungsverhältnisse bedingten kurze Baufenster für das Gebäude mit seinen hohen architektonischen Anforderungen. Zusammen mit der komplexen Geometrie des Bestandes und den langen Anfahrtswegen stellten dies Rahmenbedingungen dar, die von den Planenden und Ausführenden ein durchdachtes und exaktes Vorgehen und Arbeiten verlangten. Die Umsetzung des Bauvorhabens wurde daher gezielt von Anfang an in zwei je vier bis fünf Monate lang dauernden Etappen in einem Zeitraum von zwei Jahren geplant.
2008, im ersten Jahr, erfolgten der Abbruch sowie die Rohbauarbeiten bis zum winterdichten Dach und provisorischen Verschluss der Fenster. Nach einer Massaufnahme der erstellten Betonkonstruktion wurden die Montageachsen und Koten des Holzbaus vermessungsseitig abgesteckt. Zuerst wurden die Elemente der Südseite montiert und mit der Dachkonstruktion abgedeckt. Eine zweite Gruppe bereitete die Montage auf der Nordseite vor, die ebenfalls in kurzer Zeit erfolgte. Der Zusammenschluss beider Dachseiten im 5. Obergeschoss offenbarte die genaue Arbeit der Beteiligten. Anschliessend verlegten die Ausführenden die Unterdachabdichtung und schlossen diese wind- und wasserdicht an das Mauerwerk an – womit das Bauwerk für den unmittelbar folgenden Winter vorbereitet war. Im zweiten Jahr erfolgten die Fertigstellung der Fassade und der Dacheindeckung sowie der gesamte Innenausbau. Im dritten Jahr waren nur noch kleinere Fertigstellungsarbeiten vorgesehen. Am 1. August 2010 erfolgte die offizielle Eröffnung.
Das einheitliche Bild wiedererlangt
Im Umgang mit dem alten Hospiz zeigt sich die architektonische Grundhaltung von Miller & Maranta, die die Moderne nicht als einen unversöhnlichen Gegensatz zur Tradition begreift, sondern als deren zeitgemässe Fortführung und qualitätvolle Weiterentwicklung. Diese Zuwendung drückt sich in Details wie dem eisernen Handlauf im Treppenhaus ebenso aus wie in den neuen Wandleuchten mit ihrem alpinen Rückbezug (Abb. 16). Die Zimmermannsarbeit im Inneren ist sichtbar und trägt mit ihrem Duft nach Holz noch zur Sinnlichkeit des Baus bei. Auch die Möblierung der Zimmer – die in Alkoven platzierten Betten aus Fichtenholz, die schwarzen Bugholzstühle und die Stehleuchten von Andreas Christen von 1958 – unterstützt die einem Hospiz gerechte archaische Stimmung (Abb. 17). Das Treppenhaus und die Gemeinschaftsräume im massiven Teil des Baus sind mit einem schimmernden Kalkputz versehen, die Nasszellen der Gästezimmer mit einem wasserfesten, schwarzen Anstrich behandelt.
Spürbar wird die verbindende Haltung vor allem auch in der Art und Weise, in der sich das neue Dach auf das alte Hospiz legt. Die Architekten haben Kapelle und Hospiz unter dem auf den Wetterseiten 52 ° steilen Dach mit einer Eindeckung aus Bleibahnen optisch zu einer Einheit zusammengefasst. Grau und schwer ist es, durchbrochen von Dachgauben, die sich wie mit angezogenen Schultern geduckt hervorheben, um dem Wind und dem Schnee nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten (Abb. 2). So liegt eine Selbstverständlichkeit in der architektonischen Gestaltung des neuen alten Hospizes, die den vorhandenen Charakter des Gebäudes unterstützt und stärkt und ihm damit seine ursprüngliche Bedeutung für den Ort zurückgibt.TEC21, Fr., 2011.04.01
[ Jürgen Tietz, Dr., Architekturhistoriker und -kritiker (Architektur) Rolf Bachofner, dipl. Holzbauing. FH, Bachofner GmbH, r.bachofner@bachofner-gmbh.ch (Tragwerk) ]
01. April 2011 Jürgen Tietz, Rolf Bachofner
Sommerfrische, wiederbelebt
Am Ende des Maderanertals im Kanton Uri liegt das Hotel «Maderanertal». Das Ensemble aus dem 19. Jahrhundert ist ein Bauzeuge aus der Frühzeit des Tourismus. Der prekäre Zustand der meist originalen Bausubstanz machte 2009 eine Sanierung notwendig. Planung und Ausführung berücksichtigten die schwer zugängliche Lage der Bauten, die kurzen Zeitfenster und den engen finanziellen Rahmen. Im Sommer 2010 wurde die erste Bauetappe fertiggestellt.
In Amsteg, auf dem Weg zum Gotthardpass, befindet sich eine Abzweigung ins östlich gelegene Maderanertal. Die Strasse führt bis nach Bristen, von dort aus gelangt man zu Fuss in etwa zwei Stunden zur Balmenegg, einer von Wald umgebenen Felsterrasse auf 1349 m ü. M. Hier wurde 1864 auf Initiative von Basler Alpinisten das Hotel «Zum Schweizer Alpenclub» erbaut. Der Name war eine Reverenz an den 1863 gegründeten Schweizer Alpen-Club, ansonsten bestanden aber keine Verbindungen zum SAC. Zunächst entstand das klassizistische Haupthaus, als einfaches Gasthaus mit 19 möblierten Zimmern. Der beginnende Alpentourismus führte schon fünf Jahre später zum Bau des südöstlich gelegenen, luxuriöser ausgestatteten «Engländerhauses» mit 33 Zimmern, das auch eine Bibliothek und einen Pianosalon beherbergte.
Gleichzeitig wurde gegenüber, das Haupthaus flankierend, ein Waschhaus gebaut, dessen Sockelgeschoss später zusätzlich als Bäckerei diente. Damit war die Basis für ein fast städtisch anmutendes Ensemble gelegt: Nach einem Brand im Jahr 1880, der das Haupthaus komplett zerstörte, folgte nicht nur der direkte Wiederaufbau: 1887 wurde eine Kapelle gebaut, in der wegen der zahlreichen englischen Gäste neben katholischen auch anglikanische Gottesdienste gefeiert wurden. In der Folge entstanden weitere Bauten wie die Villa der Hotelierfamilie (ca. 1910), eine Kegelbahn (ca. 1910), ein Teepavillon (1910) und unterstützende Infrastruktur in Form eines Postbüros, einer Arztpraxis, eines Kiosks und eines Coiffeursalons. Ergänzt wurden diese Bauten durch die Aussenanlagen, den Zentralplatz mit Brunnen und Alpengarten und den natürlichen Butzlisee (Abb.1). Die Hotelgäste, unter ihnen illustre Vertreter wie der britische Science-Fiction-Autor H. G. Wells, der deutsche Reichspräsident Paul von Hindenburg oder Friedrich Nietzsche, blieben in der Regel mehrere Wochen. Da bis 1922 keine Strasse nach Bristen existierte, transportierten ortsansässige Träger die Gäste von Amsteg, später von Bristen, in Sänften bis ins Hotel.1 Für einige Gäste gehörte diese Abgeschiedenheit zum Programm: Dokumentiert ist, dass der Bristener Pfarrer Rupert Schäffeler 1916 Massnahmen gegen das grassierende Nacktwandern im Maderanertal verlangte. Bis in die 1960er-Jahre blieb das Hotel im Besitz der Erbauerfamilie Indergand, anschliessend wurde es dreissig Jahre vom Bristener Bergführer Hans Z’graggen geführt. 1967/68 fanden die letzten grösseren Bautätigkeiten statt: Der neue Besitzer erweiterte das Restaurant talseitig um eine Gartenwirtschaft. Es folgten eine Zeit der Stagnation und die Umbenennung zum Hotel «Maderanertal».
Seit Mitte der 1990er-Jahre wird das Hotel von Anna Fedier-Tresch, die zuvor als Angestellte im Hotel wirkte, und ihrem Sohn Tobias Fedier geführt. Durch fehlende Investitionen in der Vergangenheit existierte zwar noch ein Grossteil der originalen Bausubstanz, allerdings befand sich diese teilweise in so schlechtem Zustand, dass im Sommer 2009 eine Sanierung anstand.
Stufenweiser Planungsprozess
Initiiert wurde die schrittweise Erneuerung des Hotelensembles vom Schweizer Heimatschutz, der 2002 im Zuge des Schulthess-Gartenpreises unter dem Motto «Historische Gar- tenanlagen» auf das Ensemble aufmerksam wurde. Schnell war klar, dass eine isolierte Restaurierung der Aussenanlagen wenig sinnvoll war, daher wurde die Altdorfer Architektin Margrit Baumann beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Gesamtanlage durchzuführen. Nachdem ein realistisches Konzept vorlag, das auch die Eigentümerfamilie überzeugte, übernahm der Heimatschutz das Patronat der Sanierung. Planung und Ausführung erfolgten durch das Architekturbüro Margrit Baumann. Aufgrund der kurzen Bauphasen – das Hotel ist jeweils von Juni bis Oktober geöffnet, gebaut werden kann von Ende April bis zum Saisonanfang sowie vom Saisonende bis zum ersten Schneefall – wurde das Projekt in zwei Teile mit mehreren Unteretappen aufgeteilt (vgl. Kasten S. 27). Diese zeitliche Staffelung korrespondiert auch mit der Finanzierung des Projekts, das auf Spenden angewiesen ist. Im Sommer 2010 konnte der erste Teil der ersten Etappe fertiggestellt werden. Diese Phase umfasste die Instandstellung der Gartenanlage sowie die Renovation des ersten Obergeschosses und den Einbau von sanitären Einheiten im 1. OG und im Saalgeschoss. Zudem konnten alle Häuser neu mit Strom und einer eigenen Unterverteilung versorgt werden.
Vorhandenes Nutzen, ergänzen, auffrischen
Im Zentrum des Sanierungskonzepts steht eine sanfte Renovation. Wichtig war den Beteiligten, mit den vorhandenen Mitteln eine hochwertige, aber der Umgebung angepasste Qualität in die Interieurs zu bringen. Das Haupthaus, ein mit Holzschindeln verkleideter fünfgeschossiger Holzständerbau, wird axial von der Platzseite her erschlossen, die Korridore liegen in der Längsachse. Die Grössen der auf drei Geschosse verteilten 23 Hotelzimmer entsprechen dem durch den Ständerbau vorgegebenen Raster.
Zunächst wurde die unter den Umbauten der letzten Jahrzehnte liegende ursprüngliche Bausubstanz freigelegt: Holzböden und Papiertapeten. Letztere stammen aus verschiedenen Jahrzehnten – wo möglich, wurden sie restauriert, stellenweise auch ersetzt. Die neuen Tapeten sind wie der Bestand mit Tier- und Pflanzenmotiven bedruckt (Abb. 9). Farblich entschied man sich bei Decken, Türen, Fenstern und Sockelleisten für Anstriche in warmen, hellen Tönen, die auf der Tonalität der vorgefundenen Tapeten aufbauen. Um Risse zu vermeiden, wurden die Wände des Korridors mit einem Putz mit hohem Kalkanteil versehen, der die Bewegungen des Holzbaus besser aufnehmen kann als ein Gipsputz. Das Prinzip der Auffrischung und Instandsetzung des Bestehenden wurde auch bei den Möbeln – Antiquitäten, meist aus Nussbaumholz – und Accessoires wie Waschschüsseln und -krügen angewendet. Eine weitreichende Massnahme bestand im Einbau eines Etagen-Baderaums mit einer Dusche, einem Lavabo und zwei WC. Dafür wurde der ursprüngliche Zugang zu den WC vom Treppenhaus in den Korridor verlegt und eine Wand versetzt (Abb. 6). Dieses Vorgehen erlaubte nicht nur die Schaffung eines grossen Baderaums, das Treppenhaus konnte dadurch auch als separater Brandabschnitt geschlossen und mit einer Brandabschnittstür versehen werden. Die Nasszellen bestehen aus in die Bausubstanz eingestellten Kuben aus beschichteten Kunstharzplatten. Neu ist jedes Geschoss elektrifiziert, die Leitungen konnten unsichtbar in der minimal abgehängten Decke im Flur verlegt werden. Die Elektroleitungen wurden vertikal durch ehemalige Cheminées gelegt, sodass keine neuen Schächte gezogen werden mussten.
Aussenanlagen mit Gletscherblick
Neben den Massnahmen im Haupthaus konnte in der ersten Etappe auch der historische Garten restauriert werden. Im Detail sah das Konzept vor, die Weg- und Platzränder nachzuarbeiten, teilweise auch neu zu definieren sowie die mittlerweile bewachsenen Kiesbeläge zu sanieren und zu ergänzen. Unerwünschte Materialien wie Betonplatten und unpassende oder verwilderte Sträucher und Bäume wurden entfernt, insbesondere im Bereich des ehemaligen Teehauses. Der Hof mit dem zentral angeordneten Brunnen erhielt seine Bedeutung als Mittelpunkt der Hotelanlage zurück. Ein neuer Kiesbelag und die Wiederbelebung der den Brunnen einfassenden Rabatten als mit Blütenstauden und Steingartengewächsen be- pflanztes Alpinum machen die Qualität der ursprünglichen Anlage wieder spürbar. Der Standort des 1978 abgerissenen Teehauses wurde mit Natursteinen und einem neuen Kiesrasen markiert, und eingefallene Natursteinmauern wurden wieder aufgebaut. Ein Rundweg um den Kapellenhügel bietet wie früher Aussicht auf den – jetzt allerdings weiter entfernt liegenden – Hüfigletscher. Als zweiter, eher privater, Aussenraum dient die Aussichtsterrasse mit Blick ins Tal. Sie konnte ebenfalls instand gesetzt und mit einem Kiesrasen versehen werden.
Projektgerechtes Vorgehen
Die abgelegene Lage der Baustelle erforderte eine besondere Arbeitsweise: So fand die Kommunikation mit den Handwerkern hinsichtlich der Ausführung ausschliesslich über Raster und Bezugshöhen statt, da absolute Masse in dem fast 150-jährigen Bau nicht existierten und zwischen Baustelle und Architekturbüro im Zweifelsfall spontan auch nicht eruierbar waren. Auch der enge finanzielle Rahmen, zunächst als Korsett empfunden, führte zu einem sehr bedachten Vorgehen, durch das die nötigen Eingriffe sehr gezielt geplant wurden. Ein Beispiel: Ursprünglich waren zwei Baderäume pro Etage geplant, aus finanziellen Gründen konnte aber nur einer realisiert werden. Im Nachhinein erwies sich der Verzicht als durchaus sinnvoll: Da das Hotel das Wasser aus dem von Gletscherwasser gespeisten Butzlisee bezieht, wäre bei zu vielen Sanitärräumen im Sommer möglicherweise mit Wasserknappheit zu rechnen. Durch die aktive Mitarbeit der Bauherrschaft bei den Sanierungsarbeiten konnten zudem nicht nur finanzielle Einsparungen erzielt werden. Die langen Winter im Maderanertal erfordern einen sorgfältigen Umgang mit der Bausubstanz. Die Mitarbeit an der Sanierung sensibilisierte die Eigentümerfamilie für die Bedürfnisse der Bauten, was sich in erhöhter Sorgfalt im Umgang mit der Substanz ausdrückt.
Blick zurück nach vorne
Die noch anstehenden Sanierungsarbeiten können mit den Erfahrungen aus der ersten Etappe angegangen werden. Es existieren Pläne, den Zentralplatz wie zu seinen Blütezeiten als «städtischen» Platz zu reaktivieren, mit öffentlichen Nutzungen in den Erdgeschossen wie einem Ausstellungsraum im Engländerhaus, einer Sauna im Ökonomiegebäude und Zugang zu Restaurant und Speisesaal im Haupthaus. Das abgelegene Hotel an der Schnittstelle zwischen landwirtschaftlich genutzter Natur und wilder Landschaft dient dann nicht mehr illustren Gästen als wochenlange Sommerfrische, sondern bietet einen Rückzugsort für all jene, die einige Tage in die Atmosphäre und den Rhythmus des 19. Jahrhunderts eintauchen möchten. Mit der Sanierung kehrt das ehemalige Kurhotel zurück zu seinen Ursprüngen als einfaches Berghaus – und das ist an diesem Ort ohnehin viel angebrachter.TEC21, Fr., 2011.04.01
01. April 2011 Tina Cieslik