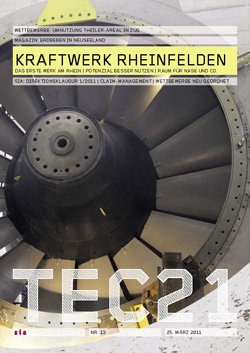Editorial
Der Plan, «die Wasserkräfte des Rheins an ihrer günstigsten Stelle, nämlich bei Rheinfelden, in grossartigem Masse der Industrie nutzbar zu machen»1, führte Ende des 19. Jahrhunderts zum Bau des ersten grossen Flusskraftwerks von Europa. Das Kraftwerk Rheinfelden prägt die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz und Süddeutschlands bis heute. «Das erste Werk am Rhein» blickt auf die Entstehungsgeschichte und die jetzt abgebrochenen Bauwerke dieses Meilensteins der Elektrizitätswirtschaft zurück. Die Anlage Rheinfelden, deren Konzession vor über 20 Jahren erneuert werden musste, konnte nur einen Teil des verfügbaren hydraulischen Potenzials nutzen. Die Verlängerung der Konzession wurde an die Auflage geknüpft, die Energieproduktion so weit wie möglich zu erhöhen, was zwangsläufig einen Neubau bedingte. Wie das neue Kraftwerk Rheinfelden mehr Energie gewinnt und welche Herausforderungen beim Bau zu meistern waren, wird in «Potenzial besser nutzen» erläutert.
Die erneuerte Konzession ist mit zahlreichen ökologischen Ausgleichsmassnahmen verknüpft; die wichtigste ist die Schaffung eines naturnahen Umgehungsgewässers für die Fische. Dafür bietet die jetzt stillgelegte alte Kraftwerksanlage ideale Voraussetzungen; aus dem Betonkanal wird ein beschauliches Flüsschen, das funktionslose Maschinenhaus wird rückgebaut. Was die Fische (und andere Tiere) ab diesem Herbst bei Rheinfelden antreffen werden, ist in «Raum für Nase und Co.» zu lesen.
Die Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen in Rheinfelden sind aus heutiger Sicht vorbildlich, obwohl bei Beginn der Projektierungsarbeiten teilweise die gesetzlichen Grundlagen dafür noch fehlten. Deshalb ist das neue Kraftwerk wiederum, wie vor über einem Jahrhundert das alte Werk, eine Pionieranlage.
Ein Wermutstropfen fällt aber doch noch ins klare Fischgewässer: Die kulturhistorische Bedeutung des alten Kraftwerks war bei der Projektierung des Umgehungsgewässers kein Thema: Der Rückbau aller Anlageteile war im Hinblick auf die Renaturierung schon beschlossen und durch alle Instanzen bewilligt, als erste Bedenken aus denkmalpflegerischer Sicht geäussert wurden. Die Verleihung des Heimatschutzpreises 2009 des Aargauer Heimatschutzes an die IG Steg, die für die Erhaltung des alten Kraftwerks kämpfte, konnte daran auch nichts mehr ändern. Aus der unglücklichen Konkurrenzsituation von Natur- und Heimatschutz in Rheinfelden ist die Lehre zu ziehen, dass in Zukunft beide Interessengruppen von Anfang an in die Planung einzubinden sind, um weitere Pionieranlagen ohne Substanzverluste realisieren zu können.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Umnutzung Theiler-Areal in Zug
12 MAGAZIN
Erdbeben in Neuseeland
18 DAS ERSTE WERK AM RHEIN
Aldo Rota Das alte Kraftwerk Rheinfelden stand am Anfang der grosstechnischen Nutzung der Wasserkraft und der elektrischen Kraftübertragung in der Schweiz. Der Beitrag ist eine Reverenz an diesen über hundertjährigen Zeugen der Technikgeschichte.
24 POTENZIAL
besser nutzen
Daniela Dietsche Seit Anfang 2011 wird die Wasserkraft in Rheinfelden optimal genutzt. Durch das höher gestaute Oberwasser und die Wasserspiegelabsenkung im Unterwasser konnte das nutzbare Gefälle vergrössert werden.
28 RAUM FÜR NASE UND CO.
Claudia Carle Als wichtigste ökologische Ausgleichsmassnahme für den Bau des neuen Kraftwerks wird ein Aufstiegs- und Laichgewässer gebaut, das in dieser Grösse einmalig ist.
34 SIA
Direktionsklausur 1/2011 | Veranstaltungen und Aufruf | Claim-Management | Drei Register Betonstahl | Wettbewerbe neu geordnet
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
Das erste Werk am Rhein
Das Kraftwerk Rheinfelden war das erste und lange das grösste Flusskraftwerk in Europa. Mit diesem mutigen Wurf begann die Nutzung der Wasserkräfte des Rheins. Jetzt ist das Werk ersetzt worden und nimmt mit seinem Umgehungsgewässer wieder eine Vorreiterrolle ein. Gegenwärtig wird das alte Maschinenhaus abgebrochen. Ein Nachruf auf eine Pioniertat.
Wie kam es dazu, dass an dieser Stelle nur noch rückblickend über diese bemerkenswerte Anlage berichtet werden kann? Paradoxerweise hat die in den letzten Jahren stark gestiegene Bedeutung der Wasserkraft in der europäischen Energiepolitik das Schicksal des alten Werks besiegelt. Die beschriebene Anlage nutzte das verfügbare hydraulische Potenzial nämlich, dem damaligen Stand der Technik entsprechend, nur teilweise aus. Die politischen Instanzen, die für die Erneuerung der 1898 für die Dauer von 90 Jahren erteilten Konzession zuständig sind, wollten hingegen die erneuerbare Energiequelle Wasserkraft dem aktuellen Stand entsprechend fördern. Sie machten die Erneuerung der Konzession von der effizienteren Nutzung der verfügbaren Wasserkraft abhängig. Ein Weiterbetrieb der bestehenden Anlagen hätte die energiepolitische Position der Wasserkraft nicht wesentlich verbessert. Daher ist der Totalersatz des Kraftwerks, verbunden mit zeitgemässen ökologischen Ausgleichsmassnahmen, gesamthaft betrachtet die ökologisch nachhaltigste Massnahme, auch wenn die aktuellen Eingriffe in die natürliche Umgebung teilweise schmerzhaft erscheinen. Dass dabei kein Platz mehr für das alte Kraftwerk war, ist kulturhistorisch bedauerlich, in Anbetracht der Rahmenbedingungen und Anforderungen von Ökologie und Ökonomie aber zumindest nachvollziehbar. Geschichte und Technik des alten Kraftwerks Rheinfelden sind aber weiterhin von Interesse und werden im Folgenden rekapituliert.
Beste natürliche Voraussetzungen
Vom Ausfluss aus dem Bodensee bei Stein am Rhein bis zur Landesgrenze bei Basel weist der Hochrhein auf einer Länge von 140 km einen Höhenunterschied von 145 m auf, was einem mittleren Gefälle von 1 ‰ entspricht. Dieses Gefälle ergibt in Verbindung mit der erheblichen Wasserführung des Rheins ein beachtliches hydraulisches Potenzial. Vor über einem Jahrhundert konnte für die ersten Kraftwerke am Rhein der günstigste Standort aufgrund der natürlichen Gegebenheiten frei gewählt werden.
Mit Ausnahme des Sprungs beim Rheinfall, der ab 1890 durch ein kleineres Kraftwerk teilweise genutzt wurde, ist das oben erwähnte Gefälle näherungsweise gleichmässig über die Flusslänge verteilt. Stromaufwärts der mittelalterlichen, am linken Rheinufer gelegenen Schweizer Stadt Rheinfelden, auf Höhe der Grenze zwischen den deutschen Gemeinden Nollingen und Karsau[1] am rechten Ufer, quert jedoch eine Muschelkalkrippe das Flussbett des Rheins auf seiner gesamten Breite praktisch senkrecht zur Fliessrichtung. Oberwasserseitig staute dieses natürliche Hindernis von alters her einen ruhigeren, etwas tieferen Flussabschnitt, den Beugger See, auf. Stromabwärts dieser Schwelle fliesst der Rhein auf einem kurzen Abschnitt mit grossem Gefälle, dem sogenannten Gwild (Abb. 1 und 4), turbulent über Muschelkalk und Kiesbänke ab. Vom Beugger See bis zur Brücke von Rheinfelden weist der Rhein auf 2.4 km Länge ein Gefälle von maximal 7.5 m bei Niedrigwasser auf.[2] Erste Projektideen für die Nutzung der Rheinfelder Stromschnellen entstanden bereits ab 1871,3 scheiterten aber an lokalen Widerständen und an der Finanzierung. Ein Schweizer Firmenkonsortium plante 1889 erstmals die Produktion und Verteilung elektrischer Energie in grossem Stil und erwarb eine Konzession zwischen dem Beugger See und der Brücke von Rheinfelden. Der Aarauer Ingenieur Olivier Zschokke (1826–1898) entwarf zunächst eine Anlage zur Nutzung der gesamten Konzessionsstrecke. Mit geschätzten Baukosten von 12 Mio. Mark erwies sich dieses erste Projekt Zschokkes jedoch als nicht finanzierbar.
Traditionelles Mühlenprinzip
1893 wurde das Projekt durch Zschokke redimensioniert: Die genutzte Flusslänge wurde halbiert und auf die eigentlichen Stromschnellen begrenzt, wodurch die Baukosten praktisch halbiert wurden und das Werk in eine realistische Grössenordnung rückte. Auch in seinem zweiten, redimensionierten Projekt griff Zschokke auf das traditionelle Mühlenprinzip mit Wehranlage, Oberwasserkanal und Maschinenhaus am Ufer zurück (Abb. 1 und 4). Bei später erstellten Kraftwerken am Hochrhein wie Laufenburg (Betriebsaufnahme 1914) oder Eglisau (1920; TEC21 24/2005) und auch beim neuen Kraftwerk Rheinfelden (vgl. Abb. 2 und «Potenzial besser nutzen», S. 24) sind Wehranlage und Maschinenhaus zusammengefasst und in einer Flucht quer ins Flussbett hineingebaut. Trotz der einfachen und konventionellen Disposition liessen sich weiterhin keine Investoren finden. Der Hauptkritikpunkt war die ungünstige Anordnung des Maschinenhauses zwischen Oberwasserkanal und Uferböschung.[4] Die vom Konsortium gegründete Vorbereitungsgesellschaft liess darauf Zschokkes Projekt durch Otto Intze (1843–1904) überarbeiten. Intze, der an der TH Aachen lehrte, galt als der führende europäische Wasserbauingenieur. Er konzipierte die Zentrale neu und positionierte das Maschinenhaus zwischen Oberwasserkanal und Flussbett[5] (Abb. 1 und 4). Durch diese Vereinfachungen wurden die Kosten gesenkt, die Leistung erhöht und gleichzeitig die Betriebssicherheit verbessert, was den technischen und wirtschaftlichen Durchbruch des Projekts bedeutete. Dem Konsortium trat jetzt die bei der Finanzierung von Elektrizitätswerken federführende Deutsche Bankengruppe um Emil Rathenau (1838–1915), den Gründer der AEG, bei. 1894 wurde in Berlin die AG Kraftübertragungswerke Rheinfelden (KWR, heute Energiedienst) gegründet. Am 1. Mai 1895 begannen die Bauarbeiten, im Sommer 1897 konnten bereits 8 von 20 Turbinen in Betrieb genommen werden. Im Sommer 1899 wurden mit dem Wehr und den Schützen (Abb. 7 und 8) die letzten Bauwerke des Kraftwerks Rheinfelden fertiggestellt. Die Baukosten betrugen inkl. Maschinen ca. 8.6 Mio. Mark.
Fischtreppe und Flossgasse
Auf der eingangs erwähnten Muschelkalkrippe wurde der Rhein über die gesamte Breite durch ein niedriges, senkrecht zur Fliessrichtung angeordnetes, aus Bruchsteinen aufgemauertes Wehr gestaut (Abb. 1 und 4). Die breite Krone des etwa 198 m langen Wehrs lag auf der Kote 271.60 m ü. M., was der Staukote des gestauten Beugger Sees bei Niedrigwasser entsprach. Auf der Wehrkrone waren acht je ca. 18 m breite Tafelschützen von 1.3 m Höhe aufgestellt. Am linken, schweizerischen Ufer war zwischen der letzten Tafelschütze und der Uferbefestigung lediglich noch eine schmale Fischtreppe angeordnet. In Richtung badisches Ufer schlossen an die erste Tafelschütze zwei breitere, parallele Fischtreppen und die in der Konzession vorgeschriebene, 20 m breite, leicht geneigte Flossgasse an.[6] Durch diesen Durchlass ohne Absperrorgane, dessen Sohle tiefer als die Staukote des Wehrs lag, sowie die Fischtreppen floss permanent und unabhängig vom Kraftwerksbetrieb mindestens die in der Konzession vorgeschriebene Restwassermenge von 50 m³ / s ins «Gwild» ab. Zwischen der Flossgasse und dem badischen Ufer, im Bereich der grössten Wassertiefe, waren drei mit Schützen verschliessbare, je 10 m breite und 5 m hohe Grundablässe angeordnet (Abb. 4, 7 und 8). Diese im Normalbetrieb geschlossenen Bauwerke dienten der Entleerung des Flussbetts, insbesondere zum Austrag des reichlich anfallenden Geschiebes, und wirkten bei der Ableitung grösserer Hochwasser mit. Die für den Betrieb der Schützen erforderlichen, als Fachwerke ausgeführten Apparatebrücken über dem Wehr waren während eines Jahrhunderts die charakteristischen, landschaftsprägenden Elemente der sonst unauffälligen, mit der hügeligen Landschaft verschmelzenden Kraftwerksanlagen. Am rechten, badischen Ufer lag schiefwinklig zur Flussrichtung der trompetenförmig leicht aufgeweitete Einlauf des Oberwasserkanals (Abb. 4). Zwischen der Flossgasse und den Grundablässen war oberwasserseitig ein als Tauchwand ausgebildetes Leitwerk aus Stahl angeordnet, um den Flossverkehr zu kanalisieren sowie Schwemmholz und Eisgang vom Einlauf des Oberwasserkanals fernzuhalten (was bei Hochwasser nicht immer ausreichte). Im Übergangsbereich vom Grundablass zum Oberwasserkanal waren auf der Wehrkrone noch vier kleinere, nicht regulierbare Überläufe angeordnet.
Der in Stampfbeton ausgeführte, rund 880 m lange, 50 m breite und 4.50 m bis 5.40 m tiefe Oberwasserkanal verlief am rechten Ufer parallel zum Flussbett des Rheins. Durch diesen Kanal mit einem Gefälle von 0.6 ‰ floss die maximale Triebwassermenge von 600 m³/s mit einer Geschwindigkeit von 2.5 m/s zum Maschinenhaus. Die Kanalwand war auf 200 m Länge als Überlauf zum Rhein ausgebildet. Am Einlauf des Kanals verhinderte ein quer zur Strömungsrichtung angelegter Grobrechen den Eintrag von Schwemmholz. Eine parallel zum Rechen angelegte Rinne in der Kanalsohle mit Spülschütze wirkte als Geschiebesammler. In den ersten Betriebsjahren erforderte diese Vorrichtung einen grossen Unterhaltsaufwand, da man das Ausmass des Kieseintrags unterschätzt hatte. Nach der Betriebsaufnahme der Oberliegerwerke am Rhein nahm die Beanspruchung des Kiesfangs rasch ab.
Das 146 m lange, in Stampfbeton und Mauerwerk erstellte, mit gelblichen Hausteinen verkleidete Maschinenhaus schloss den Oberwasserkanal parallel zum Rhein ab (Abb. 5). Im Fundament des Gebäudes waren 20 je 5.5 m breite Turbinenkammern angeordnet, die einzeln durch zweiflüglige Drehtore gegen den Oberwasserkanal abschliessbar waren (Abb. 6, links). Unterwasserseitig konnten die Turbinenkammern mit Zugschützen und Dammbalken gegen den Rhein abgeschlossen werden. Die Einläufe der Turbinenkammern waren durch einen gemeinsamen, um 45° geneigten Feinrechen im Oberwasserkanal geschützt (Abb. 6, links).
Anpassungsfähige Turbinen
In den Turbinenkammern waren ursprünglich 20 vertikalachsige Francisturbinen mit je acht Laufradkränzen eingebaut (Abb. 6, Mitte). Diese Bauart wurde von der Firma Escher, Wyss & Cie. in Zürich eigens für das Kraftwerk Rheinfelden entwickelt. Das nutzbare Gefälle zwischen Ober- und Unterwasserspiegel schwankte je nach Wasserführung des Rheins zwischen 3.20 m und 6.50 m, eine konstante Leistung der Maschinen war nur mit einer anpassungsfähigen Steuerung der Wasserzufuhr zu den Turbinen einzuhalten.[7] Allerdings scheint sich die Lieferfirma mit der ehrgeizigen Konstruktion etwas übernommen zu haben, denn mehrmonatige Verspätungen bei der Lieferung der Turbinen hatten spürbare Verzögerungen des Bauprogramms zur Folge.
Je nach verfügbarem Gefälle leistete jede Turbine zwischen 800 und 1200 PS, sodass die elektrische Gesamtleistung der Zentrale mit 20 Generatoren zwischen 12 MW und 18 MW betrug (Abb. 3). Acht Turbinen trieben Wechselstromgeneratoren für die allgemeine und industrielle Versorgung an,[8] die restlichen Maschinengruppen produzierten Gleichstrom mit niedriger Spannung (100 V bis 800 V), der an die in der Umgebung angesiedelte elektrochemische Industrie (u.a. ein Aluminium- und ein Karbidwerk) abgegeben wurde. 1918 produzierte das Werk etwa 120 Mio. kWh elektrische Energie.
Die Wasserrückgabe erfolgte ohne Unterwasserkanal direkt von den Turbinenkammern in den Rhein (Abb. 5). Am Ende des Oberwasserkanals waren ein 6 m breiter, mit einer Schütze verschliessbarer Grundablass sowie eine kleine Bootsschleuse angeordnet. Eine dreifeldrige Stahlfachwerkbrücke mit gemauerten Flusspfeilern stellte eine einspurige Strassenverbindung zwischen der Zentrale und dem Schweizer Ufer her und trug ursprünglich auch die Übertragungsleitungen in die Schweiz. Eine kleinere Kabelbrücke leitete die Energie vom Maschinenhaus über den Oberwasserkanal zur Schaltanlage am badischen Ufer. Zwischen 1930 und 1935 wurden 14 der ursprünglichen Francisturbinen durch acht modernere Kaplanturbinen und sechs Propellerturbinen (Kaplanturbinen mit nicht verstellbaren Schaufeln) ersetzt. Dadurch erhöhte sich die installierte Kraftwerksleistung auf 25.7 MW und die mittlere Jahresproduktion auf 185 Mio. kWh. Die restlichen Maschinengruppen wie auch die gesamten Bauwerke und wasserbaulichen Installationen blieben bis zum Rückbau der Anlage (Abb. 2) weitgehend unverändert in Betrieb.TEC21, Fr., 2011.03.25
Anmerkungen
[1] Diese Landgemeinden sind heute in der wesentlich grösseren, seit dem Kraftwerksbau neu entstandenen deutschen Stadt Rheinfelden aufgegangen
[2] Das Längsprofil des Rheins weist stromaufwärts bei Laufenburg eine weitere deutliche Rippe auf, die sich für die Energieerzeugung eignet. Ein Jahrzehnt später wurde dort das zweite grosse Kraftwerk am Hochrhein erstellt
[3] Da die elektrische Kraftübertragung noch nicht praktisch einsatzfähig war, sahen die ersten Projekte eine mechanische Kraftübertragung mit umlaufenden Seilen vor
[4] Damit sollte die Länge der Übertragungsleitungen zu den unmittelbar über der Böschung geplanten Industriebetrieben minimiert werden. Dafür mussten wegen der engen Platzverhältnisse Ober- und Unterwasser im Kanal auf zwei Ebenen übereinander geführt und die Leistung durch die stattliche Anzahl von 50 kleineren Turbinen erbracht werden
[5] Am neuen Standort war auch Platz für grössere Maschinen vorhanden, sodass nur noch 20 Turbinen vorgesehen waren. Die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Übertragungsleitungen waren zu dieser Zeit so weit verbessert worden, dass die Leitungslänge vom Werk zu den Verbrauchern nicht mehr entscheidend war, was eine freiere Wahl des Standorts des Maschinenhauses ermöglichte
[6] Die Holzflösserei auf dem Rhein war seinerzeit noch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
[7] Da noch kein Verbundnetz existierte, war die Nutzung von Spitzenleistungen für die mehrheitlich industriellen Energiebezüger weniger wichtig als ein konstantes Leistungsangebot. Mit Schiebern konnte das Triebwasser je nach verfügbarem Gefälle so auf die einzelnen Laufräder einer Turbine verteilt werden, dass ihre Gesamtleistung in einer gewissen Bandbreite konstant blieb. Die Anpassung der Produktion in Zeiten geringer Wasserführung war hingegen einfacher: Die grosse Anzahl gleicher Turbinen ermöglichte es, den Wasserbedarf der Zentrale durch Abschalten einzelner Maschinengruppen zu reduzieren
[8] Das Versorgungsgebiet erstreckte sich bis in den Schwarzwald und ins Elsass
Literatur
– Wolfgang Bocks: Perspektiven mit Strom. Zum 100-jährigen Bestehen der Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG. Rheinfelden/Baden, 1994
– Wasserkraftwerke der Schweiz. Schweiz. Wasserwirtschaftsverband: Verbandsschrift Nr. 11, Zürich 1925
– Die Kraftübertragungswerke in Rheinfelden. Schweizerische Bauzeitung, 17/18 (1891) S. 66–67
– Schweizerische Bauzeitung, 27/28 (1896), S. 1–3, S. 28–31, S.38–41, S. 59–60
– Franz Prášil: Die Turbinen der Kraftübertragungswerke Rheinfelden. Schweizerische Bauzeitung, 33/34 (1899), S. 127–131
25. März 2011 Aldo Rota
Potenzial besser nutzen
Das neue Wasserkraftwerk in Rheinfelden wird im September 2011 offiziell eingeweiht. Es besteht im Wesentlichen aus einem Maschinenhaus am linken Ufer und einem quer zum Fluss errichteten Stauwehr auf der gleichen Achse. Die Anlage erzeugt bei Vollauslastung dreimal so viel Energie wie das alte Kraftwerk. Technische, logistische und ökologische Herausforderungen begleiteten die Planung und den Bau des deutsch-schweizerischen Projekts.
Das Wasserkraftwerk Rheinfelden liegt am Hochrhein an der Grenze zwischen dem Kanton Aargau und Baden-Württemberg. Im Jahr 1988 lief die Konzession für das erste Kraftwerk am Rhein ab (vgl. «Das erste Werk am Rhein», S. 18). Daraufhin erteilten der schweizerische Bundesrat und das Regierungspräsidium Freiburg eine Konzession für weitere 80 Jahre. Diese erlaubte, das alte Kraftwerk zunächst weiterzubetreiben. Parallel dazu sollte jedoch eine neue Anlage gebaut werden, um die Nutzung der regenerativen Energien zu intensivieren und die Energieproduktion zu erhöhen. In der Konzession wurde festgelegt, dass die turbinierte Wassermenge von 600 m³/s auf 1500 m³/s vergrössert und die Jahresproduktion von 185 Mio. kWh auf 600 Mio. kWh erhöht wird. Dafür wurde die Vergrösserung des nutzbaren Gefälles durch einen Höherstau im Oberwasser und eine Eintiefung im Unterwasser gestattet.
Verändertes Landschaftsbild in der Rheinsohle
Da sich ein Neubau unweigerlich auf Natur und Landschaft auswirkt, wurde für das Neubauprojekt in Rheinfelden eine zweistufige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach Schweizer Gesetz angewendet. In Deutschland gab es 1985 dazu noch keine Gesetzgebung. Im Rahmen dieser UVP wurden Auswirkungen des Vorhabens im Detail untersucht, und als wichtigste ökologische Auflage wurde festgelegt, dass mindestens die Hälfte der Gwildfläche biologisch funktionsfähig erhalten bleiben muss. Das sogenannte Gwild ist eine der charakteristischen felsigen Stromschnellen des Hochrheins. Bei Niedrigwasser nutzten unter anderem Zugvögel dieses Gebiet zum Übernachten. Durch die Ausbaggerung der Rheinsohle für die Eintiefungsrinne im Unterwasser gingen rund 46 % des landschaftsprägenden Gwilds verloren. Um diesen Eingriff zu kompensieren, wurden 65 Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen erarbeitet. Die zentrale Massnahme ist das Aufstiegs- und Laichgewässer, das derzeit im ehemaligen Oberwasserkanal erstellt wird (vgl. «Raum für Nase und Co.», S. 28). Das Umgehungsgewässer wurde mithilfe von Modellversuchen gestaltet. Dabei wurde festgestellt, dass aufgrund des benötigten Gefälles das alte Maschinenhaus weichen muss. Beim Planfeststellungsverfahren in den 1990er-Jahren musste man daher zwischen Denkmalschutz und Ökologie abwägen. Überlegungen, das bestehende Gebäude zu erhalten und beispielsweise den Fluss durch die ehemaligen Turbinenkammern zu führen, wurden aufgrund der schlechten Bausubstanz und der hohen Kosten nicht weiterverfolgt. Die Abbrucharbeiten haben inzwischen begonnen. Die alte Anlage wird bis Juni 2011 rückgebaut.
Hydraulik als zentrales Planungsinstrument
Um das geplante Kraftwerk hydraulisch zu prüfen und zu optimieren, wurden von 1992 bis 1994 an der Universität Karlsruhe Modellversuche durchgeführt. Wichtige Randbedingung war, dass die bestehende Anlage so lange Strom liefert, bis zwei der neuen Turbinen in Betrieb sind. Das bestehende Kraftwerk wurde daher in das Modell eingebaut. Vorgängige langjährige Wasserspiegelmessungen halfen, das Modell zu eichen. Die Versuche bestätigten, dass der Standort für die neue Kraftwerksanlage in Bezug auf die Hydraulik optimal gelegt wurde (Abb. 2). Gemäss Konzession musste das Oberwasser um 1.40 m erhöht werden.
Diese Stauerhöhung erfolgte im Oktober 2010, womit ein maximales Gefälle von 9 m erreicht wurde. Viele Optimierungsuntersuchungen mussten für die Anströmung des Maschinenhauses, die Strömungsverhältnisse in den Turbinenkammern und deren Geometrie durchgeführt werden.
Eine weitere Untersuchung im Modell war der Nachweis der Stauwehrkapazität auf der Grundlage, dass ein Hochwasser von 5400 m³/s abgeführt werden kann. Es zeigte sich, dass ein Stauwehr mit sieben Stauwehrfeldern und einer Breite von 200 m diese Anforderung erfüllen kann. Das Stauwehr liegt auf der gleichen Achse wie das Maschinenhaus und wurde quer zum Fluss errichtet. Drei der Wehrschütze wurden zur Feinregulierung mit Klappen versehen. Im Anschluss an das Maschinenhaus beginnt im Unterwasser eine 100 m breite und 1800 m lange Abflussrinne, in der das turbinierte Wasser abgeführt wird. Sie ist zu Beginn rund 10 m tief und geht dann zurück auf 3 bis 4 m. Die optimale Abströmung und die Dimensionierung der Eintiefung ergaben sich ebenfalls aus Modellversuchen. Durch diese Eintiefung wird der mittlere Wasserspiegel unterhalb des Kraftwerks, im Bereich des Gwilds, um etwa 50 cm gegenüber dem ursprünglichen Mittelwasserstand abgesenkt. Dies führt dazu, dass Teile des heutigen Flussgrunds sichtbar werden und die Funktion der Stromschnellen übernehmen. Ein Dotierablass (mit Turbine) im Trennpfeiler zwischen Maschinenhaus und Wehr hat die Aufgabe, die verbleibende Gwildfläche mit der in der Konzession vorgeschriebenen Restwassermenge von 30 m³/s zu bewässern.
Etappierte Bauweise
Da für den Bau der Anlage die Ableitbarkeit eines Bauhochwassers von 4000 m³/s nachgewiesen werden musste, war eine etappierte Bauweise nötig. Man untersuchte am Modell verschiedene Varianten, um Grösse, Form und Anzahl der Baugruben festzulegen. Als beste Lösung stellte sich eine Ausführung in drei Abschnitten heraus (Abb. 3). Sie engte den Flussquerschnitt so wenig wie möglich ein. Zunächst wurden die Stauwehrfelder 5 bis 7 und im Anschluss die Stauwehrfelder 2 bis 4 erstellt, in einer dritten Phase das Maschinenhaus, das Stauwehrfeld 1 und die Eintiefung. Um die Baumassnahmen in einem trockenen Zustand ausführen zu können, musste jeweils eine Baugrubenumschliessung im Rheinbett erstellt werden. Des Weiteren musste rund um die Baugrube ein Dichtungsschleier im Flussbett hergestellt werden, sodass möglichst kein Wasser eindringen konnte. Der Aushub erfolgte mittels Lockerungssprengungen. Das Fundament für die Baugrubenumschliessung bildete eine überschnittene Bohrpfahlwand mit einem Durchmesser von 900 mm, die 10 m tief in die Felssohle eingebracht wurde. Auf dem Fundament wurden die Stahlwände der Spundwand aufgestellt und verankert. Anschliessend wurden die Baugruben trockengelegt und nach den Arbeiten wieder geflutet.
Der Untergrund am Projektstandort besteht aus Muschelkalk, gefolgt von Dolomitfels mit anschliessendem Anhydritbereich. Trotz vielen geologischen Erkundungen stiess man in der zweiten Baugrube auf einen 8 m tiefen Hohlraum, der eine Breite von 23 m aufwies. Um einen Grundbruch zu verhindern, wurde er mit einer bewehrten überschnittenen Bohrpfahlwand gesichert.
Überflutete Keller
Aufgrund der geologischen Eigenschaften des Muschelkalkfelses kommuniziert das Grundwasser direkt mit dem Rheinwasserspiegel, was mit Grundwassermodellrechnungen nachgewiesen wurde (vgl. Kasten S. 25). Von der veränderten Grundwassersituation und dem Höherstau war vor allem das dicht am Rhein stehende Schloss Beuggen auf der deutschen Seite betroffen, was aufwendige Sicherungsmassnahmen erforderte. So wurden die gefährdeten Gebäude mit einem Horizontaldichtungsschleier im Mauerwerk gesichert, eine äussere und innere Abdichtung aufgebracht und die Keller aufgefüllt. Das gleiche Verfahren wurde bei einzelnen Gebäuden der flussabwärts stehenden Industrieanlagen angewandt. Des Weiteren mussten Fischereianlagen wie Galgenbären, Buhnen und Fischerhütten dem neuen Stauspiegel angepasst werden.
Technik unter Wass er
Damit die Sicht auf den Rhein nicht gestört wird, wurde in der Baugenehmigung eine flache Bauweise der Kraftwerksanlage verlangt. Das Maschinenhaus ragt daher nur 2 m über die Wasseroberfläche. Lediglich das Empfangsgebäude steht sichtbar in der Landschaft. Für die Betonarbeiten des Maschinenhauses war eine präzise Vermessung wichtig. Die Abweichung der Parallelität der Wände in den Turbinenschächten darf lediglich 2 mm betragen, damit die Turbinen präzise eingebaut werden und arbeiten können.
Von der Leitzentrale aus wird das Kraftwerk elektronisch überwacht und gesteuert. Personal wird nur noch für Inspektion und Wartung eingesetzt. Treten Netzteilstörungen auf oder fehlt Wasser, reagieren die technischen Anlagen selbstständig. An beiden Ufern liefern Pegelmessungen Informationen, um die Turbinen und das Stauwehr zu steuern. Seit Beginn des Jahres arbeiten die vier Rohrturbinen, auch Horizontalturbinen genannt, unter der Wasseroberfläche, von aussen unsichtbar. Sie leisten bei Vollauslastung 100 MW. Dies wird nach statistischen Auswertungen an etwa 50 Tagen des Jahres der Fall sein. Reicht das Wasser im Rhein nicht aus, wird die Leistung der Turbinen gedrosselt oder werden einzelne zeitweise abgeschaltet. In einem Störfall können die Turbinen (drehende Teile, ca. 230 t) innerhalb von 9.4 Sekunden abgeschaltet werden. Der produzierte Strom wird je zur Hälfte in das Schweizer bzw. das deutsche Netz eingespeist.TEC21, Fr., 2011.03.25
25. März 2011 Daniela Dietsche
Raum für Nase und Co.
Die Bewilligung des neuen Kraftwerks Rheinfelden verpflichtet die Betreiber zu einer ganzen Reihe von ökologischen Ausgleichsmassnahmen als Kompensation für die damit verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft. Die wichtigste und in dieser Grösse einmalige ist der Bau eines naturnahen Umgehungsgewässers im Bereich des alten Oberwasserkanals, das ursprünglich im Rhein heimischen Fischen Laichgründe und Lebensraum bieten wird.
Das Kraftwerk Rheinfelden ist eines von elf Flusskraftwerken, die sich am Hochrhein zwischen Bodensee und Basel aneinanderreihen. Sie haben den einst wild strömenden Fluss in eine Kette von träge dahinfliessenden Stauabschnitten verwandelt. Die ehemals im Hochrhein lebenden, strömungsliebenden Fischarten wie Barbe, Nase oder Äsche (Abb. 1) sind entsprechend stark zurückgegangen. Diesen auch Kieslaicher genannten Arten fehlen flache Kiesufer, lockere, bei Hochwasser immer wieder umgelagerte Kiesbänke und Stromschnellen als Laichgründe bzw. Lebensraum der Jungfische. Auch die über lange Distanzen wandernden Arten wie Lachs oder Meerforelle sind verschwunden, weil sie Staustufen ohne Fischtreppen – von denen es vor allem im Oberrhein zwischen Basel und Strassburg noch einige gibt – nicht überwinden können. Mit dem Bau eines naturnahen Umgehungsgewässers wird ein kleines Stück des verloren gegangenen Lebensraumes wiederhergestellt. Es soll in erster Linie der Fortpflanzung der Kieslaicher dienen, aber auch die Wanderung von Fischen ermöglichen.
Vorversuche am hydraulischen Mo dell
Ein Umgehungsgewässer in dieser Grössenordnung sei noch nirgends realisiert worden, erläutert Paul Lehmann vom mit der Planung beauftragten deutschen Ingenieurbüro Dr. Rolf- Jürgen Gebler. Daher habe man zunächst nach natürlichen Gewässern gesucht, die als Vorbild dienen konnten. Fündig wurde man beim oberen Abschnitt des sogenannten Restrheins zwischen Märkt und Breisach in Baden-Württemberg, wo Barben und Nasen laichen. Die von den Fischen genutzten Strukturen wie beispielsweise Stromschnellen wurden vor Ort detailliert analysiert und dann in einem hydraulischen Modell im Massstab 1: 22 an der Universität Karlsruhe nachgebaut, damit im Detail untersucht werden konnte, mit welcher Gestaltung man die diversen Anforderungen am besten erfüllt (Abb. 4). Die Erkenntnisse aus den Modellversuchen flossen dann zunächst in die Planung von drei kleineren naturnahen Umgehungsgewässern an Aare (Kraftwerke Ruppoldingen [Abb. 2 und 5] und Rupperswil- Auenstein) und Hochrhein (Kraftwerk Albbruck-Dogern) ein, bevor das Umgehungsgewässer in Rheinfelden in Angriff genommen wurde. Dieses wird derzeit am rechten Rheinufer im Bereich des Oberwasserkanals des alten Kraftwerks gebaut.
Ab flussregelung im Einlaufbereich
Der Einlaufbereich des Umgehungsgewässers wird rund 200 m oberhalb der Wehranlage des neuen Kraftwerks beginnen und durch aufgeschüttete Inseln in drei Arme unterteilt (vgl. Übersichtsplan S. 26 / 27). Zwei davon führen zu einem ungeregelten Einlauf, der von einer Doppelreihe Blocksteinen gebildet wird. Der dritte Arm mündet in einen mit zwei Schützen regelbaren Einlauf. Im Normalfall sollen 10 bis 16 m³/s in das Umgehungsgewässer gelangen. Die Abflussdynamik orientiert sich dabei nicht am Rhein, sondern an Zuflüssen, die eine ähnliche Grössenordnung wie das Umgehungsgewässer aufweisen, da dies den Ansprüchen der Kieslaicher an ihren Laichplatz besser entspricht. Ausserhalb der Laichzeit sind auch zeitweise höhere Abflüsse von bis zu 35 m³/s vorgesehen, um Ablagerungen von Feinpartikeln in der Flusssohle wegzuspülen und den Porenraum wieder durchlässiger zu machen. Denn im künstlich angelegten Umgehungsgewässer wird das Sohlmaterial nicht wie bei natürlichen Flüssen von Zeit zu Zeit umgelagert. Wie der Einlaufbereich gestaltet sein muss, damit der Minimalabfluss von 10 m³/s nicht unterschritten wird und der Maximalabfluss von 35 m³/s erreicht werden kann, wurde am hydraulischen Modell untersucht und wird dann nach der Umsetzung in die Praxis in einem Probebetrieb verifiziert bzw. eingeregelt. Mit einem Gefälle von 0.8 % hat das Umgehungsgewässer den Charakter eines Gebirgsflusses.
Leitströmung weist den Fischen den Weg
Das eigentliche Umgehungsgewässer beginnt unterhalb der Wehrbrücke des neuen Kraftwerks und mündet im Bereich des alten Maschinenhauses in den Rhein. Den Übergang bildet dort eine in das Rheinbett hineinreichende Halbinsel mit einer Blocksteinrampe. Diese sogenannte Sohlengleite mit einem Gefälle von 1:30 wird in aufgelöster Riegelbauweise gestaltet. Je nach Wasserstand des Rheins wird hier ein Höhenunterschied von bis zu 3 m überwunden. Dadurch wird gewährleistet, dass auch bei hohen Abflüssen im Rhein die Laichgebiete des Umgehungsgewässers nicht eingestaut werden. Eine Rinne in der Mitte der Sohlengleite lässt eine Leitströmung entstehen, die den Fischen den Weg zum Umgehungsgewässer weist. Je weiter sie in den Hauptstrom hineinreicht, desto mehr flussaufwärts ziehende Fische werden erreicht. Daher hat man die Gestaltung zuvor am hydraulischen Modell in Karlsruhe optimiert. Trotzdem wird die Leitströmung nicht über die gesamte Rheinbreite reichen. Für die an der Mündung des Umgehungsgewässers vorbeiziehenden Fische wurden daher zwei weitere Fischpässe – ein Raugerinne-Beckenpass am Stauwehr und ein Schlitzpass am neuen Maschinenhaus – gebaut.
Vielfältige Strukturen für Laich und Jungfische
Das Umgehungsgewässer, das ca. 900 m lang und 50 m breit ist, wird mit vielfältigen Sohl-, Ufer- und Strömungsstrukturen gestaltet, um die Ansprüche der verschiedenen Fischarten an ihre Laichgewässer und die wiederum anderen Ansprüche der Jungfische zu erfüllen. Für Laich und Jungfische strömungsliebender Fische sind in den ersten Wochen flache Ufer, flach abfallende Kiesbänke und kleine Buchten mit geringer Strömung die besten Lebensräume. Mit zunehmendem Alter und zunehmender Körpergrösse suchen sie tiefere und schneller fliessende Bereiche auf. Entsprechend wurde die Flusssohle als Abfolge von kiesigen Stromschnellen, ruhigeren Tiefwasserzonen, überströmten Kiesbänken und Kiesinseln gestaltet. Zwischen diesen Strukturen schlängelt sich ein durchgehender, mindestens 80 cm tiefer Gewässerlauf hindurch, der Ober- und Unterwasser für wandernde Fische und auch alle anderen Wasserlebewesen miteinander verbinden wird. Auf der in Fliessrichtung linken Seite bleibt die alte Kanalmauer als Grenze zum Hauptstrom bestehen, wird aber teilweise in der Höhe abgetragen, sodass sie 50 cm über den Wasserspiegel des Umgehungsgewässers ragen wird. Sie wird auf beiden Seiten angeschüttet, um auf der Seite des Umgehungsgewässers flache Kiesufer zu schaffen, die der natürlichen Sukzession überlassen werden. Zum Hauptstrom hin, wo sich die Reste des sogenannten Gwilds, einer biologisch wertvollen Felslandschaft (vgl. «Potenzial besser nutzen», S. 24), befinden, wird die Aufschüttung naturnah gestaltet. Für sämtliche Aufschüttungen im Sohl- und Uferbereich wird das bei der Eintiefung des Rheins unterhalb des Wehrs ausgebrochene Material verwendet (vgl. Luftaufnahme, Seite 19 unten).
Pavillon statt Uferzug ang für Besucher
Am rechten Ufer werden sich steile mit flachen Böschungsbereichen und mit Ufereinbuchtungen als Stillwasserbereiche abwechseln. Entlang des Ufers wird ein abgestufter Gehölzsaum mit Auenwaldcharakter entstehen. Die Bepflanzung soll gleichzeitig die Zugänglichkeit für Erholungsuchende und Besucher erschweren. Für diese wird stattdessen ein Rad- und Fussweg in der Uferböschung angelegt sowie im mittleren Abschnitt ein Aussichtspavillon eingerichtet, von dem aus sich das Umgehungsgewässer überblicken lässt. Ausserdem werden dort Schautafeln über das naturnahe Umgehungsgewässer, die Geschichte des Kraftwerks Rheinfelden und die Wasserkraftnutzung allgemein informieren. Im Frühjahr 2012 soll das rund 4 Mio. Euro teure Projekt fertiggestellt sein. Ein Monitoringkonzept sieht vor, die Funktionsfähigkeit des Umgehungsgewässers und die Entwicklung von Flora und Fauna während zwölf Jahren zu überwachen. «Beim vor zehn Jahren fertiggestellten Umgehungsgewässer beim Kraftwerk Ruppoldingen haben sich die strömungsliebenden Fische schon kurz nach der Inbetriebnahme eingestellt», berichtet Lehmann. Da dieser Gruppe eine Indikatorfunktion für die Naturnähe eines Flusses zukommt, zeigt deren Anwesenheit auch eine allgemeine Verbesserung des Lebensraumes für die Flora und Fauna des Flusses an.TEC21, Fr., 2011.03.25
25. März 2011 Claudia Carle