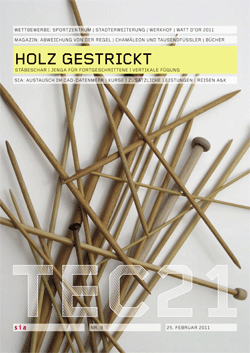Editorial
«Es war einmal ein Lattenzaun / mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah / stand eines Abends plötzlich da –
und nahm den Zwischenraum heraus / und baute draus ein grosses Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm / mit Latten ohne was herum,
Ein Anblick grässlich und gemein. / Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh / nach Afri – od – Ameriko.»
Im Gedicht «Der Lattenzaun» formulierte Christian Morgenstern (1871–1914) in ironischer Form sein Unbehagen gegenüber dem «Verschwinden der Wand» in der Architektur. Ausgelöst wurde dieses Unbehagen durch die konstruktiven Möglichkeiten, die die industriell produzierten neuen Baustoffe Stahl, Glas und Stahlbeton gegenüber den traditionellen Bauweisen in Holz und Mauerwerk bieten, um Tragkonstruktionen leichter, transparenter zu gestalten, im Sinne Morgensterns also, um «ein grosses Haus aus dem Zwischenraum zu bauen».
Architektur und Ingenieurkunst bewegen sich seither im Spannungsfeld zwischen, um in Morgensterns Bild zu bleiben, den «Latten ohne was herum», also der massiven Wand, und dem «Zwischen-raum, hindurchzuschaun», der filigranen, transparent wirkenden Tragkonstruktion. Morgensterns Bild des Lattenzauns legt es nahe, dieses Spannungsfeld anhand von Beispielen aus dem aktuellen Holzbau zu illustrieren. TEC21 stellt deshalb in dieser Ausgabe Holzbauwerke mit sehr unterschiedlichen Anteilen von Baustoff und «Zwischenraum» vor.
Als «Lattenzaun» mit grossen, nach oben grösser werdenden Zwischenräumen erscheint der Jübergturm, ein Aussichtsturm in der deutschen Stadt Hemer («Stäbeschar»). Die grossmaschige Netzstruktur der Turmwand beruht auf der ursprünglich für stählerne Masten entwickelten Bauweise des russischen Konstrukteurs V. G. Suchov und verleiht dem Turm eine semitransparente, luftige Erscheinung.
Viel kürzer, gedrungener und horizontal übereinandergeschichtet sind die «Latten», besser Balken, die den igluartigen Ausstellungspavillon «Net no Mori» im japanischen Hakone bilden («Jenga für Fortgeschrittene»). Trotz der massiven, fast urzeitlichen Erscheinung ist das scheinbar regellos aufgetürmte Haufwerk dank den grosszügigen Zwischenräumen überraschend durchlässig und transparent.
Keine Zwischenräume gibt es zwischen den Latten bzw. Brettern, aus denen die Wände des Werkhofs der Gemeinden Bonaduz und Rhäzuns aufgebaut sind («Vertikale Fügung»). Die Fassaden dieser an sich unspektakulären, aber sorgfältig gestalteten Gebäude sind in traditioneller, unorthodox interpretierter Holzbauweise erstellt.
Wiederum ein Zaun ist das Küssnachter Strandbad Seeburg (vgl. »Magazin»). Vertikale Holzlamellen filtern den Durchblick, schräge Stützen gewähren dazwischen freie Sicht.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Sportzentrum, Neufeld Bern | Baufeld 2, Bern Brünnen | Werkhof Küssnacht | Watt d’Or 2011
12 MAGAZIN
Abweichung von der Regel | Chamäleon und Tausendfüssler | Bücher
22 STÄBESCHAR
Christian Holl Der nach den Prinzipien des russischen Konstrukteurs V. G. Suchov entworfene hölzerne Aussichtsturm ist das neue Wahrzei-chen der deutschen Stadt Hemer.
26 JENGA FÜR FORTGESCHRITTENE
Claudia Hildner Im japanischen Hakone Air Museum spannt ein luftiger Pavillon aus Holzbalken von Tezuka Architects die Installation eines begehbaren, bunten Nylonnetzes auf.
32 VERTIKALE FÜGUNG
Markus Schmid Eine einschalige Gebäudehülle aus einheimischem Holz prägt den im letzten Jahr erstellten gemeinsamen Werkhof der Ge-meinden Bonaduz und Rhäzüns.
37 SIA
Austausch im CAD-Datenmeer | Weitere Kurse SIA-Form | Zusätzliche Leistungen | Reisen und Exkursionen A&K
43 FIRMEN
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Stäbeschar
Die Aufgabe, einen Aussichtsturm zu entwerfen, hat ein Stuttgarter Teamaus Architekten und Ingenieuren zum Anlass genommen, die Leistungsfähigkeit von Holz für eine Konstruktion aus hyperboloiden Schalen nachzuweisen. Das Ergebnis überzeugt sowohl architektonisch als auch tragwerksplanerisch – und bescherte der deutschen Stadt Hemer ein neues Wahrzeichen.
Es kommt nicht oft vor, dass zeitgenössische Architektur auf sogenannten touristischen Hinweistafeln gezeigt wird, mit denen die Autofahrer auf Schnellstrassen und Autobahnen auf Sehenswertes der Umgebung aufmerksam gemacht werden, die sie gerade durchqueren. Der Jübergturm hat dies geschafft, und das gleich im Jahr seiner Fertigstellung. Man übertreibt also wohl nicht, wenn man ihn als neues Wahrzeichen der Stadt, in der er steht, bezeichnet. Er ist allerdings nicht nur dies – er ist auch ein Beispiel dafür, wie gewinnbringend eine Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur sein kann.
Errichtet wurde der Jübergturm für die Landesgartenschau im deutschen Hemer, einer Gemeinde im Mittelgebirge Sauerland, etwa 45 km südöstlich von Dortmund gelegen. 2004 hatte der damalige Verteidigungsminister Struck bekannt gegeben, dass die Bundeswehrkaserne in Hemer aufgegeben werden soll. Zwei Jahre später, bevor die Bundeswehr das Areal verlassen hatte, bewarb sich die Stadt für die Ausrichtung einer Landesgartenschau, nicht zuletzt um das 30 ha grosse Gelände als Park Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen zu können.
Tragende Schalen aus Holzstäben
Den Wettbewerb für einen Aussichtsturm auf dem Jüberg östlich der Innenstadt von Hemer hatte 2008 eigentlich das Schweizer Büro bm architekten mit einer Treppenskulptur gewonnen. Sie scheiterten allerdings an den Baukosten – und so kam schliesslich der Entwurf zum Zuge, mit dem die jungen Stuttgarter Architekten Birk & Heilmeyer und das Ingenieurbüro Knippers Helbig – auch verantwortlich für das Membrandach des Eingangsboulevards der Expo in Shanghai – beim Wettbewerb den dritten Platz belegt hatten. Lediglich die zum ursprünglich geplanten Turm gehörende Treppenanlage war bereits ausgeführt worden.
Die Architekten Stephan Birk und Liza Heilmeyer waren durch eine intensive Recherche darin bestärkt worden, dass diejenigen Türme am prägnantesten wirken, deren Gestalt aus der Konstruktion entwickelt worden ist. Vor allem Vladimir Grigorjewitsch Suchov (1853–1939) war ihnen dabei immer wieder begegnet – die Faszination für die Arbeiten des grossen russischen Konstrukteurs ist dem neuen Turm anzusehen. In Hemer wollten Architekten und Ingenieure nun Suchovs Prinzipien in Holz umsetzen.[1]
Wie viele von Suchovs Bauten ist der Jübergturm als Schalenhyperboloid entwickelt worden. Zwei alle vertikalen und horizontalen Lasten tragende konzentrische Schalen aus Scharen paralleler, gerader Stäbe aus Brettschichtholz sind schräg gegeneinander an zwischen den Schalen liegende Ringe aus Stahl montiert (Abb. 2, 4–6). An diese Ringe sind die wie Speichenräder aufgebauten fünf Podeste montiert. Sie wirken als Scheiben und sind über biegesteife Speichen mit dem Innenring verbunden. Wendeltreppen verbinden die Podeste. Je zwei zusätzliche Ringe zwischen den Podesten verkürzen die Knicklänge der Stäbe. Aus den gegeneinander versetzten, in einem Ringfundament eingespannten Stabscharen und den horizontalen Ringen ergeben sich stabile Dreiecke. Die intelligente Konstruktion erlaubte es, ausschliesslich Stäbe eines Querschnitts von lediglich 8 × 8 cm zu verwenden
Ideale Kooperation
In der Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren sind weitere Besonderheiten entwickelt worden, die den Charakter des Turms bestimmen und die auf Spezifika des Ortes reagieren. Umgeben ist der Turm zu grossen Teilen von Wald – die Wahl des Materials Holz war daher naheliegend, zumal sowohl Architekten als auch Ingenieure schon Erfahrungen mit diesem Baustoff und ähnlichen Konstruktionen aufzuweisen hatten. Die Situierung im Wald hat zur Folge, dass die aufregende Rundumsicht erst über den Bäumen genossen werden kann. Diesem Wechsel der Atmosphäre entspricht eine sich nach oben öffnende Form, der Turm hat oben mit einem Durchmesser von 9 m seine grösste Plattform. Im Windkanal waren die zu erwartenden Belastungen ermittelt worden, die der Bemessung zugrunde gelegt wurde. Entsprechend der statischen Belastung löst sich das filigrane Stabtragwerk mit zunehmender Höhe auf: Bestehen die Schalen zuunterst aus je 20 Scharen zu je sechs Stäben – alle ohne Montagestoss –, reduzieren sie sich bis zuoberst auf jeweils deren zwei; auf jedem Geschoss endet jeweils ein Stab. Das Hinaufsteigen beginnt also in einem von dichtem Geflecht umgebenen Turm, wie im umgebenden Wald wird es umso lichter, je höher man kommt, bis schliesslich oben, über den Baumkronen, die vollständige Aussicht genossen werden kann (Abb. 7).
Die Holzlatten sind bewittert und mit einem lösemittelhaltigen Holzschutzöl mit insektizider und fungizider Wirkung behandelt, Abdeckbleche schützen die Hirnholzflächen. Die exponierte Lage und regelmässiger Wind gewährleisten, dass die Hölzer nach feuchter Witterung rasch wieder trocknen.
Bauzeit: Sechs Wochen
Architekten und Ingenieure hatten nicht zuletzt auch den Ehrgeiz, mit diesem Turm etwas zu bauen, das es als Konstruktion so noch nicht gegeben hatte. Dass sich zu diesem Ehrgeiz noch die Herausforderung einer kurzen Planungs- und Bauzeit gesellen würde, hatten sie nicht ahnen können. Gerade mal neun Monate hatte das Stuttgarter Team von der Auftragserteilung bis zum Eröffnungstermin Zeit. Eine echte Herausforderung, die durch den ungewöhnlich harten, bis weit in das Frühjahr reichenden Winter noch grösser wurde. Von Hemers Innenstadt aus gut sichtbar, wurden mit einer Hilfskonstruktion zunächst Treppen und Podeste errichtet. Auf einer Montagefläche am Bauplatz wurden die Stabpakete zusammengefügt, indem sie an Segmente der Zwischenringe montiert wurden. Diese Scharen wurden von innen nach aussen im Fundament eingespannt und montiert, die Segmente der Zwischenringe über Stirnplatten miteinander verschraubt. Die Stäbe sind dabei mit von Stabdübeln gehaltenen, verzinkten Schlitzblechen versehen, an die eine Lasche angeschraubt wurde, die wiederum an den Zwischenring geschweisst wurde. Die Zwischenringe sind ihrerseits über Laschen an der inneren Konstruktion befestigt. Letztlich wurde der insgesamt 23.5 m hohe Turm in sechs Wochen errichtet.
Fast eine Million Besucher haben den Turm während der Landesgartenschau bestiegen – wenn der Turm nach dem Abbau der Schau im nächsten Frühling wieder geöffnet werden wird, wird er weiterhin rege benutzt werden; unter diejenigen, die die Aussicht bewundern, wird sich sicher auch der eine oder andere Architekt und Ingenieur mischen.TEC21, Fr., 2011.02.25
[1] Mit dem Konzept, das vom Ingenieur Vladimir Suchov entwickelte und für unzählige Stahlkonstruktionen angewandte Prinzip des Hyperboloids auf das Material Holz zu übertragen, gewannen 2003 der Karlsruher Künstler Daniel Roth und der Architekt Alexander Kohm den Wettbewerb um die Kunst am Bau der Technischen Berufsschule Zürich (Stücheli Architekten, Wettbewerb 1996). 2004 wurde der Aussichtsturm auf der Dachterrasse des Schulhauses am Sihlquai, unweit des Hauptbahnhofes Zürich, errichtet; vgl. Daniel Engler, «Die sparsame Konstruktion», in tec 21 41/2004, S. 6–13
25. Februar 2011 Christian Holl