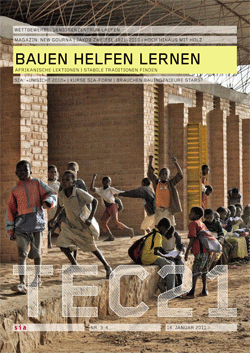Editorial
Nachhaltiges Bauen und Entwicklungshilfe scheinen zunächst wenig miteinander zu tun zu haben. Doch auf den zweiten Blick tun sich vielfältige Bezüge auf: Nachhaltige Bauweisen, die weltweit zur Anwendung kommen sollen – und das müssen sie, wenn der Klimaschutz gelingen soll –, werden um ein Vielfaches günstiger sein müssen als die Bauten, die heute in der Schweiz als vorbildlich gelten. Der damit erreichte Öko-Standard ist zwar beeindruckend, er bedingt jedoch einen technischen Aufwand, der die finanziellen Möglichkeiten in den meisten Ländern bei weitem übersteigt. Unter diesem Aspekt könnte es sinnvoll sein, nachhaltige Bautechniken in den ärmsten Ländern der Welt zu entwickeln, unter widrigsten realen Bedingungen. Dieses Heft stellt einen Burkiner und einen Schweizer vor, die genau dies tun.
Tom Schacher hat im Norden Pakistans mit Holz bewehrte, erdbebensichere Steinbautechniken entwickelt. Er hat dabei die Bauweise von historischen Gebäuden in der Region aufgenommen, die das verheerende Erdbeben von 2005 überstanden haben. Das grösste Problem dabei ist, die Einheimischen davon zu überzeugen, dass eine Technik aus ihrer eigenen Bautradition sicherer (und viel günstiger) sein kann als die westliche Betonskelett-Bauweise. Der Architekt im Dienst der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) hat sich dieses Vorgehen zum Prinzip gemacht. Mittlerweile hat er auch auf Haiti historische Bauten entdeckt, die beim Erdbeben vor einem Jahr nicht zerstört wurden und von deren Fachwerkkonstruktion sich für den Wiederaufbau lernen lässt.
Djébédo Francis Kéré kommt aus Burkina Faso und hat in Berlin Architektur studiert. In den Klassenzimmern der Schulen, die er in Afrika gebaut hat, herrschen bei 40 Grad Aussentemperatur angenehme 25 Grad – in Bauten aus Lehm und Blech und ohne Stromversorgung. Kérés Bauten sind schön. Er entwickelt die lokale Bautradition weiter und trägt damit zur kulturellen Nachhaltigkeit bei. Seine Schulen leisten aber noch viel mehr, und zwar unter härtesten Bedingungen: «Wirtschaftlich nachhaltig» heisst in Burkina Faso: Baukosten deutlich unter 10 000 Franken pro Klassenzimmer, «sozial nachhaltig» bedeutet: alles selber machen. Auch hier ist intensive gegenseitige Kom-munikation zwischen Architekt und Bevölkerung Bedingung für das Gelingen.
Solche Entwicklungszusammenarbeit beruht auf einem bautechnischen Wissens
transfer aus den entwickelten in die armen Länder. Im sozialen und kulturellen Bereich läuft der Wissenstransfer aber in beiden Richtungen, wenn nicht sogar eher von Süd nach Nord: Kéré und Schacher sind dabei, zu lernen, wie man mit der Bevölkerung zusammen aus Material, das auf der Baustelle vorhanden ist, günstige, sichere, umweltschonende und schöne Bauten entwickelt. Dieses Wissen dürfte weltweit nützlich werden – auch bei uns.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Seniorenzentrum Laufen
10 MAGAZIN
New Gourna: Weltkulturerbe in Gefahr |
Leserbrief | Jakob Zweifel 1921–2010 |
Castingaufruf «Schweiz aktuell» | Hoch
hinaus mit Holz
20 AFRIKANISCHE LEKTIONEN
Ruedi Weidmann Francis Kérés Schulbauten in Afrika zeigen, was Architektur leisten kann und wie Entwicklungszusammenarbeit funktionie-ren würde.
26 STABILE TRADITIONEN FINDEN
Alexander Felix Der Architekt Tom Schacher (Deza) sucht nach lokalen Baukulturen in seismisch gefährdeten Regionen, um den Wieder-aufbau in den Erdbebengebieten
Pakistan und Haiti zu verbessern.
31 SIA
«Umsicht 2011»: Auszeichnungsfeier |
Kurse SIA-Form Deutschschweiz 1/2011 | Brauchen Bauingenieure Stars?
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Afrikanische Lektionen
Francis Kéré stammt aus Burkina Faso und hat in Berlin Architektur studiert. Seine Schulen in Afrika – aus Lehm, Steinen und Wellblech – finden weltweit Beachtung. Denn Kéré macht vor, was Architektur leisten kann und wie Entwicklungszusammenarbeit funktionieren würde.
In Gando leben etwa 2500 Menschen. Ihre stroh- und blechgedeckten Lehmhütten stehen in kleinen Gruppen in der staubigen Landschaft, die von vereinzelten Bäumen, Felshügeln und Wegspuren unterbrochen wird und die nur in den drei Regenmonaten grün wird. Das Dorf 130 km südöstlich von Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou hat keine Strom- und Wasserversorgung; die Analphabetenrate liegt noch über dem Landesdurchschnitt von 80 %. Die Menschen hier sind Subsistenzbauern: Sie verzehren, was sie anbauen – in schlechten Jahren schon bevor die neuen Früchte reif sind. In solchen Jahren sterben mehr Leute als sonst. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.
In Gando wurde 1965 Diébédo Francis Kéré geboren. Er war das erste Kind aus dem Dorf, das eine Schule besuchen durfte. Sein Vater, der Häuptling von Gando, wollte, dass sein ältester Sohn die Briefe der Regierung lesen konnte. Francis musste seine Familie verlassen und kam in ein Internat. Er wurde Schreiner und erhielt 1985 ein Stipendium der Carl Duisberg Gesellschaft für eine Ausbildung zum Entwicklungshelfer in Deutschland. Danach holte er das Abitur nach und schrieb sich 1995 an der Technischen Universität in Berlin ein. 2004 schloss er sein Architekturstudium ab und gründete in Berlin ein eigenes Büro. Im vergangenen November hat Francis Kéré in Mendrisio aus der Hand von Mario Botta den Swiss Architectural Award 2010 erhalten, den von der Banca della Svizzera Italiana gesponserten, mit 100 000 Franken höchstdotierten Architekturpreis der Schweiz. Geehrt wurde Kéré damit für das Schulhaus, das er in seinem Dorf Gando gebaut hat. Aber auch seine weiteren Bauten und Projekte überzeugen architektonisch, technisch und sozial. «Kéré hat uns eine Lektion erteilt», sagte Jury-Präsident Botta, «seine Architektur aus einfachen Elementen ist von hoher Qualität und besinnt sich auf ihren eigentlichen Sinn, den Schutz des Menschen».[1]
Material, Konstruktion, Tradition
Als Kéré in sein Dorf zurückkehrte und sagte: «Leute, wir bauen eine Schule!», war der Jubel gross – doch ebenso die Enttäuschung, als er sagte: «…aus Lehm, wie unsere alten Wohnhäuser! » – «Jetzt ist Francis durchgedreht», sagten sie traurig. «Eine Schule ist doch etwas Modernes, etwas Französisches, etwas Europäisches – also aus Beton! Sie muss lange halten, nicht wie unsere Hütten, die in jeder Regenzeit weich werden!»[2] Diese Meinung, Fortschritt komme einzig aus Europa und sei deshalb nur mit europäischen Materialien und Techniken zu erreichen, ist in Afrika weitverbreitet. Das Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den ehemaligen Kolonialherren, erklärt Francis Kéré im Gespräch, wirke noch immer nach, bei den Eliten wie in der breiten Bevölkerung. Er aber ist überzeugt, das sich Afrika die energieintensiven, Ressourcen verbrauchenden Techniken aus Europa weder finanziell noch ökologisch leisten kann. Deshalb untersuchte er traditionelle Bautechniken in heissen Ländern. Er wollte eine an das Klima von Burkina Faso angepasste Bautechnik finden, die ohne Strom funktioniert und die Schwächen der traditionellen Bauweise überwinden kann. Traditionell bestehen Bauten in Burkina Faso aus Stampflehm und Strohdach, womit zwar eine gewisse Durchlüftung erreicht wird, jedoch nur kurze Spannweiten möglich sind. (Auch Bauholz ist knapp.) In der Regenzeit leidet der Lehm, oft müssen die Häuser danach neu gebaut werden. Davor schützt zwar ein Blechdach, wie es heute oft verwendet wird, doch darunter wird es in der übrigen Zeit, wenn die Nordwinde aus der Sahara über die Savanne ziehen, enorm heiss und stickig. Für die Schule in Gando war also eine klimataugliche, dauerhafte und sehr günstige Bauweise gesucht. Wegen der letzten Forderung kam nur lokal vorhandenes Material infrage, zudem mussten die Männer, Frauen und Kinder aus dem Dorf in der Lage sein, das Gebäude selber zu bauen, von Hand, mit einfachem Werkzeug und vorhandenem Wissen. «Die aktive Beteiligung der Bevölkerung ist das Wichtigste», sagt Kéré. «Sie fördert das Verständnis für die Bautechnik und für die Funktion des Gebäudes, was die Bedingung dafür ist, dass es später unterhalten wird.» Ausserdem gibt das den Leuten Arbeit und ermöglicht eine praktische Ausbildung: Die Bautechnik kann für andere Häuser nachgeahmt werden. Die Zusammenarbeit geht aber noch weiter: Nur zusammen mit den Leuten konnte Kéré überhaupt eine Form für die Gebäude finden, die alle Bedingungen erfüllt und sozial anschlussfähig ist. Mithilfe des Vereins «Schulbausteine für Gando», den Kéré noch während des Studiums gründete, wurde der Bau der Schule möglich.
Eine Schule und ihre Erweiterungen
Ein Jahr lang brachten die Kinder von Gando jeden Morgen einen Stein zum Bauplatz. Daraus entstand das Fundament für das neue Schulhaus. Für die Mauern und das Unterdach wurden mit einer Handpresse Lehmbausteine hergestellt. Für eine grössere Dauerhaftigkeit enthalten diese neben rund 60 % Lehm und 30 % Sand auch 8 –10 % Zement. Das Mauerwerk aus ungebrannten Lehmbausteinen isoliert gut gegen die Hitze. Die Böden bestehen aus Stampflehm. Über alle Schulzimmer und offenen Zwischenräume spannt sich ein Flügel aus Armierungseisen und Wellblech. Er spendet Schatten und schützt die Mauern vor Schlagregen; dank seiner speziellen Form produziert der Wind einen Sog, der in den Räumen darunter zu einem ständigen, angenehmen Luftzug führt. Beim guten Klima in den Schulzimmern ist Lernen weitaus besser möglich als in der alten Schule, in der es zu heiss war – und die irgendwann einstürzte, obwohl sie aus Beton war.
Kérés Wohnhäuser für die Lehrer in Gando werden nach demselben Prinzip gekühlt. Die Dorfbewohner nennen sie «Kühlschränke» – das höchste Lob für ein Haus in Burkina Faso. Die Lehrerhäuser helfen, gute Lehrkräfte im Dorf zu halten, die sonst den höheren Lebensstandard in der Stadt dem einfachen Dorfleben vorziehen.
Entwicklungszusammenarbeit
Zu Gandos neuer Schule gehört noch mehr: die ersten Latrinen im Dorf etwa oder der Sportplatz und der Gemüsegarten. «In Afrika bin ich eigentlich nicht Architekt, sondern Entwicklungshelfer », sagt Kéré. Er meint damit, dass er hier mehr tut als Häuser bauen. «Die beste und vielleicht die einzige Erfolg versprechende Entwicklungshilfe ist Bildung für alle. Deshalb habe ich eine Schule gebaut, und deshalb hänge ich alle neuen Dinge, die ich nach Gando bringe, an die Schule an. So werden sie für die Kinder selbstverständlich, und sie bringen sie nach Hause in ihre Familien.» Ein Beispiel dafür ist der Schulgarten, in dem die Kinder Kenntnisse im Gemüseanbau erwerben. Zwar wollen heute alle Kinder in Gando «Architekt wie Francis» werden, doch das wird nicht gehen. «Subsistenzwirtschaft wird auch in Zukunft die Basis von Burkina Fasos Volkswirtschaft bleiben. Doch die Produktivität sollte so weit gesteigert werden, dass eine Missernte nicht gleich Hunger bedeutet. Ein Ziel muss deshalb sein, einfache Möglichkeiten zur Verarbeitung von Agrarprodukten aufzubauen, die heute gänzlich fehlen. Dazu braucht es keinesfalls Kunstdünger und genmanipuliertes Saatgut, wohl aber bessere Kenntnisse über Agronomie und Gemüseanbau sowie einige ganz einfache Werkzeuge und Maschinen.»
Die Schule macht Schule
Die Schule von Gando ist eine Erfolgsgeschichte. Weil sie immer mehr Kinder aus den Nachbardörfern anzog, bauten Kéré und die Dorfbewohner einen zweiten Flügel mit vier weiteren Schulzimmern. Gegenwärtig ist die Bibliothek im Bau. Die Landesregierung unterstützt die Schule mit der Entsendung von fähigem Lehrpersonal und hat soeben beschlossen, dass Gando ein Gymnasium erhalten soll; Francis Kéré soll es bauen. Dieser tüftelt unterdessen an einer Zisterne aus unterirdischen Tongefässen und plant ein Gemeinschaftszentrum für die Frauen. Damit diese sich weiterbilden und Werkzeug zur Verarbeitung ihrer Produkte anschaffen können, hat er auch ein System zur Gewährung von Mikrokrediten aufgebaut. Mittlerweile beschäftigt Kéré in Burkina Faso 40 Männer dauernd mit Bauarbeiten. Im Kampf gegen die Ausbreitung der Wüste hat er ein neues Ritual eingeführt: Die Eltern in Gando pflanzen heute für jedes Kind, das auf die Welt kommt, einen Baum. Wenn das Kind zehn Jahre alt wird, muss es am Tag des neu erfundenen Baumfestes dessen Pflege übernehmen. 2010 haben die ersten Kinder aus Gandos neuer Schule die Matur bestanden. Im Dorf sind, wie erhofft, Kopien von Kérés Gebäuden aufgetaucht – nicht so präzis, aber nach denselben Prinzipien gebaut. Das Modell Gando findet internationale Anerkennung, so in Indien, Spanien, Frankreich und den USA, seit kurzem auch in der Schweiz und in Deutschland, wo Kérés Lehmbau-Idee anfänglich belächelt wurde. Beachtung findet Gando aber erfreulicherweise auch in der Region; auch afrikanische Architekten besichtigen heute die Schule.
Wissenstransfer Nord–Süd …
TU-Berlin-Absolvent Kéré bringt technologisches Wissen von Europa nach Afrika, doch lässt sich dieses nicht direkt anwenden. «Ich muss für alles eine Übersetzung suchen. Die Technologie braucht eine soziokulturelle, ökologische und ökonomische Adaption.» Damit sie unter lokalen Bedingungen funktioniert, muss sie sehr viel billiger, klimatauglich und selbstbaufähig werden. «Und Zeit! Zeit muss ich mitbringen, wenn ich nach Afrika gehe. Sonst funktioniert es nicht.» Wenn er nach Gando komme, müsse er «von 180 auf null» kommen, zunächst einmal gar nichts tun, nur dort sein. Erst dann könne er anfangen – und zwar ein Gespräch. Entwicklungsprojekte funktionierten nur über echte Partizipation, meint Kéré. Das bedeute, mit den Leuten vor Ort zu reden, zuzuhöhren und dann das Projekt zusammen zu entwickeln. So können sich die Leute damit identifizieren, das Know-how für den Unterhalt erwerben und schliesslich die Verantwortung übernehmen.
Hat Kéré in Gando auch Fehler gemacht? «Ja, viele! Aber es sind eigentlich nicht Fehler, sondern Tests: Ich muss ausprobieren, was für die Leute im Dorf funktioniert und was nicht.» Francis ist einer von ihnen – das ist ein entscheidender Grund für das Gelingen. Denn seine Vorschläge werden sofort kritisiert, wenn sie nicht brauchbar sind. Bei Fremden ziemt sich dies nicht, da sie als Gäste gelten. Deshalb gibt es gegen verfehlte Entwicklungsprojekte jahrelang keine Einwände – sie werden einfach aufgegeben, wenn die Helfer wieder gehen. Bei einem aus dem Dorf ist das anders; da kann man sagen: «Francis, spinnst du? Das geht doch hier nicht, das weisst du doch!» Dann sucht Kéré mit seinen Leuten nach einem Weg, der funktionieren kann.
… Wissenstransfer Süd–Nord
Kéré sieht aber auch in Afrika ein Reservoir von Wissen, das im Norden nützlich sein könnte. Es sind vor allem Charaktereigenschaften, die er aufzählt: Ruhe, aber auch die Fähigkeit zur Begeisterung und Identifikation mit einer Sache, die Bereitschaft, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und (in einer Kultur ohne Papiere, Baunormen und Vertragssicherheiten) Eigenverantwortung zu übernehmen. Und schliesslich, meint er, könnte das gemeinschaftliche Entwickeln von lokal und sozial angepassten Projekten aus lokalen Materialien auch in hochentwickelten Ländern mit Gewinn für die Bevölkerung und die Umwelt praktiziert werden. Kéré, der seit 2004 an der TU Berlin auch unterrichtet, glaubt, dass sein eigener Lebensweg das richtige Modell zu einer besseren Entwicklung in Afrika wäre: Allen Kindern in Entwicklungsländern den Schulbesuch ermöglichen und einige von ihnen im Norden ausbilden, allerdings ohne Bedingungen zu stellen, was sie mit dem erworbenen Wissen tun sollen. Die meisten, ist Kéré überzeugt, würden sich für die Gemeinschaft, aus der sie kommen, einsetzen, so wie er. Aber es müssten Kinder armer Leute sein, denn die Kinder reicher Afrikaner kennen die Armut und die Bedürfnisse einfacher Leute nicht.
Projekte Weltweit
Das Büro von Francis Kéré plant und baut auch weitere Projekte. Nicht alle haben mit Entwicklungshilfe zu tun. Doch Kérés Grundanliegen – ressourcenschonende Technik und lokale Materialien – kommen immer zum Tragen. In Dano in Burkina Faso ist 2007 nach den gleichen Prinzipien wie in Gando eine Sekundarschule entstanden. Kérés Entwürfe für ein Bürohaus in Ouagadougou und sein Wettbewerbsbeitrag für ein internationales Konferenzzentrum südlich der Hauptstadt sehen die Verwendung von lokalen Materialien wie Laterit und eine natürliche Klimatisierung vor. Für die neu erstellten Gebäude im Nationalpark in Malis Hauptstadt Bamako (Restaurant, Sportzentrum und Eingangsgebäude) hat Kéré aus einem lokalen Stein eine neue Fassadenbauweise entwickelt. Ebenfalls 2010 eröffnet wurde sein Besucherzentrum bei der 2006 vom Aga Khan Trust restaurierten Grossen Moschee von Mopti in Mali, das ein Museum für Lehmarchitektur enthält. Ein Mädcheninternat in Indien wurde von einer lokalen Bauleitung nach modifizierten Plänen erstellt; ein Projekt für eine Mädchenschule in Jemen ist hingegen wegen der politischen Instabilität des Landes eingeschlafen. In Dapaong im Norden von Togo ist gegenwärtig unter der Ägide der deutsch-afrikanischen Zusammenarbeit ein Ausbildungszentrum für verschiedene Berufe im Bau. Künstlerateliers und Ausstellungsräume sind Kérés Beitrag an die geplante Umwandlung eines Industrieareals im Fischereihafen von Zhou Shan in China. Auch in der Schweiz wird bald ein Werk von Francis Kéré zu sehen sein: Er wurde – neben Shigeru Ban und Gringo Cardia – auserkoren, für das Museum des Roten Kreuzes in Genf einen Teil der permanenten Ausstellung neu zu gestalten.
Ein Theater als Dorfkern
Kérés aussergewöhnlichstes Projekt ist aber das «Operndorf Remdoogo», dessen Bau vor einem Jahr in Laongo, nördlich von Ouagadougou, begonnen hat. Die erste Idee dazu hatte der letztes Jahr verstorbene deutsche Theaterregisseur Christoph Schlingensief. Eine Musikund Theaterbühne soll Kernzelle einer Entwicklung sein, die viele Parallelen mit derjenigen in Gando aufweist, aber zusätzlich den regionalen und internationalen Kulturausstausch fördern will. Im Zentrum steht die Bühne. In Burkina Faso, wo nur wenige schreiben und lesen können und Bücher rar sind, wo aber fast alle musizieren und tanzen, wo Afrikas wichtigstes Theatertreffen stattfindet und Wissen über das gesprochene Wort tradiert wird, schliesst diese Idee an eine lebendige Kultur an.
Um die Bühne herum entstehen bis 2012 eine Primarschule mit Räumen für Film-, Kunstund Musikklassen, eine Werkstatt, eine Kantine, Büros und Lagerräume, dazu Wohnhäuser für Gäste, Angestellte und Schüler, ein Café und ein Gesundheitszentrum. Darum herum kann in der Savanne ein Dorf wachsen. Alle Funktionen dienen sowohl Gästen aus dem In- und Ausland als auch der lokalen Bevölkerung. Alle Teile des Operndorfs sollen klein beginnen und dann wachsen. Auch die Schule. Sie wird als Erstes gebaut und soll einmal 500 Schülerinnen und Schülern das ABC, das Einmaleins und erste Fertigkeiten zur künstlerischen Ausdrucksfähigkeit vermitteln.
Anmerkungen:
[01] Mario Botta in der Sendung Kulturplatz im Schweizer Fernsehen, 24.11.2010
[02] Alle Zitate stammen aus einem Gespräch, das der Autor am 22.11.2010 mit Francis Kéré führteTEC21, Fr., 2011.01.14
14. Januar 2011 Ruedi Weidmann