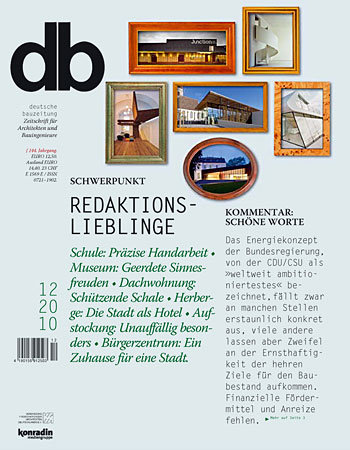Editorial
Ab dem dritten Mal, so sagt man, wird etwas zur Tradition. Wie schon in den beiden letzten Jahren widmet sich das Jahresabschlussheft der db den Lieblingsprojekten der Redakteure – ein Vorgehen, das in der Leserschaft großen Anklang gefunden hat. Die Kollegen- herzen schlagen in diesem Jahr für ein Kultur- und Bürgerzentrum im britischen Goole, eine Wohnhausaufstockung in Zürich, ein »Hotel« in Linz, dessen Räume sich wie einzelne Pixel über die ganze Stadt verteilen, eine Schule in einem Dorf in Südtirol, eine Museumserweiterung in Luxemburg und für ein futuristisch anmutendes Loft in Stuttgart. Begeben Sie sich mit uns wieder auf eine Entdeckungsreise und lernen Sie die Lieblinge der Redaktion unter dem besonderen architekturkritischen Blickwinkel der db kennen. Außerdem stellen wir in dieser Ausgabe einige ausgewählte, Gestalt prägende Produkte aus den jeweiligen Projekten vor. | red
Präzise Handarbeit
(SUBTITLE) GrundSchule und Bibliothek in Marling, Südtirol
Prominent am Berg mit herrlichem Blick auf Meran, könnte an der Stelle dieser Schule ebenso gut ein 5-Sterne-Hotel stehen. Beim Näherkommen besticht der Schul- und Bibliotheksbau, dessen Gebäudeteile in ihrem architektonischen Ausdruck Eigenständigkeit beweisen, durch präzise Entwurfs- und Ausführungsarbeit.
Marling, eine Gemeinde in Südtirol mit knapp 2 500 Einwohnern südwestlich von Meran gelegen. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 363 m über dem Meer auf einem mit Obstplantagen und Weinbergen bepflanzten Hügelgelände und ist, nicht ungewöhnlich für die Region, v. a. durch den Anbau von Tafeläpfeln sowie den Tourismus geprägt. Unterhalb des Dorfplatzes, nahe der, in ihrem heutigen Erscheinungsbild neugotisch geprägten Marlinger Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, lag das alte Schulhaus in dem die rund 150 Grundschüler des Orts eher unzulänglich untergebracht waren. So schrieb die Gemeinde 2006 einen Wettbewerb aus, der eine neue Schule sowie eine Schul- und Dorfbibliothek umfasste. Wettbewerbssieger war der Südtiroler Architekt Arnold Gapp mit einem L-förmigen Gebäude-Ensemble, das eine eindeutige, wenn auch zurückhaltend moderne Architektursprache spricht, ohne dabei die örtlichen Gegebenheiten zu ignorieren.
Wichtige städtebauliche Funktion
Während der Klassentrakt des Schulgebäudes zur Dorf abgewandten Seite in Richtung Tal ausgerichtet ist, sind die Bibliothek als öffentliches Gebäude sowie der Eingang zur Schule konsequent zum Dorfplatz hin orientiert. Es gelingt so, eine Verbindung zwischen Dorfplatz und Schule bzw. Bibliothek herzustellen. Um diese entscheidende Verbesserung der städtebaulichen Gesamtsituation zu erreichen, wurde das Gelände vor der Schule und der Bibliothek um ca. 4,45 m angehoben – es entsteht ein neuer Vorplatz und in gewisser Weise eine Erweiterung des Dorfplatzes.
Bei der Bibliothek handelt es sich um einen transparenten zweistöckigen Bau in Stahlkonstruktion mit extensiv begrüntem Flachdach, der durch seine gläserne Hülle (doppelte Verbundglasscheiben) bereits einen Blick auf die Bücherregale im Innern zulässt. Bücher hinter Glas – das war für die Bibliotheksangestellten etwas gewöhnungsbedürftig und führte (leider) dazu, dass nach Westen hin eine Sonnenschutzfolie angebracht wurde; wodurch sich, sofern die Bibliothek nicht erleuchtet ist, nun v. a. die gegenüberliegenden Fassaden spiegeln.
Um zur Kirchseite den Blick auf den Friedhof etwas abzuschirmen, wurden im unteren Teil der Fassade satinierte Gläser eingesetzt. Nach Süden überzeugt der von Anfang an vorgesehene passive Sonnenschutz: Ein vorgelagertes, begrüntes Rankgerüst, das, zusammen mit dem Pergola ähnlichen Dachrand und dem darüber liegenden Glasdach, gleichzeitig den Eingangsbereich zur Schule markiert. Die Leichtigkeit und Großzügigkeit des Äußeren setzt sich auch im Innern der Bibliothek fort: Die Galerie in dem über zwei Geschosse reichenden Raum wird ausschließlich durch Glasbrüstungen begrenzt, schlanke Stahlprofile machen die Tragstruktur elegant und filigran. Parkettböden und Decken aus furnierter Tischlerplatte mit Schallschutzeigenschaften schaffen eine ruhige Atmosphäre an den Leseplätzen auf der Galerie – und wer dennoch lieber draußen sitzen möchte, geht einfach raus auf die Dachterrasse.
Direkt an die Bibliothek schließt das neue Schulgebäude an. Ein im Wesentlichen zweigeschossiger Baukörper in spektakulärer Hanglage, dessen südlicher Teil die bestehende Turnhalle überspannt. Der ins Tal blickende Klassentrakt, der bei der Ortsanfahrt bereits weithin sichtbar ist, wird durch seine durchlaufenden breiten Fensterbänder und die vorgesetzten bzw. -gestellten Eichenstützen, die die Fensterflächen unregelmäßig gliedern, geprägt. Eine zusätzliche, ebenfalls unauffällige, aber wirkungsvolle Gliederung erfährt die Fassade durch Rankgerüste, an denen Kletterpflanzen emporwachsen. »Wenn man den Hang hinauf schaut, blickt man über die Apfelplantage mit den Stützpfählen. Diese setzen sich an der Fassade der Schule fort.« Erläutert der Architekt Arnold Gapp das Motiv. Ursprünglich waren die Pfähle sogar immer aus Eiche, inzwischen sind sie aus Beton, was der Assoziation allerdings keinen Abbruch tut.
Städtebaulich nimmt das Schulhaus die Umfassungsmauer der benachbarten Kirche auf und führt diese geschickt fort. Der Erhalt der ehemaligen Schulhofmauer auf der Ostseite führt dazu, dass sich der Baukörper aus der Ferne als flaches, liegendes Rechteck darstellt. ›
Lichte Lernräume
Die innere Organisation der Schule ist klassisch und übersichtlich. Den jeweils fünf Klassen auf jedem Stockwerk sind Sonderräume wie Werk- und Musikräume sowie Ausweichklassen gegenüber gestellt. Hier werden z. B. gehandicapte Kinder, die in Südtirol die selben Schulen besuchen, stundenweise außerhalb des Klassenverbands unterrichtet. Wenige, helle Materialien und Oberflächen kombiniert mit dezent eingesetzter Farbe dominieren alle Räume sowie die Erschließungszonen und übertragen auch beim Schulgebäude die Leichtigkeit der Fassade ins Innere: Flure und Treppen haben einen Belag aus fast weißen Naturwerkstein-Platten, die Klassen sind mit hellem Linoleum ausgelegt, das Lehrerzimmer mit Eichenparkett, die Wände sind weiß verputzt oder mit Holz bekleidet. Als zurückhaltender Farbakzent zieht sich ein helles Grün-Gelb durch das Gebäude.
Von den Klassenräumen sowie dem Lehrerzimmer hat man einen grandiosen Blick über das Tal und über Meran. Und während die Kinder die Balkone aus Sicherheitsgründen nicht betreten dürfen, können die Lehrer ihren nutzen. »Kollegen anderer Schulen sagen, wir hätten das schönste Lehrerzimmer von ganz Südtirol«, erzählt eine Lehrerin. Man könnte wohl noch hinzufügen: Auch weit über die Grenzen Südtirols hinaus.
Beide Gebäude verfügen über eine kontrollierte Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung; die Bibliothek und der Lehrerbereich können bei Bedarf zusätzlich gekühlt werden. Bibliothek und Schule werden durch eine schuleigene Heizungsanlage mit Gas beheizt.
Statische Ertüchtigung der Turnhalle
Unter dem hinteren Schultrakt liegt die neue, alte Turnhalle. Früher tief eingegraben, feucht und dunkel wurde sie im Zuge des Umbaus buchstäblich ausgegraben und ans Licht geholt. Durch die umlaufenden großen Fenster fällt von »oben« Tageslicht ein. Der Umgang mit der neu gewonnen Helligkeit muss allerdings noch gelernt werden, jedenfalls waren die Jalousien auch an einem trüben Tag Ende Oktober heruntergelassen. Lichtdurchflutet und freundlich stellte sich die Halle dennoch dar: Durch das Herausschneiden einer Wand konnte eine großzügige Besuchergalerie mit direktem, ebenerdigen Zugang von der im 1. UG verglasten Ostseite der Schule realisiert werden. Da die Statik der Turnhalle relativ schlecht war, durfte das südliche, über die Halle ragende Ende der Schule die Hallendecke nicht zusätzlich belasten. Um die Konstruktionshöhe für diese Überspannung zu erreichen, wurde der Gebäudeteil daher um 90 cm gegenüber dem Schulhof angehoben. Die Tragstruktur für die Überbauung besteht aus Stahlträgern, die auf den bestehenden Stahlbetonstützen der Halle aufliegen. Die vorhandenen Fundamente mussten dafür durch Bohrpfähle verstärkt werden.
Doch nicht nur, dass die Kinder ein großzügig gestaltetes Schulhaus bekommen haben, auch der Schulhof bietet ihnen nun ausreichend Platz. Er öffnet sich nach Süden und wird zu den drei übrigen Seiten räumlich gefasst: Im Westen durch den Geländeversprung in den große Sitzstufen aus Eiche eingeschnitten sind, im Osten durch den zweigeschossigen, zu dieser Seite weiß verputzten Klassentrakt und im Norden durch die Aula, die unter der Bibliothek liegt. Auf die Frage hin, wie den Kindern ihre neue Schule denn gefalle, antwortet die Lehrerin dann auch: »Sehr gut. Sie und auch wir Lehrer merken einfach täglich, dass das Gebäude wunderbar funktioniert.« Dann verabschiedet sie sich, und obwohl es Samstag nach 19 Uhr ist, geht sie nicht nach Hause, sondern empfängt die mit ihren Schlafsäcken anrückenden Schüler zu einer Lesenacht.db, Mi., 2010.12.01
01. Dezember 2010 Ulrike Kunkel
Geerdete Sinnesfreuden
(SUBTITLE) Kunstmuseum der Stadt Luxemburg
Mit der Erweiterung der Villa Vauban verdreifachte sich die Ausstellungsfläche der städtischen Gemäldegalerie. Das neoklassizistische Gebäude umspielt nun ein lebhaft gestalteter Baukörper, dessen Inneres ein abwechslungsreiches Gefüge aus Ausstellungssälen, Kabinetten, dramatischen Passagen und spannungsreichen Treppenfluchten bietet – Raumerlebnisse, die nicht in Konkurrenz zur Kunst stehen, sondern die Wahrnehmung schärfen und den Standort selbst zum Thema machen.
Darf man das? Ein altehrwürdiges, allen Bürgern geläufiges Baudenkmal mit einem übergroßen Raumprogramm ausstatten und es mit entsprechenden Baumassen bedrängen, den beliebten Park mit einem Querriegel verstellen, eine deutlich andere Formensprache etablieren und auch im Innenraum alles neu machen? Im Falle der Villa Vauban durfte, sollte, musste man so vorgehen. Und durch die Arbeit des Architekten Philippe Schmit mit seinem Gespür für Raum und Material hat das städtische Kunstmuseum innen wie außen Erlebnisräume hinzugewonnen, die auch die Skeptiker zeitgenössischer Anfügungen für sich einzunehmen vermögen.
Aufgefrischt und getarnt
1869 von Jean-Francois Eydt erbaut, spielte die Villa in der öffentlichen Wahrnehmung seit jeher eine große Rolle, zunächst als repräsentativer Solitär inmitten des Parks, der an die Stelle der ehemaligen Stadtbefestigung getreten war – als Hausherren folgten aufeinander drei Industrielle – dann ab 1952 als Sitz der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft, dann seit 1959 als Kunstmuseum und zwischen 1991 und 95 als Interimsresidenz des Großherzogpaares.
Trotz der reichen Geschichte des Hauses war von der historischen Ausstattung, außer opulentem Deckenstuck, kaum mehr etwas übriggeblieben – die wenigen Zierleisten verschlissen, die Holzböden aus den 40er Jahren bis auf Nut und Feder heruntergeschliffen. Philippe Schmit bewahrte, wo es noch lohnte, ergänzte behutsam, räumte aber auch beherzt auf und schuf dadurch ruhige Galerieräume, deren historische Schichten, obwohl klar voneinander geschieden, nicht in Konkurrenz zueinander treten, sondern vielmehr einen einheitlichen Raumeindruck erzeugen. Die sechs Kabinette der Villa sind schnell durchschritten – kaum verwunderlich, dass sich die Stadt nach dem Auszug des Großherzogs Gedanken über einen Erweiterungsbau machte, einen Wettbewerb ausschrieb und trotz knapper Kassenlage im zweiten Anlauf schließlich eine gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Budget um 15 % gekürzte Summe für den Bau freigab.
Der Wettbewerbsentwurf punktet mit der geschickten Verteilung der Baumassen. Zur Straße hin wirkt der Erweiterungsbau als einfacher, eingeschossiger Baukörper, entpuppt sich aus der Nähe aber als vielfältig geknickte Figur, deren Dachformen die sanften Wellen des Parks nachklingen lassen. Die Rückansicht offenbart schließlich die im Vergleich zum Altbau gewaltigen Dimensionen. Der Geländesprung in einen ehemaligen Festungsgraben hinein ermöglicht die natürliche Beleuchtung der unteren Geschosse – ein Gutteil der verdreifachten Ausstellungsfläche und weiterer Räume liegt unter der Erde. Der Neubau tritt zum Park hin mit rigoroser Geometrie kühn und breitschultrig auf. Um diesen Eindruck abzumildern und den Solitär-Charakter der Villa zumindest von der Eingangsseite her so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, bekam der Erweiterungsbau eine Art Tarnumhang: eine Lochblechhaut aus einer Rotmessing-Legierung (s. S. 33), deren einzelne Paneele in stumpfem Winkel gefaltet sind und dem Flirren und dem indifferenten Braunton von Unterholz nahe kommen. Der beabsichtigte Effekt lässt die aufgefrischten Fassaden der Villa noch stärker in den Vordergrund treten.
Sinn und Sinnlichkeit
Im Innern entwickelt Philipp Schmit ein differenziertes Spiel von räumlichen, haptischen und visuellen Eindrücken. Die Ausstellungssäle schwingen sich – ganz klassisches Museum – zu monumentaler Höhe empor, zitieren das Motiv der Enfilade und sind im Dienste der Kunst als »white cubes« definiert. Die Zugangsräume jedoch – ein L-förmig nach unten führender Abgang und ein auch das Zwischengeschoss erschließendes Treppenhaus – zwingen den Besucher, sich von der Wahrnehmung der Gemälde zu lösen und sich anderen, mehr körperlichen Eindrücken zu öffnen. Aus der Entscheidung, die Ausstellungsgeschosse nicht genau deckungsleich übereinander anzulegen und die schrägen Linien aus den Faltungen der Gebäudehülle auch innen anklingen zu lassen, gewinnen die »Zwischenräume« grafische Qualitäten und erinnern an Gemälde Lyonel Feiningers. Bei der Bewegung durch den Raum verändert sich dieses Gefüge, die Härte spitzer Winkel verschwindet, ein schmaler Gang weitet sich zu einem einladenden Vorplatz, bläuliches Zenitallicht wird vom warmen Ton der Eichenholzböden aufgefangen.
Beim Abstieg in das UG findet das Eintauchen in das Erdreich seine Material-Entsprechung in satiniertem Glas und gestocktem Beton – beide lassen sich als Sinnbilder für Himmel und Erde lesen. Vor allem die Betonoberfläche ist ein Erlebnis. Zwischen schwarzen Granit- und weißen Marmor-Zuschlägen glitzern Quarze im Streiflicht – das Mischungsverhältnis wurde in zahlreichen Versuchen ermittelt.
Am stärksten entfaltet sich die monolithische Wirkung des Materials im Treppenhaus: Beton nach allen Seiten und über Kopf. Die Arbeitsfugen sind kaum zu erkennen. Betongießer und Steinmetze lieferten ein Meisterstück ab. Die Deckenuntersichten sind von stärkerer Sedimentierung gekennzeichnet als die Wände und korrespondieren so mit den dunklen, fast schwarzen Terrazzoböden.
In allen Bereichen fällt die gestalterische Disziplin auf. Verglasungen sind ohne sichtbare Rahmen zwischen Boden und Decke eingespannt, Funktionen und Materialien sind klar zugeordnet und schließen sauber ab, Bauteile sind – mitunter durch Fugen – deutlich voneinander abgesetzt, die Anschlüsse geometrisch wohlüberlegt, selbst die nötigen Einbauten wie Belüftungsschlitze, Fluchtwegbeschilderung oder Überwachungskameras unauffällig in das Gesamtbild hineinkomponiert.
Verführt das Vestibül zwischen Foyer und Abgang noch zum kontemplativen Verweilen mit Blick auf den Garten, so konzentrieren die übrigen Räume die Wahrnehmung stark auf das Innere, Bewegung wird zum Thema. Im UG, wo der Ausstellungsbereich mit weißen Wänden klar vom Bewegungsraum abgegrenzt ist und somit zwei Gestaltungsprinzipien aneinanderstoßen, wünscht sich der Architekt ebenfalls die Präsentation von Kunstwerken. Daran haben sich die Kuratoren bislang aber noch nicht gewagt; gegen die Verengung des Raums und die Präsenz der Betonwand ist schwer anzukommen.
Genau auf solche räumlichen Experimente wollte es Philipp Schmit aber ankommen lassen. So ließ er einen schmalen Bereich im Zwischengeschoss, der durch die Drehung der Geschosse zu einer überdeckten Freifläche geworden wäre, kurzerhand verschließen und als unspezifischen Raum dem Kinderbereich zuschlagen. Der spitz zulaufende Korridor dient somit als perspektivisches Experiment, das die Raumwahrnehmung herausfordert, als ungerichteter Bewegungsraum fungiert und konsequenterweise auch nicht in eine Aussicht mündet, sondern mit einer Milchglasscheibe abgeschlossen ist und sich somit jeglicher funktionalen Deutung entzieht. Auch im UG überrascht ein extrem schmaler, dafür umso höherer Gang, der eine funktional nicht zwingend erforderliche Abkürzung um die Präsentationsräume herum bietet, und vorwiegend der Inszenierung der im Erdreich erhalten gebliebenen Festungsmauer aus Vaubans Zeiten dient. Streiflicht von oben lässt die Bossierung hervortreten, Dimension und Materialqualitäten, selbst der Duft der Mauer werden erlebbar.
Die edle Anmutung, die aus dem disziplinierten Einsatz der Materialien im ganzen Haus resultiert, geht hervorragend mit dem Villenambiente zusammen und vermeidet dabei doch jegliche Anbiederung an das verschnörkelte 19. Jahrhundert. An einigen Stellen schießt der Gestaltungswille des Architekten jedoch ein wenig über das Ziel hinaus. Die Hervorhebung der ehemaligen Außenwände der Villa im heutigen Foyer durch einen roten Anstrich erscheint ebenso entbehrlich wie die Inszenierung von Übergängen in die Nebenraumspangen durch wuchtige Stahlschleusen. Auch wirkt die Zusammenkunft verschiedener Ein-, Auf- und Durchgänge im Foyer samt bezauberndem Ausblick auf vorgelagerte Terrasse und Park zunächst irritierend. Die einfache Gestaltung des Kassenbereichs und der hier bereits großflächig verwendete Beton tragen aber viel zur Beruhigung bei.
Alle Wände und Decken, selbst das Dach sind aus Beton. Einigen Anspruch entwickelt das Tragwerk nur dort, wo die Säle nicht Wand auf Wand liegen. Ein Energiekonzept war bei Planungsbeginn 2003 noch nicht relevant. Die Lüftungstechnik, die Beheizung und Befeuchtung der Räume übernimmt, ist jedoch durchdacht. Die Klimaanlage wurde nicht auf die Jahresspitzen hin ausgelegt, sondern auf den Mittelwert. Einzelne, dem jeweiligen Raum zugeordnete Umluftgeräte steuern nach Bedarf raumweise nach.
Dadurch ergaben sich geringere Querschnitte und ließen sich niedrigere Energiekosten ansetzen. Geheizt wird mit Erdgas.
Luxemburg hat ein kleines Architekturjuwel bekommen, das ohne Getöse, dafür aber mit einer ausgewogenen Mischung aus Ernst und Freude den Ort, die Kunst und ein wenig sich selbst zelebriert.db, Mi., 2010.12.01
01. Dezember 2010 Achim Geissinger
Schützende Schale
(SUBTITLE) Dachaufstockung in Stuttgart
Hin und wieder entstehen aus einer Notlage die besten Ideen – so auch bei einer Dachaufstockung eines Gründerzeithauses in Stuttgart. Weil sich eine Eigentümergemeinschaft die Renovierung ihres Dachstuhls nicht leisten konnte, kam Architekt Florian Danner zusammen mit einem Studienkollegen zum Zug. Der Deal war so simpel wie genial: Eine »kostenlose« Sanierung im Tausch gegen neuen Wohnraum. Heute haben die Bewohner wieder ein intaktes Dach und die ehemaligen Kommilitonen erfreuen sich an ihren hochmodernen Penthouse-Wohnungen. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, dass die Aufstockung nicht historisierend die Gründerzeit »nachbaut«, sondern mutig zeigt, in welchem Jahrtausend sie entstanden ist.
Das Lehenviertel ist ein lebendiger Stadtteil mit zahlreichen, gut erhaltenden Gründerzeithäusern und wenig Parkplätzen. Konnte eine dieser raren Pkw-Abstellflächen ergattert werden, muss der Besucher den Kopf weit in den Nacken legen, um die jüngste Attraktion des Viertels zu erspähen. Das »Ufo« – so nennen es die Quartierbewohner – fällt durch seine futuristisch anmutende S-Form und strahlend weißen, homogenen Oberflächen ins Auge. Beim Betreten des Treppenhauses wird der Besucher dann zunächst wieder um einige Jahrzehnte zurückgeworfen – kein Aufzug weit und breit und die nachträglichen Einbauten sind in die Jahre gekommen. Umso bemerkenswerter ist dazu der Kontrast im aufgesattelten Dachgeschoss, das Raum für zwei (annähernd) spiegelbildlich geplante, jeweils 98 m² große Maisonette-Wohnungen bietet: z. B. schräge Wand- und Glasflächen, weitläufige Räume ohne einengende Trennwände, sichtbar gelassene, graue Stahlträger, weiße Einbau- und Küchenmöbel sowie ein heller Kalksteinboden aus Ägypten dominieren den Entwurf. Dazu ist die urbane Umgebung unmittelbar mit einbezogen: Ganzglasfassaden nach Norden und Osten geben in der nördlichen Wohnung den Blick ungehindert frei auf alte Satteldächer, Kirchturmspitzen und den denkmalgeschützten Bahnhofsturm. Eine weitere Besonderheit ist hier eine große Dachterrasse, die mit dem gleichen Naturstein belegt worden ist wie der Innenraum.
Neben dem Wohnbereich mit offener Küche befinden sich im 1. DG in jeder Wohneinheit noch ein abgeschlossener Arbeitsraum mit modernen Lamellendachfenstern (s. S. 39) sowie ein Gäste-WC. Über auskragende Stahlschwerter, die in den neuen Betonkern des aufgestockten Treppenhauses eingelassen sind, erklimmt man das 2. DG. Um die Großzügigkeit der Räumlichkeiten auch hier nicht einzuschränken, hat Architekt Danner das Bett in den Boden eingelassen und den Sanitärbereich ohne Trennwand unmittelbar zugänglich gemacht. Der Nachbar war hier zurückhaltender: Von einem »normalen« Bett aus genießt aber auch er durch Ganzglasfassaden den grandiosen Rundumblick auf Stuttgart. Eine zweite Dachterrasse nach Süden komplettiert jeweils den hohen Wohnstandard.
Genehmigungsmarathon
Soviel vorweg: Das Projekt entspricht der baurechtlichen Vorgabe nach einem Steildach. In Sachen Gestaltung war die Eigentümergemeinschaft sofort begeistert – Baurechtsamt und das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung blieben lange skeptisch.
Durch die ausgeprägte Topografie – die Kessellage – hat die »schwäbische Metropole« quasi eine fünfte Ansicht. Der Genehmigungsmarathon durch die Baubehörden der Landeshauptstadt endete nach ca. einem Jahr, als sich Bürgermeister Matthias Hahn von der Aufstockung begeistert zeigte. Ursprünglich verbotene Dachterrassen konnten als dem Entwurf geschuldete Restflächen eingestuft werden und außerdem kam man zu der Ansicht, dass die außergewöhnliche Ecksituation des Gründerzeitgebäudes ein außergewöhnliches Dach verträgt. Strenge Auflagen seitens der Behörden waren jedoch, dass der Entwurf 1:1 umgesetzt werden musste und dass nachträgliche Veränderung wie z. B. Satellitenschlüsseln und Sonnenkollektoren einer Genehmigung bedürfen – auch bei späterem Eigentümerwechsel.
Ein Brückenspezialist für die Statik
Leitidee des Entwurfs war die Vorstellung einer massiven, im Querschnitt s-förmigen Schale. Wie aus einem Guss sollte sie eine schützende Haut ausbilden, bei der Wand, Decke und Dach fließend ineinander übergehen. Um das möglichst filigran umzusetzen, zog Florian Danner seinen ehemaligen Statik-Professor Gustl Lachenmann – Spezialist für schlanke Brücken – hinzu. Die Wahl fiel auf eine Stahl-Holzkonstruktion. Nur das aufgestockte Treppenhaus ist betoniert und dient als aussteifendes Element. In diesen Betonkern eingemauerte und zusätzlich auf Stahlstützen gelagerte IPE-300- bzw. IPE-240-Stahlträger bilden das Haupttragwerk der Dachaufstockung. Die Konstruktion der geschwungen Schale – oder Muschel – hingegen besteht aus Leimholzsparren, deren Zwischenräume mit Dämmung gefüllt sind. Der Dachaufbau setzt sich mit Unterspannbahnen, Konterlattung und Lattung nach außen hin fort. Dort, wo das Dach gekrümmt ist, mussten Bögen aus der Lattung gesägt werden. Um eine absolut dichte und gleichförmige Außenhaut zu erhalten, wurde die äußerste Beplankung mit einer 3-5 mm dünnen, lichtgrauen Polyurethan-Spritzbeschichtung überzogen (s. S. 39). Eine statische Herausforderung waren außerdem die teilweise um 27 ° nach innen geneigten Ganzglasfassaden, die ohne schwerfällige Rahmenkonstruktion auskommen sollten. Nachdem sich auf dem Markt verfügbare Produkte als zu teuer erwiesen, entwarfen Architekt, Tragwerksplaner und Fensterbauer eine leichte Tragkonstruktion, bei der die schwere Zweifachverglasung – sie gilt als Überkopfverglasung – auf erstaunlich schlanken Stahlprofilen (Achsabstand = 1,25 m) aufgeklebt ist. ›
Kfw-40-Haus
Beim Energiekonzept spielt eine Luftwärmepumpe die zentrale Rolle. Da die großen Glasflächen einen hohen Sonneneintrag auch im Winter garantieren, können über das Be- und Entlüftungssystem (Wärmerückgewinnung) Heizung und Warmwasser zu einem großen Teil mit der über die Fassaden gewonnenen Energie gespeist werden. Als förderungswürdiges »Kfw-40-Haus« ist der Dachaufbau eingestuft, da der Primärenergiebedarf bei 41 und Heizwärmebedarf bei 44 kWh/m²a liegt.
Die Dachaufstockung gilt heute als Vorreiterprojekt in Stuttgart und gibt Hoffnung, dass weitere solch mutige Projekte genehmigt werden. Vor allem die häufige Vorgabe, Steildächer planen zu müssen, bereitet Architekten Kopfzerbrechen – eine eigene, zeitgemäße Formensprache wird durch strikte Bauvorschriften eingeschränkt oder gar unmöglich gemacht.
Florian Danner hat sich der Herausforderung gestellt: Ohne die rechtlichen Rahmenbedingen zu verletzen, konnte er seine Vorstellungen von moderner Architektur im 21. Jahrhundert überzeugend umsetzen. Heute fügt sich das 2009 fertiggestellte Projekt selbstbewusst in das Stadtbild ein und akzentuiert den historischen Kontext, ohne ihn unangenehm zu dominieren.db, Mi., 2010.12.01
01. Dezember 2010 Barbara Mäurle