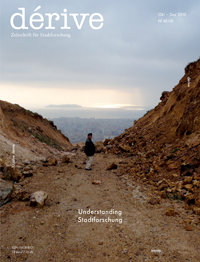Editorial
Die erste Ausgabe von dérive ist im Juli 2000 erschienen – ohne Marktanalysen und Zielgruppenbefragungen, ohne Businessplan und Marketingstrategie, dafür mit unendlicher Lust am Zeitschriften-und-Fanzines-Machen und einem breiten Interesse am Thema Stadt, das wir mangels befriedigender Alternativen ab sofort selbst zu stillen gedachten. Es gab keinen Verlag, keinen Vertrieb, kein Netzwerk und keine Institution, die uns organisatorisch oder finanziell unterstützt hätte. Die Druckkosten wurden privat vorfinanziert und dass die Arbeit ehrenamtlich war, verstand sich von selbst. Heute, nach zehn Jahren, investieren wir viel mehr Zeit in dérive und alles läuft professioneller ab, an unserer Unabhängigkeit und der Freude am Produzieren der Zeitschrift hat sich deswegen nichts geändert. (An der großteils ehrenamtlichen bzw. höchstens mit einer Aufwandsentschädigung bezahlten Arbeit übrigens leider auch nicht, wobei wir darauf mittlerweile leichten Herzens verzichten könnten – wer uns dabei unterstützen will, ist herzlich willkommen!)
Der Ansatz von dérive war und ist multiperspektivisch und interdisziplinär. Unser Ziel ist es, eine Zeitschrift auf hohem Niveau zu machen und gleichzeitig für interessierte Leser und Leserinnen aller Richtungen verständlich zu bleiben, auch wenn sie das einschlägige Fachvokabular nicht herunterbeten können. Das verstärkte Interesse, das Stadtforschung in den letzten Jahren erfahren hat, macht uns diese Aufgabe leichter, denn Termini wie Gentrifizierung oder Gated Communities muss man heute kaum noch erklären – vor zehn Jahren war das noch anders. Dieses Interesse hat auch auf deutschsprachigen Universitäten dazu geführt, dass Stadtforschung einen zunehmend wichtigeren Stellenwert einnimmt. Was für uns wiederum die spürbare Folge hat, dass die Zahl der Texte, die uns angeboten werden, ständig im Steigen begriffen ist und die Warteliste für die Veröffentlichung immer länger wird. Auf der einen Seite freut uns, dass viele, die rund um das Thema Stadt forschen, darüber in dérive berichten wollen, andererseits ist es für eine Zeitschrift, die viermal im Jahr erscheint, unmöglich, diesem hohen Interesse gerecht zu werden.
Seit einiger Zeit bauen wir deswegen an einer neuen Website: Sie wird die Möglichkeit eröffnen, mehr Texte (und in weiterer Folge auch andere Formate) zu veröffentlichen und diese durch Verschlagwortung für Leser und Leserinnen besser nutzbar zu machen. Diese neue Version der Website wird bald online gehen. derive.at wird dann weniger eng an den Inhalt des Heftes gekoppelt sein als bisher, es wird Texte geben, die im Heft nie veröffentlicht wurden, genauso wie aktuelle Meldungen und Hinweise aus der weiten Welt der Stadtforschung. Gleichzeitig wird das Archiv der dérive-Texte umfassender nutzbar und besser für das Web aufbereitet sein. Das alles stellt eine großartige Erweiterung der Möglichkeiten der bisherigen Website dar. Aber eigentlich wollen wir noch etliche große Schritte weitergehen. derive.at soll eine wirkliche Plattform für die weitverzweigte Stadtforschungs-Community werden, quer durch alle Disziplinen und offen für alle Formate der urbanistischen Auseinandersetzung, ein internationales Netzwerk jener Menschen, denen die Entwicklung des urbanen Raums ein Hauptanliegen ist. Bisher fehlt uns dafür das Geld und damit die Zeit, die vielen Ideen umzusetzen. Wer Interesse hat, sich an diesem Projekt in welcher Form auch immer zu beteiligen, als ProgrammiererIn, WebdesignerIn, Online-RedakteurIn, NetzwerkerIn, ImpulsgeberIn oder schlicht mit finanzieller Unterstützung, und uns damit hilft, schneller und besser voranzukommen, wird mit offenen Armen empfangen.
Im Zentrum unserer Tätigkeit steht aber nach wie vor die Zeitschrift dérive und das beweisen wir mit dieser 212 Seiten starken Jubiläumsausgabe, die den dreifachen Umfang einer normalen Ausgabe besitzt, nachdrücklich. Die Idee des vorliegenden Jubiläumsheftes war es, zu zeigen, woran Stadtforscher und Stadtforscherinnen heute aktuell arbeiten und welche Themen sie als relevant für die Zukunft erachten. Trotz des großen Umfangs können und wollen wir nicht den Anspruch erheben, einen kompletten Überblick zu leisten. Das ist schlicht unmöglich. Wir können aber sehr wohl behaupten, mit „Understanding Stadtforschung“ einen sehr umfassenden und interessanten Einblick in viele Forschungsdisziplinen, für die Stadtforschung von großer Bedeutung ist, zu bieten.
Die 26 Artikel, die im Heft versammelt sind, stammen von Forschenden aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die ich nicht aufzählen will und werde, weil wir die Grenzen der Disziplinen eher überschreiten als betonen wollen. Die Reihenfolge der Beiträge im Heft hat deswegen auch nicht das Geringste mit der Forschungsdisziplin zu tun, in deren Rahmen die Artikel verfasst wurden. Es empfiehlt sich, der Idee von dérive folgend, sich durch das Heft treiben zu lassen und nach Lust und Laune anzuhalten. Einige der Autoren und Autorinnen – Bernd Belina, Anja Schwanhäußer, André Krammer und Erik Meinharter – haben wir gebeten, auch über den derzeitigen Forschungsstand und die Forschungsfragen ihrer Disziplin zu berichten, um zu zeigen, was Stand der Dinge ist und in welche Richtung es gehen wird. Manche Artikel behandeln sehr spezielle Themen, darunter fällt etwa Stephan Lanz’ Beitrag über Neue Götter und Gläubige in der Stadt, der die Bedeutung neuer religiöser Gemeinschaften analysiert, oder Eyal Weizmans Text „Political Plastic“, der die Ermordung eines Hamas-Anführers in Dubai zum Anlass nimmt, sich Gedanken über die Elastizität und Neuorganisation von politischen Raumstrukturen zu machen. Andere, Marc Böhlen/Hans Frei, Manfred Russo und Klaus Selle, greifen klassische Themen der Stadtforschung auf – der öffentliche Raum darf hier natürlich nicht fehlen, entwickeln daraus jedoch ganz unterschiedliche Thesen, Perspektiven und praktische Vorschläge. Interessanterweise tauchen in diesen Beiträgen alte Bekannte wie Hannah Arendt ebenso wieder auf, wie sich (auch nicht mehr ganz) neue wie Bruno Latour immer stärker durchzusetzen scheinen. Mittels konkreter Projekte geben Andreas Novy und Sarah Habersack sowie Anne Spirn in ihren Texten Einblick in nachhaltige Wissensvermittlung zwischen Universitäten und Schulen. Da dérive auch über den deutschsprachigen Raum hinaus immer mehr an Stellenwert gewinnt, versammelt die Jubiläumsausgabe auch so bekannte Autoren und Autorinnen wie erstmals Saskia Sassen oder zum wiederholten Male Loïc Wacquant.
Einen breiten Ansatz haben wir nicht nur bei den Disziplinen, sondern auch bei den Textformen gewählt. Diese reichen von wissenschaftlichen Texten über Essays und einem manifestartigen Text von Stefano Boeri bis hin zu literarischen Texten von Herbert J. Wimmer und Thomas Ballhausen. Und wie immer gibt es nicht nur geschriebene Beiträge, sondern auch künstlerische Arbeiten, die sich mit Stadt, Öffentlichkeit und Urbanität auseinandersetzen. Zum Jubiläum sind gleich neun Kunstinserts zu sehen, was deutlich unterstreicht, wie wichtig wir die Rolle der Kunst für den Urbanismus-Diskurs erachten. Die KuratorInnen der Kunstbeiträge, Barbara Holub, Paul Rajakovics und Andreas Fogarasi, haben zu ihrer Auswahl und den KünstlerInnen und ihren Arbeiten einen einführenden Text verfasst, der auf S. 65 zu lesen ist.
Völlig neu an dérive – Sie werden es bereits bemerkt haben – ist die grafische Gestaltung. Atelier 1, das sind Anna Liska und Andreas Wesle, haben das bisherige Konzept von Andreas Fogarasi überarbeitet und weiterentwickelt. Wichtige Punkte waren dabei, die Lesefreundlichkeit weiter zu erhöhen und die Übersicht innerhalb des Heftes zu erleichtern. Wir finden das Ergebnis äußerst gelungen und hoffen, Ihnen geht es ebenso.
Die Präsentation von dérive 40/41 Understanding Stadtforschung findet am 1.10.2010 um 19 Uhr im Prechtlsaal der TU Wien statt. Die Veranstaltung bildet gleichzeitig den Auftakt zu unserem Stadtforschungsfestival urbanize!, das wir anlässlich des 10. Geburtstages aus der Taufe heben. dérive im Festivalformat bringt Filme, Lesungen, Stadtführungen und -spaziergänge, Diskussionen, Vorträge und selbstverständlich ein dérive, ein Durch-die-Stadt-Schweifen nach der Methode von laboratoire dérive, einer Gruppierung, deren Namen nicht nur zufällig Ähnlichkeit mit dem unserer Zeitschrift hat. Mehr zur laboratoire-dérive-Methode auf den Seiten 114/115. Die Programmübersicht des urbanize!-Festivals finden Sie auf Seite 3 und im Programmfolder, das ausführliche urbanize!-Programm mit allen aktualisierten Orten und Beginnzeiten auf www.derive.at.
Sie, geneigte/r Leser/in, fragen sich nun sicher, was Sie uns zum Geburtstag schenken können. Nichts leichter als das: Lesen Sie weiterhin dérive, empfehlen Sie uns Ihren Studenten und StudentInnen, Freunden und Freundinnen, verschenken Sie Abonnements und – urbanize!
Christoph Laimer
Inhalt
Globale Suburbanisierung:
Die Herausforderung der Verstädterung im 21. Jahrhundert
Roger Keil
Was wollen wir wetten?
Immobilienwirtschaftliche Spekulationen und Stadtentwicklung
Susanne Heeg
The Urbanizing
of Global Challenges Can Cities Reinvent
their Civic Capacities?
Saskia Sassen
Von der Allmacht zur Kooperation Anmerkungen zum Verhältnis von Städtebau(lehre) und Stadtforschung
André Krammer
Die Aktion ist die Form/The Action is the Form
Keller Easterling
Neue Götter und Gläubige in der Stadt
Thesen und Fragen zum veränderten Verhältnis zwischen dem Städtischen und dem Religiösen
Stephan Lanz
MicroPublicPlaces
Hans Frei, Marc Böhlen
Eingreifendes Denken Zur Aktualität Henri Lefebvres
Klaus Ronneberger
Die Koproduktion des Stadtraumes
Neue Blicke auf Plätze, Parks und Promenaden
Klaus Selle
Stadt regieren mittels Raumproduktionen im Namen der Sicherheit
Bernd Belina
Restoring Mill Creek:
Landscape Literacy, Environmental Justice, and City Planning and Design
Anne Spirn
Illegal Geographies of the City Slums in Delhi’s worldly aspirations
Ayona Datta
GartenSTADTLandschaft
Erik Meinharter
Urban Isolation and Symbolic Denigration in the Hypergetto
Loïc Wacquant
Greifbarkeit der Stadt:
Überlegungen zu einer stadt- und wissensanthropologischen Erforschung stadträumlicher Aneignungspraktiken
Alexa Färber
Stadtethnologie – Einblicke in aktuelle Forschungen
Anja Schwanhäußer
laboratoire dérive — Forschungsreisen international
dérive
Perspektiven und Herausforderungen der Stadtforschung und städtischer Bewegungen
Margit Mayer
Nachdenken über Landschaften im urbanen Kontext
Phillip Rode
SOS-Schöne-Neue-Stadt
Freerunning against Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit
Johanna Rolshoven
Political Plastic
Eyal Weizman
Arguments for a planetary Garden
Stefano Boeri
Hurrikan! Letzter Aufruf!
Thomas Ballhausen
Kunstinserts:
Rirkrit Tiravanija, Barbara Steveni, Lara Almarceguí, Stephen Willats
Seiltänze des Mittelstandes in der sich spaltenden stadt Istanbul
Orhan Esen
Private Augen
Herbert Wimmer
Charles Taylor der öffentliche Raum der Gegenwart als Rahmen des expressiven Individualismus
Manfred Russo
GartenSTADTLandschaft
Sehr gerne und sehr oft werden in Essays zur Stadt und Stadtforschung Begriffe wie Freiraum, öffentlicher Raum, Außenraum, Platz, Park, Boulevard, Garten bis hin zur Landschaft analog für den unbebauten Raum städtischer Agglomerationen eingesetzt. Welche Rolle spielt die Landschaftsarchitektur, die diesen Raum als ihr Arbeitsfeld und ihren Forschungsgegenstand definiert, bei der Erforschung urbaner Landschaften?
Freiraum
Die Definition des öffentlichen Raums, des Freiraumes der StadtbewohnerInnen, ist im Diskurs aufgrund der vielfältigen unterschiedlichen in der Stadt forschenden Disziplinen nicht eindeutig. Nicht immer ist erkennbar, welchen konkreten Raum dieser Begriff umschreibt. Ein Ansatz kann es jedoch sein zu hinterfragen, wie dieser öffentliche Raum im Hinblick auf Eigentum und rechtliche Verfügbarkeit, Lage innerhalb der bebauten Strukturen oder Materialität tatsächlich beschaffen ist. Das Forschungsprojekt StaRS1 der RWTH Aachen hat sich der Untersuchung der Konfiguration des vermeintlich Öffentlichen angenommen. Im Beitrag von Klaus Selle wird augenscheinlich, wie viele Ebenen hinter der einfachen räumlichen Situation des nicht umbauten Stadtraums verborgen sind, die direkt auf ihn einwirken. Die Frage nach der reinen Öffentlichkeit des nicht umbauten Stadtraumes stellt sich, aufgrund einer im engeren Sinne schon immer existierenden Privatisierung des Öffentlichen Raums, nicht mehr. Welchen Freiraum die StadtbewohnerInnen noch nutzen können und welche Verfügungs- und Aneignungsmöglichkeiten ihnen zur Auswahl stehen, wird in einem koproduzierten Raum eine nicht so leicht zu beantwortende Frage sein. Der gerne beschworene Vergleich mit der griechischen agora hinkt nicht nur, da diese neben ihrer Versammlungsfunktion auch Marktplatz und religiöses Zentrum war, sondern auch weil oft vergessen wird, dass an diesem gerne idealisierten öffentlichen Raum nur bestimmte Bürger Rechte besaßen.
Der individuelle Freiraum
Aufgrund des sich im öffentlichen Raum manifestierenden öffentlichen Lebens finden soziale und soziologische Ansätze seit jeher ihren Weg auch in die Profession der Landschaftsarchitektur. Partizipation und Bottom up-Planungsprozesse, Planungswerkstätten, Nachbarschaftsgärten und temporäre Gärten – all diese Strategien versuchen auf die neuen Anforderungen einer sozial nachhaltigen Entwicklung und Planung der Stadt Rücksicht zu nehmen. Sie sind jedoch sehr weiche Formen der Beteiligung von oder Aneigung durch StadtbewohnerInnen, die aufgrund der vielfältigen Verflechtungen mit anderen Themenbereichen nur selten auf stadtstrukturelle Entscheidungen einwirken können. Dass die Forderung einer Demokratisierung des Anspruches auf Raum neu wäre oder gar aufgrund eines vermeintlichen Rückzugs der Öffentlichkeit aus diesen Räumen geschieht, ist ein Trugschluss. Fundamentale Ansätze einer emanzipatorischen Stadtplanung und Stadtentwicklung fußen auf einer gesellschaftlichen Wende der 1960er Jahre des 20. Jahrhunderts, zielen auf die Veränderung des Planungsprozesses und damit auf die Änderung einer Verwaltungsstruktur. Wenige Ansätze haben sich so viele Jahre halten können wie das West Philadelphia Landscape Project, das im Artikel von Anne Spirn (ab Seite 59) vorgestellt wird. Es ist nicht der aktuellste, jedoch der über Jahrzehnte immer wieder neu entwickelte Versuch, die sozialen und räumlichen Strategien zu vereinen. Der Freiraum der Stadt ist ein Raum der allgemeinen Mitsprache. Dieser Arbeitsbereich der Landschaftsarchitektur ist also immer ein Raum mit unbestimmter, öffentlicher NutzerInnenstruktur. Diese Form der Öffentlichkeit kann nicht von einer einzigen Disziplin alleine betrachtet werden, wodurch die fast zwingende interdisziplinäre Forschung schon im Forschungsgegenstand begründet liegt.
Neue Wege der Beschreibung urbaner Freiräume
Für die Erfassung dieses Raumes der Stadt eine adäquate methodische Vorgehensweise zu finden, um mehr als nur die physischen Konfigurationen aufzunehmen, ist eine zentrale Forschungsfrage der Landschaftsarchitektur. In den letzten Jahren wurden die klassischen deskriptiven Methoden durch weichere dokumentarische Beschreibungen erweitert. Das Umherschweifen in Form einer dérive hat plötzlich eine modische Ausformung der Ortsbeschreibung erhalten und wird in universitären Projekten als Analyseform eingesetzt. Gleichzeitig wird durch Spaziergangswissenschafter wie Bertram Weisshaar, Künstler wie Boris Sieverts und Kollektive wie stalker eine abgewandelte Form als Methode zur Beschreibung von Raum eingesetzt. Wenn jedoch versucht wird, die tatsächlichen Konfigurations-, Produktions- und Verfügungsverhältnisse des Freiraums zu beschreiben, greifen – aus Gründen der Komplexität – fast alle Methoden zu kurz. Es stellt sich daher stärker denn je, wie Philipp Rode in seinem Beitrag (ab Seite 124) hervorhebt, die Frage nach dem Substantiellen des Negativraums. Die Suche nach den letzten verbliebenen unbeschriebenen Orten, die einem In-Wert-Setzen noch offen stehen, wurde schon durch Marc Augés Nicht-Orte begonnen. Dieser positiven Umdeutung des davor unbeschriebenen und abseitigen Raumes, des komplexen und unbeachteten Restraumes sind die in der Stadt tätigen Disziplinen gefolgt. Freiraum gewinnt dadurch einen Charakter des potenziellen Forschungsgegenstandes. Er bleibt Neuland für Stadtforschungsreisende.
Auch die von Charles Waldheim geprägte Wortfindung des Landscape Urbanism beruft sich auf eine Strategie der Beschreibung und Transformation des terrain vague. Aus der konservativen Utopie der Gartenstadt wurde Landscape Urbansim. Es findet ein Wechsel der Perspektive von der Parzelle und dem kleinbürgerlichen Leben hin zu städtischen urbanen Strukturen statt. Dieser Wechsel scheint mit den Begriffen Garten und Landschaft im urbanen Kontext einherzugehen. Der Garten als Ziel allen bürgerlichen Lebens steht mit der Gartenstadt im Widerspruch zur urbanen Dichte. Die Landschaft wird als Synonym für komplexere urbane Systeme dem entgegengesetzt. Landschaft ist nicht an Land und damit an den vermeintlichen Gegenpol der Stadt gebunden, auch wenn der Begriff ursächlich mit der Urbanisierung zusammenhängt. Hierzu müssen sich Forschende schon mit dem komplexen Diskurs zur Kulturtheorie der Landschaft auseinandersetzen, der maßgeblich von Ulrich Eisel geprägt wurde. Stadt ist immer abhängig von Land. Das städtische Umland ist immer stark in die Struktur und das Funktionieren der Stadt eingebunden. Schon alleine aufgrund der Güter, die in einer Stadt nicht produziert werden können, steht diese in einem Abhängigkeitsverhältnis von der sie umgebenden Landschaft. Landscape Urbanism – als Re-Import einer europäischen Tendenz der 1990er Jahre – verspricht eine Trendwende hin zum neuen Verständnis des Verhältnisses von Stadt und Landschaft. Dazu muss jedoch auch geklärt werden, was Landschaft ist.
Frei Räumen. Das Verschwimmen der Disziplingrenzen
VertreterInnen des Landscape Urbanism wie auch des Ecological urbansim, wie Mohsen Mostafavi, fordern interdiszipliäres Forschen und Arbeiten an der Stadt. Faszinierenderweise hat die ökologische Urbanistik keinen direkten Bezug zur schon seit Herbert Sukopps Entdeckung der Großstadt als Gegenstand ökologischer Forschung bestehenden Stadtökologie. Faszinierend insofern als das grundlegende Verständnis des Ökosystems Stadt eigentlich die Voraussetzung für ein ökologisches Handeln in dieser sein müsste. Der Fluss, in den nicht nur die Entwicklung der Stadt, sondern auch die Entwicklung der planerischen Methoden, mittels derer versucht wird, Stadtplanung zu betreiben, geraten ist, führt zu einer Annäherung der Methoden der Stadtplanung und des Städtebaus an die Arbeitsmethoden der Landschaftsarchitektur. Gegenstand der Bearbeitung ist eine sich permanent verändernde Struktur. Im Falle der Landschaftsarchitektur waren es die natürlichen Prozesse und die NutzerInnen, die von sich aus unausweichlich Planungen über die Zeit veränderten und dadurch den Methodendiskurs beeinflussten (vgl. das Studio Urbane Landschaften).2
Die in der Stadt in Bewegung geratenen Rahmenbedingungen führen zu neuen Methoden, die auch in der Vergangenheit streng und dirigistisch agierende Planungsbereiche aufweichen. Das Neue ist hier jedoch lediglich die Transformation der Methoden aus einer in die nächste Disziplin. Zusätzlich werden die Anforderungen an urbane Strategien in mehreren Bereichen, wie z. B. Mobilität oder Ressourcenmanagement, noch erheblich erhöht werden. Forschung wird ebenfalls multidisziplinär werden müssen, nicht zuletzt aufgrund der Nachfrage nach neuen urbanen und ökologischen Strategien, die weit mehr erforschen als die kleinklimatischen Veränderungen an Fassaden aufgrund einer vorgesetzten Begrünung. Es geht um die Erforschung einer stadtstrukturellen, interdisziplinären Integration von energetischen, ökologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Belangen im Rahmen der Urbanisierung, in der die Disziplin der Landschaftsarchitektur, wie alle andern auch, nur einen Teil abdecken kann. Bei dieser Form der multidisziplinären Arbeit muss, um eine Forderung Herbert Sukopps aufzugreifen, »die Integration (humanwissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Bereiche) professionell und nicht von den Einzelwissenschaftlern durchgeführt werden.«dérive, So., 2010.09.26
Erik Meinharter ist Redakteur von dérive, Landschaftsarchitekt, Lektor an der Universität für Bodenkultur und der Technischen Universität Wien
Anmerkungen
[1]
StaRS — Stadträume in Spannungsfeldern
[2]
Studio Urbane Landschaften wurde an der Leibniz Universität
Hannover 2005 von Hille von Seggern und Julia Werner gegründet:
www.freiraum.uni-hannover.de/391.html
Weitere Informationen
Weisshaar, Bertram: www.spaziergangswissenschaft.de
Sieverts, Boris: www.neueraeume.de
Zu Charles Waldheim und Mohsen Mostafavi siehe
Topos Nr. 71, 2010, sowie das neu erschienene Buch
Ecological Urbanism, Baden: Lars Müller Publishers, 2010
Eisel, Ulrich: www.ueisel.de
Sukopp, Herbert (2001): Rückeroberung? Natur im Großstadtbereich.
Wiener Vorlesungen, Wien: Picus
26. September 2010 Erik Meinharter
Von der Allmacht zur Kooperation
(SUBTITLE) Anmerkungen zum Verhältnis von Städtebau(lehre) und Stadtforschung
»Seit den 1990er Jahren weicht diese unselige Trennung wieder auf. Langsam schließt sich die entstandene Kluft zwischen Architekten, Stadtplanern und weiteren Disziplinen. Landschafts-
architekten entwerfen neue Stadtteile, Architekten recherchieren Sozialdaten und betreiben urbanistische Studien, Stadtplaner entwerfen urbane Events. Auch Literaturwissenschaftler schreiben über Raumtheorien, die Urbanistik wird zum Thema der großen zeitgenössischen Kunstausstellungen. Research by Design versucht Forschung und Entwerfen wieder fruchtbar zu verknüpfen. Architektur wird als die Kunst, Raum zu artikulieren (Eco, 1968) in der Urbanistik wieder aktuell. Die Kultur des Raumes wird wieder als entscheidend für die Kultur der Städte angesehen.«
Sophie Wolfrum, 2008
Von der Allmacht zur Ohnmacht
Einst sollte die neue funktionelle Stadt, wie sie die modernistischen ArchitektInnen der Congrés Internationaux d’Architecture Moderne (1928 – 1959) konzipierten, nicht nur wieder Ordnung in den chaotisch wuchernden Agglomerationen des Industriezeitalters etablieren, sondern auch unausweichlich zu einer besseren Gesellschaft führen. Der Städtebau wurde zur Königsdisziplin erklärt, zur Universalmedizin, die dem kranken Stadt- und Sozialkörper wieder auf die Beine helfen sollte. Le Corbusier hielt in den 30er Jahren die Architektur für das geeignete Instrument, um eine bessere räumliche und gesellschaftliche Ordnung herzustellen. Das neue städtebauliche System, die strahlende Stadt der Moderne sollte die Gesellschaft reformieren und auf diese Weise sogar mithelfen, Revolutionen zu vermeiden.
Wir haben uns längst von dieser Utopie verabschiedet, beziehungsweise haben wir auch den ihr innewohnenden dystopischen Charakter erkannt. Der Traum vom universalistischen Zugriff auf die Stadt und die Allmächtigkeit des Plans ist geplatzt und hat einer Vielstimmigkeit der städtebaulichen Konzeptionen Platz gemacht. Der Städtebau ist in die zweite Reihe zurückgetreten und definiert seine Position angesichts der Unübersichtlichkeit der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Kräfte, die gegenwärtig die Stadtentwicklung vorantreiben, neu. Strategische Allianzen mit benachbarten Disziplinen drängen sich auf, will man auch zukünftig eine gewichtige und keine marginale Rolle spielen.
Innerhalb der Disziplin Städtebau herrscht in Hinblick auf die Frage, was zu tun wäre, um wieder eine entscheidende Rolle in der Raumproduktion zu spielen, bestenfalls Uneinigkeit. Heute, da wir mit wohligem Schauer zusehen, wie vorgeblich unkontrollierbare globale Kraftfelder die Städte auf den Kopf stellen, haben sich die einen längst vom Traum der Allmacht verabschiedet und gelernt, die Schwäche als Chance zu sehen, während andere dem Phantomschmerz mit Nostalgie und Eskapismus begegnen und Rekonstruktionen alter Stadtmodelle wiederzubeleben suchen und allzu oft nur potemkinsche Dörfer errichten. Jenen, die sich der Tradition der Avantgarde verpflichtet fühlen, erscheint nach dem »Ende der großen Erzählungen« (Jean-François Lyotard), also auch nach dem »Ende der großen Projekte«, das Fragmentarische im dialektischen Kurzschluss als das neue Ganze. Die formalistische Avantgarde setzt nach wie vor auf das autonome Objekt.
In den letzten Jahren hat eine Hinwendung zur informellen Stadt der Armenviertel stattgefunden, die die Ränder der global cities dominieren. Die Favela entzieht sich als räumliches und legistisches System dem Zugriff klassischer Instrumente der Planung. Sie entsteht bottom up. In der Faszination, die informelle Strukturen ausüben, liegt nicht zuletzt das Bedürfnis, das Instrumentarium des traditionellen Städtebaus und die Steuerung der Stadt top down zu hinterfragen. Die Tätigkeit der Entwicklungshilfe, die meist in der Bereitstellung von dringend benötigter Infrastruktur besteht, wird vom Wunsch begleitet, von Formen der Selbstorganisation zu lernen und diese in abgewandelter Form in die eigene Praxis zu integrieren – Import-Export. Dabei muss in Kauf genommen werden, dass man einer Ästhetisierung der Armut Vorschub leistet und ökonomische und machtpolitische Hintergründe zugunsten eines romantisierenden Blicks von außen ausblendet. Nichts ist gänzlich umsonst.
Die neue Rolle zwischen Plan und Wirklichkeit und die Macht der Bilder
Die vielen »Learning from …« verweisen unter anderem im positiven Sinn darauf, dass, da keine Disziplin das Primat in der Herstellung und Erforschung von Stadt für sich allein beanspruchen kann, auch der Städtebau sich zunehmend als ein Player unter anderen versteht. Die Dialektik des Lernens von der Wirklichkeit und der Transformation von Wirklichkeit kann auch als ein fruchtbares Zusammenspiel von Hermeneutik (Verstehen und Lernen) und Handeln (Vita activa) angesehen werden. Die Grenzen der eigenen Disziplin müssen nicht mehr schamhaft verborgen werden, sondern können auch als Potenzial begriffen werden. Die Geschwindigkeit der Stadtentwicklung im »Zeitalter der Städte« erzwingt eine Öffnung der Disziplin, will man sich nicht mit Scheingefechten im Elfenbeinturm zufriedengeben. Es mutet ja auch seltsam an, hinter verschlossenen Türen fröhlich über die »gute Stadt« zu debattieren – nebenbei ohne wirkliche Chance auf Einigung – während draußen vor der Tür Stadtregionen unter rasant steigenden Urbanisierungsraten geradezu explodieren, andere Städte wiederum implodieren und schrumpfen, um das Bild dezent zuzuspitzen. Es bedarf zunehmend eines strategischen Denkens und Handelns, neuer kommunikativer Skills und auch neuer kollektiver Anstrengungen, um sich auf der stadt- und regionalpolitischen Ebene Gehör zu verschaffen. Die traditionelle Fixierung des Städtebaus auf einen idealisierten Endzustand spielt dabei eine immer geringere Rolle. Die Projektbegleitung und Qualitätssicherung während der Realisierungsphase hat in jenem Maß an Bedeutung gewonnen, als sich die Kluft zwischen Plan und realer Entwicklung ausgeweitet hat. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt ein Projekt, einen Plan, eine Strategie. Die »eigenschaftslose Stadt« (Rem Koolhaas), die Endless City der Suburbia verzichtet ja weitgehend auf Planung. Der Planer, die Planerin übernimmt heute im Idealfall neben den klassischen Aufgaben der Planung auch die Rolle des Moderators und der Dramaturgin, aufgrund der spezifischen Raum-(strategischen) Kompetenz und der integrativen Funktion der Formgebung, die der Städtebau einbringen kann.
Allerdings ist das Phänomen der longue durée, das Nachwirken von alten Strukturen unter der Oberfläche des Neuen, nicht zu vernachlässigen. Während einerseits die PlanerInnen aus guten Gründen nicht mehr einfach ausschließlich als »Herren und Damen der Pläne« und als SchöpferInnen großartiger Panoramabilder auftreten können, ist gleichzeitig feststellbar, dass gerade heute wieder allzu eingängige Bilder zukünftiger Projekte Hochkonjunktur haben. Auch in Wien setzt die Politik gerne auf die Stadtvision als großes Gemälde, etwa auf die etwas autistisch anmutende Seestadt mit zentraler Wasserskulptur. Einprägsame Bilder und Labels sind verführerischer und leichter vermarktbar als ein schwer vermittelbares Konzept einer prozessualen Planung und Umsetzung, die nicht primär über Bilder funktioniert, sondern notwendige Leerstellen belässt, um auf künftige Entwicklungen reagieren zu können. Die Einbettung der Seestadt in ihr Umfeld bleibt da auf der Strecke. Die Dominanz der Bilderwelt degradiert die Stadt zur Bühne und Marketingfläche. Unter diesen Vorzeichen ist der Städtebau gefährdet, zu einer postmodernen Übung in Simulation zu verkommen. Wo primär Bilder reproduziert werden und die Alltagskultur ausgeblendet wird, entstehen Retorten. Am Berliner Potsdamer Platz treten die herbeigesehnten Flaneure höchstens in Form von Hologrammen auf. Die mittelalterliche Stadt, die wir im Urlaub aufsuchen, ist nicht das Produkt eines ästhetischen Programms, sondern die Manifestation der spezifischen Gesellschafts- und Wirtschaftsform des Feudalismus. Der Städtebau ist schon deshalb keine Bilderfabrik, da die Arbeit am städtebaulichen Plan keine direkte Arbeit am Objekt ist. Ein Maler oder Bildhauer bearbeitet sein Medium direkt, die ArchitektInnen und PlanerInnen bedienen sich eines Instrumentariums, wie Pläne, Regelsysteme etc., die der Materialisierung vorgeschaltet sind. Zwischen Plan und Wirklichkeit besteht a priori eine Differenz.
Universeller Partikularismus: Endlose Interieurs und die Wiederentdeckung der Infrastruktur
Welche Gefahren bergen der Partikularismus und die pluralistische Perspektive auf die Stadt, die den Universalismus abgelöst haben? Die Stadt, die aus divergierenden Einzelinteressen zusammengesetzt wird, gerät leicht zum Patchwork, das kein kongruentes Ganzes mehr ausbildet, sondern sich zunehmend als Ideensammlung ohne Zusammenhang präsentiert. Auch der urbanistische Diskurs spiegelt einen Zustand der Fragmentierung wider. Forschungsprojekte, Informationen, Datenbanken und Publikationen sind weit gestreut und werden nur selten (interdisziplinär) in Beziehung gesetzt. Im Städtebau und der Städtebauforschung führte dieser Umstand zu einer intensivierten Beschäftigung mit klein- und großmaßstäblichen Infrastrukturen, die die Hardware der Raumentwicklung ausbilden und in der Lage sind, die Stadtpartikel wieder zusammenzubinden. Wie der Stadtgrundriss, der die historischen Relationen der Stadt überliefert, bilden diese die Grundlage für das Funktionieren der Stadt aus. Auch scheinbar banale und große Programme wie Einkaufzentren oder Freizeitkomplexe werden wieder in die avancierte Theorie und Praxis inkludiert. Expandierende Indoor-Welten prägen immer mehr die urbane Landschaft. Diese Interieurs konkurrieren mit dem klassischen öffentlichen Raum, der im Zentrum der städtebaulichen Kunst steht. Das Verhältnis zwischen Innen und Außen hat sich nachhaltig verschoben, die Quantität der Außenhülle nimmt proportional mit der Zunahme der Indoor-Fläche ab. Hatte die Erfindung des Aufzugs durch Otis eine neue Morphologie der Städte ermöglicht, so generiert das Air-Conditioning eine neue Kultur der Fläche. Neue mediale Kommunikationsformen, die das Internet ermöglicht, gehen mit Raumstrukturen neuartige Kombinationen ein. In den jüngsten Protesten in Teheran
spielte der mediale Raum (Twitter, Blogs etc.) eine dem Stadtraum zumindest gleichwertige Rolle.
Die Krise und das Zeitfenster
Die jüngste Finanzkrise, insbesondere das Platzen der US-amerikanischen Immobilienblase, das zum Symbol für eine fehlgeleitete Raumpolitik avanciert ist, hat auch Risse in der Legitimation der unternehmerischen Stadt hinterlassen. Die Konzeption einer Stadt, die sich nach Marktgesetzen selbst generiert, darf wieder laut hinterfragt werden. Der Leerraum, den der jüngste Crash hinterlassen hat, wäre in einen Freiraum für Ideen und Konzepte umzudeuten. Auch Wien ist eine Stadt, die sich im Laufe der Geschichte immer wieder maßgeblich transformiert hat. Die Gründerzeit, Otto Wagners infrastrukturelle Erneuerungen oder die Wohnbaupolitik des Roten Wien prägen die Stadt bis heute. Es gäbe also eine Tradition von mutigen und visionären städtebaulichen Ideen und Konzepten, an die man anknüpfen könnte.
Der Städtebau in der Forschungslandschaft
Wie sieht es mit dem Verhältnis zwischen Stadtforschung und Städtebau aus? Sicherlich können andere Forschungsfelder, insbesondere die Stadtforschung, nicht als Pool fungieren, aus dem der Städtebau allzu leichtfertig Legitimation für seine Konzepte bezieht. Ein Auftritt im Gewand des Soziologen, des Philosophen oder des Psychoanalytikers etc. wäre ein bereits überwunden geglaubter Anachronismus. Der Glaube an die Möglichkeit einer Ableitung der Stadt von morgen aus statistischen Kennzahlen ist (glücklicherweise) längst aufgegeben. Und dennoch ist der städtebauliche Entwurf auch in der postheroischen Zeit, ob bewusst oder unbewusst, immer ein Weltentwurf in Miniatur, eine Stellungnahme, die auf die weltanschauliche Position eines Autors, einer AutorIn oder von AutorInnen verweist.
Der Städtebau agiert zwangsläufig auch auf einer sozialen, politischen und sprachlichen Ebene und berührt somit auch andere Forschungsbereiche und Praktiken. Er agiert in Theorie und Praxis inmitten der Gesellschaft. Genau darin liegt nach wie vor die Faszination dieser Disziplin. Sie stellt unweigerlich große Fragen. Der Stadtentwurf weist immer auch über die Grenzen der Disziplin hinaus. Etwa die Frage, was unter Urbanität zu verstehen und wie diese zu konzipieren und in Realität umzusetzen wäre, lässt sich nur im interdisziplinären Dialog aushandeln. Neue ökologische Herausforderungen, sich verändernde Arbeitswelten oder neue Migrationsbewegungen wirken sich direkt auf die urbane Gegenwart und somit auf die künftige Konzeption von Stadt aus. Die neue Rolle des Städtebaus verlangt nach einer interdisziplinären Offenheit und Kooperationsbereitschaft, um auf der Höhe der Zeit agieren und der Dynamik der Stadtentwicklung gerecht werden zu können. Multiperspektivität ist so gesehen eine Chance und ermöglicht erst den kritischen Diskurs. Dialog und Kooperation bedeuten nicht zwangsweise die Aufkündigung jeder Differenz, die Auflösung der Kompetenzen der Einzeldisziplinen und den Eintritt in einen lähmenden Konsens. Nachdem es das eine, heilbringende System nicht gibt, kann die Zukunft der Stadt nur kollektiv ausgehandelt werden. Dazu müssen die Einzelakteure vom Sockel steigen, den Elfenbeinturm verlassen, in die Stadt hinaus gehen, sich auf dérives im Raum und in der Theorie einlassen – auch wenn damit eine Ambivalenz zwischen Faszination und Kritik verbunden ist, die schon Walter Benjamins Denken angesichts der modernen Metropole bestimmte. Der amerikanische Architektur- und Systemtheoretiker Christopher Alexander propagiert eine Stadt, die sich aus komplexen Überschneidungen von Aktivitäten im Raum generiert. Das Gleiche kann und sollte man für den interdisziplinären Stadt-Diskurs einfordern.
Die Städtebaulehre zwischen Lehrbuch und Kompetenzvermittlung
Die Städtebaulehre ist in vielen Ländern wie auch in Österreich Teil der Architekturausbildung und wird im Studienplan hinsichtlich des angebotenen Lehrumfangs geradezu stiefmütterlich behandelt. Das hängt auch damit zusammen, dass die ArchitektInnen und StädtebauerInnen traditionell in Personalunion auftreten, obwohl die beiden Tätigkeiten zumindest teilweise gänzlich unterschiedliche Anforderungen stellen und der Städtebau keinesfalls nur als Anhängsel der Architektur betrachtet werden kann. Städtebau ist nicht einfach »Architektur in einem größeren Maßstab«. Rem Koolhaas hat in diesem Zusammenhang gar einmal von Schizophrenie gesprochen, die vonnöten wäre, um simultan als Architekt und Städtebauer zu arbeiten. Während ein architektonisches Projekt vom Entwurfsgedanken bis zur Schlüsselübergabe in Form einer fortschreitenden Präzisierung abgewickelt wird, operiert der städtebauliche Entwurf mit Simulation und einer notwendigen Unschärfe, da er nur das Rahmenwerk, nicht aber die detaillierte Ausführung der Einzelobjekte definiert und Entwicklungen in langen Zeiträumen, oft viele Jahre bis Jahrzehnte, antizipieren muss. Während ein architektonisches Objekt perfektioniert werden kann, ist das städtebauliche Objekt mit Fehlern, Missverständnissen, Unzulänglichkeiten und Unkontrollierbarem konfrontiert. Eine geglückte Entwicklung emanzipiert sich oft vom zugrunde liegenden Masterplan in Form einer Neuinterpretation und profitiert doch vom Rahmenwerk. In der Städtebaulehre sollte die Diskrepanz zwischen Plan und Wirklichkeit thematisiert werden und die Frage gestellt werden: Was kann Planung heute leisten, was muss sie definieren und festhalten und was darf und muss sie offen lassen? Städtebau ist ein Training im dialektischen Denken. Um handlungsfähig zu bleiben, müssen in der Analyse die Wirklichkeit und der Kontext gefiltert, abstrahiert und repräsentiert werden. Die Lehre muss – in kurzer Zeit – ein objektivierbares Wissen (wie wird ein städtebauliches Projekt entwickelt, argumentiert und repräsentiert) und (intellektuelle) Kompetenzen vermitteln, die immer wichtiger werden, um später in Diskurs und Praxis bestehen zu können. Diese Kompetenzen sind auch die Voraussetzung dafür, in den interdisziplinären Dialog eintreten zu können. StudentInnen bringen glücklicherweise geradezu ideale Vorraussetzung mit: Sie sind per se aufgrund ihrer Lebensphase intensive und kompetente StadtnutzerInnen, sind geübt in der Fähigkeit Stadt zu lesen, sind offen für die Auseinandersetzung mit urbanen Phänomenen und bringen somit die beste Voraussetzung mit, Stadt zu gestalten. Die Kompetenz, sich auf einer diskursiven Ebene in Form kommunikativen Handelns mit städtebaulichen Fragestellungen auseinanderzusetzen, wäre schon die ideale Voraussetzung, sich auch in der Welt der Stadtforschung zurechtzufinden.
Anmerkungen zu ausgewählten Beiträgen dieser Ausgabe
Diese Jubiläumsausgabe versammelt interessante Stimmen, die sich gegenwärtig mit aktuellen urbanistischen Fragestellungen auseinandersetzen, die auch für den städtebaulichen Diskurs von Bedeutung sind. Auf vier davon möchte ich besonders hinweisen.
Der Architektur- und Stadtforscher Eyal Weizman berichtet von jenem Mord im Junkspace (Assassination in Junkspace), der gerade noch die Medien beschäftigte. Am 19. Jänner 2010 wurde in Dubai das Hamasmitglied Mahmoud al Mabhouh – wahrscheinlich von Mossad-Agenten – ermordet. Zahllose Sicherheitskameras zeichneten Fragmente dieses Vorgangs in einer Serie von Innenräumen auf, die kein Außen zu haben scheinen. Die Videos kursierten bald darauf im Internet. Eyal Weizman nimmt dieses Ereignis zum Anlass, die machtpolitischen Implikationen dieser überwachten Räume (Flughafen, Luxushotel, Shopping-Mall) zu hinterfragen.
Der Stadtforscher Stephan Lanz berichtet von einem gerade anlaufenden, groß angelegten Forschungsprojekt, das sich dem Verhältnis zwischen dem Städtischen und dem Religiösen widmet. War man lange Zeit davon ausgegangen, dass der globale Urbanisierungsschub mit einer zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft einhergehen würde, so kann man gegenwärtig von einer Rückkehr des Religiösen in die Stadt sprechen. Stephan Lanz skizziert auf den Seiten 32ff. die Themen, Fragestellungen und Methoden, die dem aktuellen Forschungsprojekt Global Prayers: Ein transdisziplinäres Forschungs- und Kulturprojekt zugrunde liegen. In acht Städten wurden wissenschaftliche und künstlerische Fallstudien initiiert: Rio de Janeiro, Jarkata, Mumbai, Lagos, Beirut, Istanbul, London und Berlin.
Stefano Boeri, italienischer Architekt und Urbanist, steuert ein Manifest in einer an sich an Manifesten armen Zeit bei (Seite 143ff.). Arguments for a planetary garden ist ein Plädoyer für eine neue, nicht-anthropozentrische urbane Ethik, für eine neue Geographie des Urbanen, Ländlichen und Natürlichen, die den einzelnen Sphären wieder spezifische Qualitäten zurückgeben will und die Rückgewinnung des Einflusses auf (über)regionale Entwicklungen zum Ziel hat. Der Text ist im Rahmen der Entwicklung eines Konzepts für das Ausstellungsgelände der Weltausstellung 2015 in Mailand Feeding the planet, energy for life entstanden. Ein ökologischer Turn hätte das Potenzial, Stadt wieder vermehrt als ein Ergebnis kollektiver Anstrengung zu begreifen.
Die amerikanische Architektin und Urbanistin Keller Easterling erforscht seit Jahren das Verhältnis von Globalisierung zu Architektur und Stadt. Easterling spiegelt in ihren Essays, die eine hochkomplexe Sprache und thematische Dichte auszeichnet, die Transformationen globaler Räume wider und schafft so wie niemand sonst Sprachkunstwerke, die für sich stehen können und doch so viel über unsere Gegenwart zu erzählen wissen. Empfohlen sei auch Easterlings Essaysammlung Enduring innocence. Global architecture and its political masquerades, die 2005 bei MIT Press erschienen ist.
The Action is the Form in dieser dérive-Ausgabe ist ein Vorabdruck eines Essays, der 2011 veröffentlicht werden wird. Die Übersetzung, die wir zusätzlich in diesem Heft zum englischen Original abdrucken, ist eine Premiere im deutschen Sprachraum. Es ist unserem Wissen nach der erste Text von Keller Easterling, der ins Deutsche übersetzt wurde. Die Aktion ist die Form thematisiert die Disposition von Gegenständen, Gebäuden, Infrastrukturen und Technologien, als Akteure tätig zu werden, zu handeln und uns zu beeinflussen.dérive, So., 2010.09.26
André Krammer ist Redakteur von dérive, Architekt und Lektor an der TU Wien.
Literatur:
Christopher Alexander (2010): Eine Muster-Sprache: Städte, Gebäude, Konstruktion. Wien: Löcker Verlag.
Jochen Becker (2001): Bigness — Kritik der unternehmerischen Stadt. Size does Matter. Image / Politik. Städtisches Handeln. Berlin: b_books.
Becker, Burbaum, Kaltwasser, Köbberling, Lanz, Reichert (2003): metroZones 2. Learning from*. Städte von Welt, Phantasmen der Zivilgesellschaft, informelle Organisation. Berlin: NGBK.
Keller Easterling (2005): Enduring innocence. Global architecture and its political masquerades. London: The MIT Press.
Angelus Eisinger (2006): Die Stadt der Architekten. Anatomie einer Selbstdemontage. Basel: Birkhäuser.Robin Evans (1997): Translations from Drawing to Building and Other Essays. London: Architectural Association.
Eric Mumford (2000): The CIAM Discourse on Urbanism, 1928–1960. London: The MIT Press.
Sophie Wolfrum (2008): Multiple City. Berlin: Jovis Verlag.
26. September 2010 André Krammer
Stadtethnologie – Einblicke in aktuelle Forschungen
In Hamburg, Deutschlands Boomtown und Stadt der meisten Millionäre, ist vergangenes Jahr etwas Bemerkenswertes geschehen: Der Senat hat ein Areal, das bereits an eine international agierende Immobilienfirma verkauft war, zurückerworben und sich damit dem Protest gegen Gentrifizierung gefügt. Zur selben Zeit wurde im neuen Studiengang Kultur der Metropolen an der noch jungen Hafencity-Universität der Lehrplan verabschiedet. Ein Studiengang, der sich u. a. mit urbanen Subkulturen befasst. Studienschwerpunkte sind Kultur- und Wahrnehmungstheorien, Geschichte der Metropolen und Methoden der Stadtanalyse. Dass beides relativ zeitgleich geschieht, ist kein Zufall. Die Stadt entdeckt die Kultur – als etwas Schützenswertes, zu Förderndes, zu Erforschendes. Kultur nicht (nur) im Sinne von Hochkultur – Museen, Theater, Konzerthäuser –, sondern auch im weiteren Sinne als ganze Lebensweise, als „whole way of life“ (Williams 1983, XVIII). Im Gängeviertel will man nun die Mischung aus der dort ansässigen, eher proletarischen Bevölkerung und den Kreativen bewahren, im Studiengang Kultur der Metropolen will man Stadt nicht mehr nur als gebaute Umwelt begreifen1, sondern auch als gelebten kulturellen und sozialen Zusammenhang. Die Bedeutung lokaler Milieus, ihres Eigensinns, ihrer Kreativität und ihrer besonderen Lebensweise wird zunehmend wahrgenommen. Diesen neuen Ansätzen ist auch dérive verpflichtet, die die Stadt als Ort gesellschaftlicher Entwicklungen begreift, wobei die Stadtethnologie bisher nur indirekt vertreten war. Die Jubiläumsausgabe ist ein passender Anlass, ihre Grundannahmen, ihre institutionelle Verankerung sowie aktuelle Forschungen vorzustellen.
Stadtethnologie: The City goes soft
Stadtethnologie, wie die empirische Metropolenkulturforschung auch genannt wird, ist keine gesonderte wissenschaftliche Disziplin, sie ist vielmehr ein bestimmter Denk-, Forschungs- und Argumentationsstil, der sich aus unterschiedlichen akademischen Traditionen speist.2 An Universitäten im deutschsprachigen Raum hat sie sich an Instituten der Europäischen Ethnologie, Kulturanthropologie und Empirischen Kulturwissenschaften institutionalisiert und somit in jener Disziplin, die früher Volkskunde genannt wurde und sich später in verschiedene Namen aufgespalten hat. Die Auseinandersetzung mit urbanen Themen fand aufgrund des volkskundlichen Erbes mit Verzögerung statt – die Volkskunde befasste sich ursprünglich bekanntermaßen mit bäuerlichen Traditionen und einfachen Gesellschaften, also gerade nicht mit der Stadt.3 Der städtische Raum zählt aber inzwischen zu den zentralen Forschungsfeldern der Europäischen Ethnologie. Rolf Lindner, Professor für Stadtforschung am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin, ist der Regisseur des genannten Hamburger Lehrplans.4
Die Stadtethnologie begreift Städte als »Gesellschaftslabore der Moderne und Spätmoderne, in denen soziale und kulturelle Entwicklungen in Gang gesetzt und verdichtet werden« 5. Sie sind symbolische Ordnungsräume, die das Verhalten der Individuen und Gruppen formen und von ihr geformt werden. Fragen, die diese Forschungsrichtung beschäftigen, sind u. a.: Wie leben Individuen im urbanen Raum? Was sind ihre Routinen, ihre Träume und Ängste? Wo gibt es Konflikte zwischen sozialen Gruppen? Und gibt es so etwas wie eine geteilte urbane Erfahrung? Der Blick richtet sich auf die konkreten Lebenswelten der Stadtbewohner und -bewohnerinnen, ihre Wohnungen, Arbeitswelten, Freizeitgewohnheiten und Wege durch die Stadt, aber auch die Medien, Moden und Vergnügungen, die Stadt als »Zone intensiven Lebens«, wie sie Filippo Tommaso Marinetti im futuristischen Manifest bezeichnet hat. Nicht zuletzt findet dabei auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Ordnungsstrukturen statt, die durch den gebauten städtischen Raum entstehen.
Um diese »Soft City« (Raban 1998) zu erkunden, arbeitet die Stadtethnologie mit der ethnografischen Methode der Feldforschung. Durch teilnehmende Beobachtung vor Ort möchte sie gesellschaftliche Prozesse aus der Perspektive der AkteurInnen verstehen. Der Forscher bzw. die Forscherin durchläuft mehrmonatige Aufenthalte in den Milieus und erfährt dadurch eine Art »Sozialisation« (Schmidt-Lauber 2007, S. 220) in der beforschten Gruppe. Er oder sie erhält eine intime Kenntnis. Feldforschung als »totale Immersion« (Lindner 2003, S. 186) in eine andere Lebenswelt bedeutet dabei auch das Eintauchen in Vorstellungs- und Diskursräume: Fachpresse, Rechtsdiskurse, mediale Diskurse, Belletristik, Kinofilme, Theaterstücke, Anekdoten, Redensarten, Witze zum jeweiligen Thema sind wichtige Daten für die Stadtethnologie. Wahrnehmungsspaziergänge und sinnesgeleitete Methoden schärfen zudem das Gespür für die imaginäre Seite der Stadt, für Orte, Situationen und Atmosphären. Mit Methoden wie Mapping (u. a. Wildner 2004) und »Go-alongs« (Kusenbach 2003), bei denen die Beforschten auf ihren Alltagswegen begleitet werden, kann die sozialräumliche Bedeutung der Stadt ermittelt werden.
Die Konjunktur der Stadtethnologie
Die ethnologisch-kulturanalytische Auseinandersetzung mit Stadt liegt im Trend, was sich durch diverse Neugründungen wie den beschriebenen Studiengang Kultur der Metropolen zeigt, an denen Stadtethnologen und -ethnologinnen maßgeblich beteiligt waren. In Berlin gibt es gleich mehrere Initiativen zur Erforschung urbaner Kulturen: 2006 wurde das an der Humboldt-Universität zu Berlin ansässige Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung gegründet, eine Initiative, die u. a. auf Wolfgang Kaschuba, am selben Institut wie Rolf Lindner tätig, zurück geht. Eine weitere neuere Einrichtung ist das Transatlantische Graduiertenkolleg: Geschichte und Kultur der Metropolen im 20. Jahrhundert, das u. a. mit ethnografischen Methoden arbeitet. Ebenfalls in Berlin gibt es am Institut für Europäische Ethnologie seit einigen Jahren das Labor Stadtanthropologie, in dem u. a. die Professorinnen Alexa Färber (siehe ihren Beitrag ab Seite 100), Beate Binder und Regina Römhild aktiv sind. 6 In Darmstadt haben Martina Löw und Helmuth Berking mit anderen ProfessorInnen 2004 den Forschungsschwerpunkt Stadtforschung ins Leben gerufen, bei dem ethnografische Methoden stark vertreten sind, vor allem durch Silke Steets. Beim Campus-Verlag geben Löw und Berking seit 2008 die Reihe Interdisziplinäre Stadtforschung heraus, bei der mit weichen Methoden lokale Stadtkultur in Geschichte und Gegenwart erforscht wird. Seit jeher stark ist die ethnologische Stadtforschung am Institut für Kulturanthropologie in Frankfurt/Main, etabliert von Ina-Maria Greverus und weitergeführt von Gisela Welz. Welz hat bereits 1991 eine Studie zu Street Life vorgelegt, zurzeit leitet sie ein Forschungsprojekt zur Neuordnung der Stadt im neoliberalen Zeitalter. Der stadtethnologische Analyseansatz soll ermitteln, wie in Aushandlungsprozessen zwischen städtischen Akteuren und Akteurinnen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Medien und Wissenschaft ein kulturelles Projekt entsteht, mit dem sich die Gesellschaft diskursiv in Prozessen der Modernisierung, Europäisierung und Globalisierung positioniert. Thomas Hengartner (früher Hamburg, nun Zürich) ist Experte für Stadtforschungen in der Geschichte der Volkskunde. In Tübingen, wo die Reformierung der Volkskunde maßgeblich vorangetrieben wurde, leisten die Studien zu Popular- und Populärkultur einen zentralen Beitrag zur Stadtforschung.
In Österreich wird Stadtforschung schwerpunktmäßig in Graz am Institut für Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität bei Elisabeth Katschnig-Fasch betrieben. Die neue Leiterin des Instituts, Johanna Rolshoven, wird diesen Schwerpunkt noch ausbauen (siehe Beitrag ihren Beitrag in diesem Heft ab Seite 129). In Wien wird gerade ein Schwerpunkt Stadtforschung durch die neue Leiterin Brigitta Schmidt-Lauber eingerichtet, Expertin für Mittelstadtforschung. Hier arbeiten auch Bernhard Fuchs und Klara Löffler, die sich u. a. mit urbanen migrantischen Communities bzw. mit Tourismus befassen. Darüber hinaus finden sich stadtethnologische Forschungsansätze jenseits der Disziplin, wie bei den Kulturtheoretikerinnen Elke Krasny und Irene Nierhaus, um nur zwei zu nennen, deren Urbanographien auch in der Europäischen Ethnologie rezipiert werden (Krasny 2008).
Aktuelle Forschungen in der Stadtethnologie
Die Ethnologie als Wissenschaft von der Gesellschaft hat auf Grund ihres weichen Forschungsansatzes ein besonderes Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen und urbane Problemlagen. Sie erforscht, was große gesellschaftliche Umwälzungen für den Einzelnen im Alltag bedeuten. Demzufolge entsprechen aktuelle gesellschaftliche Konjunkturen auch den Konjunkturen innerhalb des Faches.7 Im Folgenden sollen einige aktuelle Forschungsfelder der Stadtethnologie vorgestellt werden, die freilich nicht den Anspruch erheben, das Feld in Gänze zu repräsentieren. Da es sich um ein relativ kleines Fach handelt, kann man nicht wirklich von Konjunktur sprechen, weil mitunter nur eine Person so etwas wie einen Trend setzt. Dennoch können bestimmte Linien ausgemacht werden, über deren aktuelle Relevanz wohl ein fachlicher Konsens besteht.
»Proll«-Kulturen
Die unsicher werdenden Lebensverhältnisse, die Verbreiterung unterbürgerlicher Schichten und die Abkehr vom Mobilitäts- und Aufstiegsglauben haben im Fach zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit diesem Feld geführt. Während allerdings Politik und Medien erst in den letzten Jahren Begriffe wie Unterschicht8 und Prekariat entdeckt haben, hat die Stadtethnologie diese immer schon als ein Kernfeld behandelt. Zu den Standardwerken zählt die Einführung Ethnographie popularer Kulturen (Warneken 2006), womit unterschichtliche Kulturen gemeint sind, sowie der von Rolf Lindner herausgegebene Sammelband Unterschicht (Lindner 2008). Die andere Kultur der sozial Marginalisierten gerät in den Blick und mit ihr die Frage nach der Spezifik popularer Stile und Codes sowie der Art und Weise, wie sie sich Medien und Objekte der Massenkultur aneignet, um mit ihrer Situation umzugehen – Aneignung ist ein Begriff, den die Stadtethnologie von den Cultural Studies übernommen hat (Willis 1981).
Die Forschungen von Moritz Ege (Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin) und Stefan Wellgraf (Transatlantisches Graduiertenkolleg: Geschichte und Kultur der Metropolen im 20. Jahrhundert) versprechen neue Einblicke in die Unterseite der Stadt. Moritz Ege untersucht jugendkulturelle Stile und Klassifizierungspraxen im Kontext von HipHop und Rap. Für seine Forschung bei den Berliner Atzen und Gangstern, wie sich die Jugendlichen bezeichnen, besuchte Ege über einen längeren Zeitraum regelmäßig Akteure der Szene (weniger Akteurinnen, denn die Kultur ist männlich dominiert), ging mit ihnen aus und schaute mit ihnen Youtube-Videos, spazierte mit ihnen durch die Stadt und führte Interviews mit Verkäufern und Verkäuferinnen der einschlägigen Modeläden. Durch Konsumpraktiken (Picaldi-Jeans) und Selbst-Inszenierungen wird ein bestimmter Proll-Habitus kreiert und bestätigt. Es entsteht eine unterschichtliche Kultur, bei der der niedere soziale Status und die Stigmatisierungen von außen positiv umgedeutet und zu einer Quelle von Stolz und Anerkennung werden. Zugleich zeigt Ege, wie in der Szene reflexiv mit der Figur des Prolls umgegangen wird, man Proll also nicht einfach nur ist, sondern sich auch reflexiv dazu verhält. In ähnlicher Weise untersucht Stefan Wellgraf in seiner Ethnografie von Berliner HauptschülerInnen, wie sich soziale Gegensätze durch kulturelle Prozesse manifestieren, wie man nicht nur Proll ist, sondern auch durch Schule, Gesellschaft und Staat zum Proll gemacht wird. Ove Sutter (Wien) befasst sich mit den Erzählungen und Selbst-Deutungen einer prekarisierten Mittelschicht.
Die Rolle von Architektur und Stadtraum im Zusammenhang mit Marginalisierungsprozessen untersucht die Grazerin Johanna Rolshoven und knüpft damit an einen seit Mike Davis’ City of Quartz (1991) wichtigen Diskurs an. Stadtpolitische Maßnahmen von Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit schließen unerwünschte Staatsbürger aus dem öffentlichen Raum zunehmend aus (siehe Rolshovens Beitrag ab Seite 129). Ein inzwischen abgeschlossenes Projekt hat sich in Graz mit dem Bürgerschreck Punk empirisch auseinandergesetzt (Reiners, Malli & Reckinger 2004). Zu diesem Thema fand unlängst auch am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung die Konferenz Banlieue Europa? Jugendunruhen – Stadt – Migration statt, die länderspezifische Zusammenhänge zwischen Ausgrenzung junger Menschen, Stadtstruktur, Integrationspolitik und Jugendkulturen untersuchte und debattierte.
Dérive
Dérive, also das Umherschweifen im Stadtraum, bedeutet nach der Definition der Künstlergruppe Situationistische Internationale, die bekanntermaßen so etwas wie das Copyright auf den Begriff haben: »Eine oder mehrere Personen, die sich dem Umherschweifen widmen, verzichten für eine mehr oder weniger lange Zeit auf die ihnen im allgemeinen bekannten Bewegungs- bzw. Handlungsmotive, auf ihre Beziehungen, Arbeits- und Freizeitbeschäftigungen, um sich den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden Begegnungen zu überlassen.« (Debord 1995 [1958], S. 64)
Diese 1958 erfundene psychogeografische Praxis ist als Methode und Perspektive auf Stadt in den letzten Jahren auch in der Stadtethnologie äußerst populär geworden – die Zeitschrift dérive hat dabei durch ihre Namensgebung und inhaltliche Ausrichtung eine Vorreiterrolle gespielt. Sie geht einher mit einem Bedeutungsaufschwung atmosphärischer und sinnlicher Stadterkundungen, die sich international u. a. in der von David Howes herausgegebenen Serie Sensory Formations manifestiert. Eine der ersten, die neben dem Klassiker Atmosphäre (Böhme) im deutschsprachigen Raum sinnliche Ethnologie betrieben haben, ist Regina Bendix, Leiterin des Instituts für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Regina Bendix kritisiert den »Occularzentrismus« (Bendix 2006, S. 73) in der Wissenschaft, also den Schwerpunkt auf das Sehen (Text und Ratio), und betont »die Rolle der Sinne in Kommunikation und kultureller Praxis« (ebd., S. 72).9
In der ethnografischen Praxis findet dieser Ansatz vor allem in der Szene-Forschung Anwendung, wie ihn Kira Kosnick (ehemals Professorin am Institut für Kulturanthropologie der Universität Frankfurt/Main, inzwischen bei der Soziologie an der selben Universität ansässig) und ich (zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien) verfolgen. Er geht zurück auf die Arbeiten des internationalen Forschungsprojekts Culture of Cities. Toronto, Montreal, Berlin, Dublin (York University, Toronto), das Szenen als zentrale urbane Akteure in die Forschung eingeführt hat (Blum 2001). Szenen sind fluide soziale Formationen, die durch ihre Zusammenkünfte an spezifischen locations in der Stadt, ihre Inszenierungen und spektakulären Konsumpraktiken (Musik, Mode, Lifestyle) die Atmosphäre einer Stadt maßgeblich prägen und Stadt als Ort der Sinne wahrnehmen und produzieren.
Kosnick leitet derzeit ein europaweites Forschungsprojekt zu Postmigrant Youth Scenes in Urban Europe. Das Projekt erforscht neue Formen öffentlicher Sozialität junger Menschen mit Migrationshintergrund im Kontext urbaner Clubkulturen in drei europäischen Städten. In vergleichender Perspektive wird das Phänomen ethnischer Clubszenen mit türkischer, südasiatischer, maghrebinischer und subsaharischer Orientierung in Berlin, London und Paris entsprechend der mehrheitlichen Migrantengruppen in der jeweiligen Stadt und dem jeweiligen Land untersucht. Ziel des Projektes ist die Erforschung von Formen sozialer Beteiligung und kulturellen Experimentierens junger Menschen, die für das Leben in Metropolen charakteristisch sind und bislang als nicht relevant für das Leben ethnischer Minderheiten angesehen wurden. 10 Mein Beitrag zum Thema Szenen ist die ethnografische Erforschung des Berliner Techno-Undergrounds, der im Stadtraum umherschweift und Brachen und Leerstände zu temporären locations umfunktioniert (Schwanhäußer 2010). »Raumästhetik«, wie es die Szene nennt, also die sinnliche Wahrnehmung und Inszenierung von Gebäuden und urbanen Lücken, ist eine Schlüsselpraxis. Die Ethnografie zeigt, wie durch Szenen die Grenzen von Subkultur und Mainstream verwischen und das Imaginäre der Stadt geformt wird: Berlin als Stadt im ewigen Wandel wird durch die sich gleichermaßen permanent wandelnden Szenen sinnlich erfahrbar.
Weitere Beiträge zur sinnlichen Ethnologie leisten Elke Gaugele, Gabriele Mentges und Heike Jenß durch ihre Studien zu Mode und Konsum. Darüber hinaus öffnet sich die Stadtethnologie dort, wo es um ästhetische Erfahrung geht, der Kunst, worauf im Ausblick eingegangen werden wird.
Urban Assemblages
Ebenfalls fluide Formationen nehmen aktuelle Studien in den Blick, die sich bei aller gebotenen Vorsicht für Vereinheitlichungen unter dem Begriff Urban Assemblages subsumieren lassen. Bei diesem Ansatz geraten in Anlehnung an Bruno Latour (2005) die Artefakte und Technologien von Mobilität in den Blick. Der Stadtethnologe Ignacio Farias, ehemaliger Doktoratsstudent am transatlantischen Forschungskolleg in Berlin, hat jüngst ein Buch mit dem selben Titel herausgegeben (Farias und Bender 2010), in dem urbanes Handeln durch ein Zusammendenken von »human and non-human aspects of city-life« (ebd., Vorbemerkung, ohne Seite) untersucht werden: »from nature to socio-technical networks, to hybrid collectivities, physical artefacts and historical legacies« (ebd.). Diesem Ansatz liegt die an Michel de Certeaus Taktiken erinnernde These zu Grunde, dass die Stadt nicht als geschlossener geografischer Raum betrachtet werden kann, sondern sich erst durch Bewegung von Menschen und Objekten konstituiert sowie durch die facettenreichen Verbindungen, die dadurch entstehen. Verkehr und Infrastruktur – U-Bahnen, Autobahnen, Busse – sind folgerichtige Forschungsobjekte.11 Bezeichnenderweise ist der Band in Schwarz gehalten, man sieht Schemen von Wolkenkratzern wie hinter einer Wolke von Smog. Eine ökologische Kritik an der Stadt als technologischem System, den Umweltverschmutzungen, die sie produziert, findet zwar nicht diskursiv statt, schwingt in der Ästhetik aber mit.
Weitere Mobilitätsforschungen finden sich in der Stadtethnologie vor allem im Bereich Migration, u. a. von Regina Römhild, Alexa Färber (beide am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin), Sabine Hess (Institut für Europäische Ethnologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität) und Bernhard Fuchs (Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Wien). Sie verabschieden sich von der klassischen Community-Forschung, die migrantische Gruppen als ethnische und räumliche Einheit betrachtet, hin zu einer Perspektive, die die Mobilität der Akteure und Akteurinnen in den Blick nimmt, bei der die Stadt nicht immer Ziel der Migration ist, sondern zum Transit-Ort werden kann.12 Exemplarisch sei hier nur auf ein über die Grenzen der Akademie hinaus beachtetes Studienprojekt von Sabine Hess hingewiesen, das konsequent durch eine transnationale Perspektive geprägt ist. Die Stadt (München) wird in einem globalen Netz von Bewegungen und Verbindungen betrachtet, das von Migranten und Migrantinnen direkt durch ihre täglichen Mobilitätspraktiken, ihre Kommunikationen, durch Güter-, Geld- oder Wissenstransfers errichtet wird. Die Ergebnisse wurden nicht nur in einem Katalog (Hess, Bayer und Moser 2009), sondern auch durch eine Ausstellung vorgestellt, an der sich viele internationale KünstlerInnen beteiligten, womit sich die Wissenschaft zur Kunst öffnet und umgekehrt.13 Eine weitere, global mobile Gruppe sind Korrespondenten und Korrespondentinnen. Ihnen hat sich Angela Dressler (2008) in einer äußerst erhellenden multilokalen Feldforschung angenähert. Dressler erfindet eine neue Sprache globaler Ströme.
Das imaginaire der Stadt
Städte sind Schaltzentralen des globalen Kapitalismus. So beschreibt sie die Stadtsoziologin Saskia Sassen (Sassen 1991). Dieser ökonomischen Perspektive stellt die aktuelle Stadtethnologie eine kulturelle entgegen. Als Entgegnung auf die globale Städtekonkurrenz führt sie, angeregt durch Rolf Lindner, den Habitus bzw. das Imaginaire der Stadt an (Lindner 2008). Damit verlagert sich auch die Perspektive von Kulturen in der Stadt zur Kultur der Stadt. Nicht mehr nur wird gefragt, was städtisches Leben in der Stadt auszeichnet, sondern auch, was ein der jeweiligen Stadt gemäßer Lebensstil sein könnte, welche spezifischen Haltungen, Institutionen und Figuren aus ihr hervorgehen, was die gelebte Eigenart der Stadt ausmacht, warum sie so ist und nicht anders. An die Stelle einer anthropology in the city tritt die anthropology of the city (Hannerz 1980, S. 3). Rolf Lindner leitete 2005/6 zusammen mit Johannes Moser (inzwischen Leiter des Instituts für Europäische Ethnologie an der Ludwig-Maximilans-Universität in München) ein Studienprojekt zur Residenzstadt Dresden, bei dem gezeigt wurde, wie sich Städte gemäß einer »Pfadabhängigkeit« entwickeln (Lindner und Moser 2006, S. 21). Soziale Strukturen und Ökonomien sowie kulturelle Vorstellungen und mediale Repräsentationen prägen die individuelle Stadtatmosphäre und machen die Stadt widerständig gegen globale Nivellierungsprozesse. Rolf Lindner schreibt, dass das »Klischee« von Dresden als »Elbflorenz« im wörtlichen Sinne zu begreifen ist, nämlich als »Druck- und Prägestock« (ebd., S. 13), das es sowohl in kleinen alltäglichen Praktiken wie in großen ökonomischen Projekten auffindbar ist und die städtische Wirklichkeit maßgeblich gestaltet.
In unterschiedlichen Formen findet sich dieser Ansatz in vielen aktuellen Fachdiskussionen.14 Als konsequenter Analyseansatz ist er bisher vor allem in der historischen Stadtethnologie vertreten. Lutz Musner hat eine Studie zur Geschmackslandschaft der Stadt Wien durchgeführt (Anm: siehe Besprechung in dérive 37), wobei er vor allem durch seine historische Herleitung überzeugt, u. a. durch eine »Archäologie der Gemütlichkeit« (Musner 2009). Vom historisch arbeitenden Stadtethnologen Jens Wietschorke, der bisher einzelne Aufsätze zum Thema verfasst hat, sind in Zukunft vielversprechende Arbeiten zu erwarten (siehe u. a. Wietschorke 2009). Eine Verschränkung von historischer Analyse und zeitgenössischer ethnografischer Forschung bleibt jedoch ein Desiderat.
Ausblick: Ethnografie und Kunst (Ökologie, Stadtspiele); Stadt und Architektur
Die skizzierten Forschungsfelder werden aller Voraussicht nach auch in näherer Zukunft die stadtethnologische Debatte prägen, weil sie auf aktuelle gesellschaftliche Prozesse reagieren. Die Erforschung von Proll-Kulturen, der sinnesgeleitete Forschungsansatz, dérive als Methode und Forschungsgegenstand, die Erkundung urbaner Atmosphären wird in der Fluid Society zum wichtigen Instrumentarium. Vielversprechend ist dabei die Annäherung an künstlerische Praktiken, wie es zum Teil bereits geschieht. Sowohl Regina Römhild als auch Sabine Hess suchen in ihren Arbeiten zu Migration nach neuen Repräsentationen von Wissen, das erwähnte Projekt Crossing Munich sowie Projekt Migration sind Beispiele hierfür. Rolf Lindner hat vor einiger Zeit ein Studienprojekt zu Sensing the Street durchgeführt.15 Es ist anzunehmen, dass dabei der florierende Bereich der Urban Games verstärkt auf ethnografisches Wissen zurück greift. Beim Berliner Projekt Dolmusch X-press des Künstlerkollektivs Raumlabor, das im Berliner Stadtteil Kreuzberg für mehrere Wochen ein alternatives Transportsystem organisierte, waren Alexa Färber und ich an einem vorbereitenden Pilotprojekt beteiligt, bei dem Studierende der Europäischen Ethnologie und anderer Disziplinen den Stadtteil erkundeten. Beim im Rahmen der diesjährigen Wiener Festwochen (Into the City) durchgeführten Projekt Schwellenland von Matthaei und Konsorten wurde ich als ethnologische Beraterin hinzugezogen. Theatergäste spielten Flüchtlinge, Aus- und Einbürgerung wurde als urbanes Abenteuer inszeniert.16 Auch als Forschungsgegenstand geraten Art Worlds zunehmend in den Blick (Binder 2008, Greverus 2009). Die Stadtethnologie reagiert damit auf eine Entwicklung, die sich auf der Seite der Kunst schon vor einiger Zeit vollzogen hat, nämlich die Öffnung zur Wissenschaft und Urbanitätsdiskursen, der sich die jüngst auch eine Ausgabe von dérive zu Kunst und urbaner Entwicklung widmete (dérive 39/2010).
Darüber hinaus ist zu vermuten, dass sich die Stadtethnologie über die Auseinandersetzung mit Atmosphären auch dem Bereich Ökologie annähern wird, der angesichts des globalen Klimawandels und einer Krise der Beschleunigung ein drängendes Thema darstellt. Wie Gernot Böhme anmerkt, mangelt es der naturwissenschaftlich verstandenen Ökologie an einer ästhetischen Dimension (Böhme 2003, S. 141). Auseinandersetzung mit Assemblagen, mobilen Artefakten und Technologien werden sich vermutlich in Zukunft verstärkt mit alternativen Formen von Mobilität befassen. Ein Utopie-bejahendes Konzept zwischen Wissenschaft und Kunst verfolgt das von mir initiierte Projekt HorseArt, das durch die Auseinandersetzung mit Pferden und Reitkultur neue Perspektiven auf Stadt, Natur und Mobilität entwickelt.17
Last but not least wird sich die kulturelle Perspektive der Stadtethnologie auch auf die gebaute Umwelt ausweiten. Pionierarbeit leistet hier die Reihe Architext des Routledge-Verlags, die Gebäude nicht nur als materielle Objekte, sondern auch als soziale Objekte begreift, die mit Bedeutung aufgeladen sind und soziale Beziehungen in der Gesellschaft formen. Die bereits mehrmals erwähnte Johanna Rolshoven vertritt die International Association for Cultural Studies in Architecture und war am Zürcher Projekt ETH Wohnforum, ETH Case beteiligt. Beate Binder hat vergangenes Jahr eine Studie zum Berliner Schlossplatz vorgelegt. Sie hat Aktivisten und Aktivistinnen sowie Planern und Planerinnen zugehört, war an Aktionen und Veranstaltungen beteiligt, folgt den zentralen Argumentationsfiguren der Schlossplatzdebatte und zeigt, wie durch solche Konflikte die Hauptstadt Berlin hervorgebracht wird und am Schlossplatz – der bis auf weiteres ein Provisorium bleibt – zu einem symbolischen Ort findet (Binder 2009).
Die Entdeckung der Stadtkultur seitens der Akademie wie der Stadtpolitik, wie sie eingangs am Beispiel Hafencity-Universität dargestellt wurde, ist jedoch nicht immer von Vorteil für die Stadtkultur. Im Stadtmarketing soll Kultur, verstanden als die Summe der öffentlichen und kommerziellen Dienstleistungen, die Standortwahl von Unternehmen zukunftsträchtiger Branchen positiv beeinflussen. Die Hafencity-Universität selbst war ein Stadtentwicklungs-Tool. Der Hafenbezirk sollte durch die Ansiedlung von Institutionen wie Universität und Elbphilharmonie symbolisch, sozial und ökonomisch aufgewertet werden. Dadurch wurde ihm die klassische Hafen-Atmosphäre – eine Zone für Huren, Herumtreiber und Spelunken – genommen. Die wichtigste Aufgabe der Stadtethnologie ist deshalb in Zukunft, der Verflachung des Kulturbegriffs zum städtischen Dienstleistungsangebot mit dichten Beschreibungen der Vielfalt urbaner Milieus, auch und gerade marginalisierter Milieus, entgegen zu wirken und dabei die eigene Verstrickung in die Stadtpolitik zu reflektieren.dérive, So., 2010.09.26
Anja Schwanhäußer lebt als Stadtethnologin in Berlin und Wien. Sie war Project Researcher am internationalen Forschungsprojekt »Culture of Cities. Toronto, Montreal, Berlin, Dublin« und arbeitet zurzeit als Universitätsassistentin am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Soeben erschien ihre Ethnografie Kosmonauten des Underground. Ethnografie einer Berliner Szene.
Literatur
Blum, Alan (2001): Scenes. In: Public. Cities/Scenes, Heft 22/23. Toronto,
S. 7 — 35.
Binder, Beate (2008) (Hg.): Kunst und Ethnographie. Zum Verhältnis von visueller Kultur und ethnographischem Arbeiten. Münster: Lit Verlag.
Binder, Beate (2009): Streitfall Stadtmitte. Der Berliner Schlossplatz. Köln u. a.: Böhlau.
Böhme, Gernot (2003): Soziale Naturwissenschaft. In: Udo E. Simonis (Hg.): Öko-Lexikon. München: Beck.
Davis, Mike (1991): City of quartz. Excavating the future in Los Angeles. London u. a.: Verso Books.
Debord, Guy (1995 [1958]): Theorie des Umherschweifens. In: Ohrt, Roberto (Hg.): Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten. Hamburg: Edition Nautilus.
dérive. Zeitschrift für Stadtforschung. H. 39, 2010.
Dressler, Angela (2008): Nachrichtenwelten. Hinter den Kulissen der Auslandsberichterstattung. Eine Ethnographie. Bielefeld: Transcript
Färber, Alexa (Hg.) (2005): Hotel Berlin. Formen urbaner Mobilität und Verortung. Münster u. a.: Lit-Verlag.
Greverus, Ina-Maria (2009) (Hg.): Aesthetics and anthropology. Performing life — performed lives. Münster u. a.: Lit Verlag.
Hess, Sabine; Bayer, Natalie & Moser, Johannes (2009) (Hg.): Crossing Munich. Beiträge zur Migration aus Kunst, Wissenschaft und Aktivismus. München: Silke Schreiber.
Krasny, Elke & Nierhaus, Irene (2008): Urbanografien. Transdisziplinäre Stadtforschung. Berlin: Reimer.
Kusenbach, Margarethe (2003): Street phenomenology. The go-along as ethnographic research tool. In: Ethnography, Vol. 2(3), S. 455 — 485
Hannerz, Ulf (1983): Exploring the City. Inquiries toward an Urban Anthroplogy. New York: Columbia University Press
Lang, Barbara (1994): Unter Grund. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde.
Latour, Bruno (2005): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University Press
Lindner, Rolf (2003): Vom Wesen der Kulturanalyse. In: Zeitschrift für Volkskunde 99, S. 177 — 188, Tübingen.
Lindner, Rolf (2008): Textur, ›imaginaire‹, Habitus. Schlüsselbegriffe der kulturanalytischen Stadtforschung. In: Helmuth Berking, Martina Löw (Hg.): Die Eigenlogik der Städte. Neue Wege für die Stadtforschung. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Lindner, Rolf (2008) (Hg.): Unterschicht. Kulturwissenschaftliche Erkundungen der »Armen« in Geschichte und Gegenwart. Freiburg i. Br., Wien u. a.: Rombach.
Lindner, Rolf & Moser, Johannes (2006): Dresden. Ethnografische Erkundungen einer Residenzstadt. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
Musner, Lutz (2009): Der Geschmack von Wien. Kultur und Habitus einer Stadt. Frankfurt/New York: Campus.
Raban, Jonathan (1998): Soft City, London: Picador.
Reiners, Diana, Malli, Gerlinde & Reckinger, Gilles (2004): Bürgerschreck Punk. Lebenswelten einer unerwünschten Randgruppe. Forschungsbericht im Auftrag des Magistrats der Stadt Graz, Graz.
Sassen, Saskia (1991): The Global City. New York. London. Tokyo. Princeton: Princeton University Press.
Schmidt-Lauber, Brigitta (2007): Feldforschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung. In: Silke Göttsch/Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin: Reimer.
Schwanhäußer, Anja (2010): Kosmonauten des Underground. Ethnografie einer Berliner Szene. Frankfurt/New York: Campus.
Warneken, Bernd Jürgen (2006): Die Ethnographie popularer Kulturen. Eine Einführung. Wien u. a.: UTb.
Welz, Gisela (1991): Street life. Alltag in einem New Yorker Slum. Kulturanthropologie Notizen 36. Frankfurt/M: Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie.
Wietschorke, Jens (2009): »Wien leuchtet«. Urbane Lichtregie und die nächtliche Ordnung des Raums. In: kuckuck. Notizen zur Alltagskultur 2
Wildner, Kathrin (2004): Möglichkeiten der Kartierung in Kultur- und Sozialwissenschaften. Forschungsausschnitte aus Mexiko-Stadt. In: Möntmann, Nina (Hg.), Mapping the City — Hamburgkartierung. Ostfildern: Hatje Cantz
Williams, Raymond (1983): Culture and Society. 1780 — 1950, New York: Columbia University Press.
Willis, Paul (1981): Profane Culture. Rocker, Hippies. Subversive Stile der Jugendkultur. Frankfurt/Main: Syndikat.
Anmerkungen
1
Ursprünglich sollten an der Hafencity-Universität nur die harten Disziplinen wie Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik und Stadtplanung angeboten werden. Dem Zug der Zeit folgend, ergänzte man diese durch weiche Zugangsweisen, neben Kultur der Metropolen auch Urban Design.
2
Wichtige Einflüsse erhielt sie von der Chicagoer Schule der Stadtforschung, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstmalig die Großstadt mit den ethnografischen Methoden der Feldforschung zu untersuchen begann, sowie von den britischen Cultural Studies, die urbane Popular-, Sub- und Konsumkulturen zum Gegenstand systematischer Forschung machten.
3
Die Einführung der Stadtforschung geschah im Zuge der Reformierung des Faches (bei der auch die Rolle der Volkskunde in der Geschichte, insbesondere im Nationalsozialismus, kritisch aufgearbeitet wurde).
4
Rolf Lindner, ursprünglich Soziologe, hat die Stadtforschung der Chicago School und die Cultural Studies nach Deutschland und Österreich gebracht.
5
Labor Stadtanthropologie am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin, 1. 8. 2010, www.euroethno.hu-berlin.de/forschung/labore/stadtanthropologie.
6
Auch das Institutskolloquium des Instituts für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin befasste sich dieses Jahr mit der Ethnografischen Stadt.
7
Wobei andererseits eine gewisse Trägheit nicht von der Hand zu weisen ist, wie die späte Einführung der Stadtforschung in das ehemalige Volkskunde-Fach zeigt.
8
Im deutschen Bundestag gab es 2006 eine Debatte, ob der Begriff Unterschicht stigmatisiert (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 16. 10. 2010). Sieht man ihn als Ausdruck einer sozial determinierten Kultur, bezeichnet er jedoch treffend die kollektive Erfahrung einer ins soziale Abseits, also »nach unten« verdrängten Gruppe.
9
Siehe auch: CCA Montreal Sensing and the City und das Wiener Projekt Duft – Haptik (Peter Payer).
10
Siehe auch Embedded Industries. Cultural entrepreneurs in different immigrant communities of Vienna, ein Wiener Kooperationsprojekt der Institute Europäische Ethnologie und Volksmusikforschung, http://euroethnologie.univie.ac.at/index.php?id=19288.
11
Die Ethnologin Barbara Lang hat bereits 1994 eine viel beachtete Studie zur U-Bahn herausgebracht (Lang 2004).
12
Siehe auch den von Alexa Färber herausgegebenen Sammelband Hotel Berlin (2005).
13
Crossing Munich, Studienprojekt und Ausstellung, 2.8.2010, http://crossingmunich.org/ausstellung.html
14
Auch außerhalb der Europäischen Ethnologie wird Rolf Lindners Konzept aufgegriffen, am prominentesten in dem von Martina Löw geleiteten Forschungsschwerpunkt Eigenlogik der Stadt. Durch ihre starke mediale Präsenz wird Martina Löw vom Fachpublikum sowie von urbanistisch arbeitenden Künstlern und Künstlerinnen oft sogar fälschlicherweise als Urheberin jenes Denkansatzes gesehen.
15
www.sensingthestreet.de.
16
Schwellenland, Einführung, 22. 4. 2010,
www.schwellenland.at.
17
Siehe auch: Donkey X-press. Slow Trip. Langsame Fortbewegung ist jetzt modern. In: Dolmusch X-press. Katalog, hg. von raumlaborberlin. Leipzig 2007.
26. September 2010 Anja Schwanhäußer