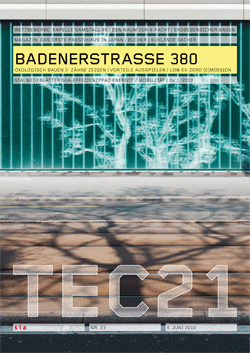Editorial
Pool Architekten aus Zürich haben mit dem Wohn- und Geschäftshaus Badenerstrasse 380 den ersten Zürcher Bau fertig gestellt, der dem SIA-Energieeffizienzpfad zur 2000-Watt-Gesellschaft folgt (vgl. TEC21-Dossier vom März 2010, «Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft», S. 44 ff.). Mutig ist die städtebauliche Figur im Blockrandkontext, die die bauliche Dichte zur Strasse verringert und die Wohnungen gezielt verdichtet. Davon profitieren sowohl der Stadt- als auch der Innenraum. Dabei nimmt das Gebäude durchaus Bezug auf ältere Bauten an der Badenerstrasse: Die Hausnummern 330–334 etwa kombinieren eine der zahlreichen, für die Badenerstrasse typischen Garagen im Erdgeschoss mit Wohnetagen, die bis auf zwei Eckrisalite von der Strasse zurückgesetzt sind – dazwischen liegt eine grosse Dachterrasse.
Auch das Haus Nummer 75 zeigt diesen Typus, allerdings noch etwas früher und mit einer ornamental geschmückten Fassade. Überzeugend ist ausserdem die Organisation der lang gestreckten Wohnungsgrundrisse, die trotz – oder gerade durch – ihre einfache Struktur grosse innenräumliche Qualitäten erzeugen.
Die Kritik fokussiert auf die Fassadengestaltung. Die bewegte Abwicklung und die grauen Fassadenelemente strömen einen industriellen Chic aus, der sich hart an der Grenze zum Trashigen bewegt und bei mittleren Jahrgängen ungute Erinnerungen an die 1970er-Jahre wecken dürfte. Dabei ist der Bauablauf geradezu ein Gegenentwurf zu Industrialisierungs- und Automatisierungsbestrebungen in der Bauindustrie. Da die Bauherrschaft aus zahlreichen kleineren Baufirmen besteht, wurde der Bauablauf auf deren Kapazität abgestimmt. Zu diesem Zweck wurde auch der Holzbau ganz pragmatisch eingesetzt. Das kleinteilige System ist einfach, mit geringem Maschineneinsatz zu errichten und dient der Grauenergiereduzierung sowie der CO2-Speicherung. Im fertigen Gebäude ist von der Holzstruktur nichts mehr zu sehen. Sichtbares Holz ist kein zwingendes Attribut für einen ökologischen Vorzeigebau. Innen sorgen Gipsvorsatzschalen für ein weisses Ambiente, und aussen prägt eine Hülle aus Glasfaserbetonelementen das Bild. Der gewisse «Seventies-Retro-Look» zieht viele junge Interessenten an: Für die 54 Wohnungen gab es zu viele ernsthafte Mietinteressenten, sodass schnell alle Einheiten vermietet waren.
Die Frage, wieweit energetische Vorgaben den Entwurf und die Gestaltung eines Gebäudes beeinflussen (dürfen), stellt sich den Planenden vehement, und Antworten können wie beim Prototyp an der Badenerstrasse nur interdisziplinär gefunden werden. Sicher steht das Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft noch am Anfang, und wir werden in Zukunft Lösungen sehen, die sich heute noch kaum jemand vorstellt.
Alexander Felix
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neubau Kapelle Samstagern | Den Raum ver-x-facht | Erdbebensicheres Bauen
12 MAGAZIN
Das erste Passivhaus in Japan | Bücher | Zug: Gartenanlagen dokumentiert | Kühlende Dächer
17 PERSÖNLICH
Ämter und Ehren
22 ZÄHNE ZEIGEN
Alexander Felix
Architektur: Pool Architekten und die Baugenossenschaft Zurlinden realisierten an der Badenerstrasse in Zürich den Prototyp eines Gebäudes nach dem SIA--Effizienzpfad zur 2000-Watt-Gesellschaft.
28 VORTEILE AUSSPIELEN
Markus Schmid
Bauingenieurwesen: Die Planungs- und Bauprozesse liessen viel Raum für innovative Konzepte und Problemlösungen. Ein «unsichtbares» Arbeitsfeld, das konsequent bewirtschaftet wurde.
33 LOW EX-ZERO (E)MISSION
Adrian Altenburger
Haustechnik: Nebst der Realisierung eines 2000-Watt-kompatiblen Neubaus wurde zusätzlich der hochwertige Anteil der Energie, die Exergie zur Deckung des Bedarfs, reduziert und mit einem CO2-freien Betrieb sichergestellt.
39 SIA
Delegiertenversammlung 1/2010 | Offenes Diskussionsforum | Merkblatt SIA-Effizienzpfad Energie | Merkblatt Mobilität | Exkursion: Neue Wohnmodelle Zürich
44 FIRMEN
45 MESSE
Vom 15. bis 17. Juni 2010 findet erstmals die «Blue&Green» statt, eine lösungsorientierte Fachmesse für die Bereiche Energie und Umwelt.
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Vorteile ausspielen
Auf den ersten Blick verrät der kürzlich fertiggestellte Neubau an der Badenerstrasse 380 in Zürich nichts Besonderes: Perimeter, Bauvorschriften, ökologische und ökonomische Interessen haben das Bauwerk in sein Korsett gezwängt. Der zweite Blick auf die Planungs- und Bauprozesse zeigt jedoch, dass trotzdem viel Raum für innovative Konzepte und Problemlösungen zur Verfügung stand und dieses «unsichtbare» Arbeitsfeld konsequent bewirtschaftet wurde.
Zu Beginn war die komplette Tragstruktur als reiner Stahlbeton-/Mauerwerksbau konzipiert. Doch mit dem Wachsen des Anforderungskataloges wurden Reaktionen nötig, um den Belangen Energieeffizienz, ökologische Nachhaltigkeit und kurze Bauzeit Rechnung zu tragen. Deshalb wurde ein grosser Teil des oberen Bauvolumens neu in Holzbauweise geplant. Die zwei Untergeschosse, das Erdgeschoss und die sechs Treppen- und Lifttürme beliess man in der Stahlbeton-Variante: Die Vorteile hinsichtlich Tragfähigkeit, Vorspannung und Brandschutz konnten hier durch andere Baumaterialien nicht wettgemacht werden. Platten, Stützen und Wände der Untergeschosse und des Erdgeschosses sind aus handelsüblichem Beton der Klasse C25/30 XC1 rsp. C30/37 XC4 XF1 bei erdberührten Bauteilen fabriziert. Um die graue Energie zu minimieren, wurden die Treppen- und Lifttürme aus Recyclingbeton des Typs C25/30 XC1 XC2 ausgeführt, weil dies hier wegen der geringeren Beanspruchung gut möglich war.
Der Wechsel zur Holztragstruktur in den Obergeschossen hatte nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Gründe, denn günstiger Wohnraum wird auch dadurch möglich, wenn dieser nach kurzer Bauzeit zur Verfügung steht. Die Genossenschaft kann ihn so früher vermieten und durch diesen wirtschaftlichen Vorteil tiefere Mietzinse ermöglichen. Um möglichst viel Bauzeit zu sparen, wurde der längliche Grundriss quer zur Badenerstrasse in vier Bauetappen unterteilt. Die Stahlbetonarbeiten konzentrierten sich zu Beginn an den zwei Endpartien. Die zwei dazwischenliegenden Etappen wurden sukzessive nachfolgend eingebaut. Dies hatte den Vorteil, dass auf den fertigen Randetappen bereits mit dem Aufrichten des Holzbaus begonnen werden konnte, während die mittleren zwei Etappen noch im Bauprozess standen. Diese zeitliche Überlappung der Arbeitsgattungen brachte denn auch eine beträchtliche Reduktion der Baudauer.
Schnittstelle Erdgeschoss Decke
Die Tragstruktur im Erdgeschoss ist mit ihrer grosszügigen Einteilung in keiner Weise kongruent mit den lastableitenden Wänden der Obergeschosse. Dadurch wurde das kreuzweise Anordnen von vorgespannten Unterzügen in der Erdgeschossdecke notwendig, wobei die sekundären Unterzüge (h=67 cm) in Querrichtung ihre Lasten an die primären Unterzüge (h=77 cm), die parallel zur Badenerstrasse angeordnet sind, abgeben. Solche Abfangträger reduzieren die Menge an Stahlbeton im Vergleich zu durchgehend gleich starken Deckenplatten zwar beträchtlich, beanspruchen aber auch mehr statische Höhe. Um mit den Medienkanälen nicht unter den Unterzügen durchfahren zu müssen und noch mehr an Raumhöhe zu verlieren, sind deshalb zahlreiche Aussparungen vorgesehen. Deren Anordnung richtet sich zwingend auf die Bereiche, wo die Spannkabel unten liegen. Die lichten Querschnitte wiederum sind ein Produkt aus statischer Verträglichkeit und den Anforderungen der Gebäudetechnik. Dass mehr Aussparungen als nötig platziert wurden, geschah in weiser Voraussicht, denn nachträgliches Bohren ist teuer und die Verletzung von relevanter, schlaffer Bewehrung dabei unumgänglich.
Als «Schlussstein» im übertragenen Sinn kann man die letzte Deckenetappe 4 bezeichnen. Da diese aus den genannten Gründen nicht an der Peripherie des Bauvolumens liegt, stellte sich das Problem der durchgängigen Vorspannung: Nach dem Betonieren dieser Schlussetappe musste man die Spannköpfe erreichen und der Spannpresse genug Platz einräumen. Zudem haben sich die Spannkabelenden der Etappen 3 und 4 weit zu überlappen, um eine durchgehende Wirkung zu erzielen. Dazu wurden in der Etappe 3 Hüllrohre mit dem gewünschten Kabelverlauf der Etappe 4 eingelegt und im Bereich der Spannköpfe grosszügige Aussparungen hergestellt. So wurden die Spannkabel der primären Unterzüge in der Etappe 3 per Kupplung an die entsprechenden Kabel der Etappe 1 angeschlossen und nach dem Betonieren und Nachbehandeln an der Kontaktstelle zu Etappe 4 vorgespannt. Nun konnten die Spannkabel der vierten Etappe mit Kupplungen an die Kabel der zweiten Etappe angeschlossen werden und durch die Hüllrohre in die fertige Etappe 3 eingestossen werden. Anschliessend betonierte man die letzte Etappe 4 und spannte die Kabel via die genannten Aussparungen in Etappe 3. Den Abschluss bildete das Auffüllen dieser Spannkopfaussparungen. Diese Abhandlung hört sich isoliert relativ einfach an. Durch das bereits erfolgte Aufrichten der Holzbauelemente auf den Etappen 1 und 2 war jedoch ein grosser logistischer Aufwand nötig, zumal auch die Flächen für Arbeit und Materialumschlag knapp bemessen waren.
Holzbauweise ermöglicht 2000 Watt
Die sechs Wohnkuben auf der Massivbaudecke über dem EG in Holzbauweise statt in der zu Beginn konzipierten Massivbauweise auszuführen, machte das ehrgeizige Ziel «2000-Watt- Gesellschaft» erst erreichbar. Das gewählte Wandprinzip «Top-Wall» wird normalerweise mit Stahlbetondecken kombiniert. Um aber auch hier der ökologischen Nachhaltigkeit und einer Minimierung der grauen Energie zu entsprechen, wurden die Geschossdecken aus Hohlkastenelementen ausgeführt. Damit hatte der Holzbauingenieur einige zusätzliche Aufgaben zu lösen, weil Hohlkasten naturgemäss nur in einer Richtung tragen. Auch die Gebäudetechnik musste sich dieser Bauweise und ihren Konsequenzen unterordnen (vgl. «Low Ex- Zero (E)Mission», S. 33).
Pragmatisch, praktisch, gut
Der Tragwerksplan der mehrgeschossigen Holzbauten ist denkbar einfach: Massive massgehobelte Kanthölzer 100 /195 mm der Festigkeitsklasse C24 bilden im Achsraster von 200 mm aneinandergereiht die 100 mm starken Aussen- und Trennwände. Auf diesen Wänden und an Auflagerschwellen aus Holz, die an den stabilisierenden Betonkernen verankerten wurden, sind die Hohlkastenelemente aufgelegt. Diese Deckenelemente bilden steife, an den Kernen fest verankerte horizontale Scheiben, vergleichbar mit einer einseitig wandverschraubten Tischplatte. Jede Deckenebene ist an ihrer Peripherie mit Einbindern aus 55 mm starken 3-Schicht-Platten umschlossen. Die stumpfen Stösse dieser Einbinder sind mit Nagelblechen kraftschlüssig verbunden. Um Gesamtstabilität und Erdbebensicherheit zu gewährleisten, sind die Geschossdecken der sechs Wohnkuben mit partiellen Schubverbindungen aus Stahl gekoppelt. So kann sich ein einzelner Kubus nicht um seinen Betonkern drehen. Damit sind weder an den Wänden noch an den Decken Verbände notwendig. Auf den ersten Blick eine einfache und unproblematische Bauweise – doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail, und deren sind nicht wenige vorhanden. Die Planer verstanden es, mit pragmatischen Lösungen zu reagieren:
– Verbindungen: Die Wände wurden nicht als Elemente im Werk vorfabriziert, sondern jedes einzelne Kantholz wurde am Bau gesetzt und mit Buchendübeln Ø 20 mm fixiert. Auf der Decke über EG bilden aufgedübelte Holzschwellen das Fundament für die Holzwände und gleichzeitig die Voraussetzung, durchgängig mit demselben Verbindungsprinzip arbeiten zu können. Je ein Buchendübel an Fuss und Kopf und einer auf halber Wandhöhe zwischen den Kanthölzern genügen, um die notwenigen Freiheitsgrade einzuschränken. Ingesamt wurden rund 4 km dieser Hartholzdübel eingebaut. Die Einbinder am Deckenrand bilden den Umfassungsring und sind Kontaktstelle für diverse Aufgaben wie Durchleiten der Vertikallasten, Aufnahme der Buchendübel und Anschrauben der Hohlkastenelementstirnen.
– Auskragungen: Die Wohnkuben weisen an den Schmalseiten diverse Terrassen und Balkone auf. Teilweise stützenfrei verlangen diese nach Kragträgern, weil die Tragrichtung der Hohlkastenelemente nur eindimensional verläuft. Das Umlegen der Rippen scheint naheliegend, bringt aber meist mehr Komplikationen als Nutzen mit sich. So wurde hier bewusst die Tragrichtung beibehalten und mit aussen angesetzten Brettschichthölzern die Auskragung realisiert.
– Stahlbauteile: Wohl als Obulus an den Konzeptwechsel von Massivbau- zu Holzbauweise in fortgeschrittener Planungsphase mussten einige Deckenauflager und diverse stark beanspruchte Tragelemente aus Baustahl implantiert werden. Ein Konstrukteur versucht immer, den Einsatz solcher «Fremdkörper» zu verhindern, denn das Einflechten von Stahlprofilen in einen Holzbau bringt immer einige technische Probleme mit sich wie Wärmebrücken und Anpassungen an Walzprofilformen. Dennoch kann dies selten gänzlich vermieden werden. – Brandschutz: Die Auflage der Gebäudeversicherung verlangte durchwegs nichtbrennbare Oberflächen im Rohbauzustand. Damit war klar, dass alle Holzbauteile komplett zu verkleiden sind. Innen und in den Steigzonen wurde diese Forderung mit Gipsfaserplatten, aussen mit der sowieso vorhandenen Mineralwolldämmung der hinterlüfteten Fassade erfüllt.
Gelebte Interdisziplinarität
Diverse weitere Details im Massivbau, dem Holzbau, der Gebäudehülle etc. wären der Erwähnung noch wert. Doch bereits jetzt ist offensichtlich, dass ein solches Gebäude nicht ohne das geordnete und zielgerichtete Zusammenwirken der verschiedenen Disziplinen plan- und ausführbar ist. Der Peak «2000-Watt-Gesellschaft» und der damit verbundene Konzeptwechsel in der Bauweise der Obergeschosse hat dem Begriff Interdisziplinarität wahre Bedeutung zugespielt. Investoren und Baufachleute haben hier ein wichtiges Zeichen auf dem Weg zur energiebewussten Gesellschaft gesetzt.TEC21, Fr., 2010.06.04
04. Juni 2010 Markus Schmid