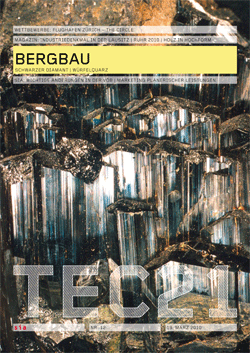Editorial
«Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt,
ist es besser, viel besser, als man glaubt.
[...] Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau,
du liebst dich ohne Schminke, bist’ne ehrliche Haut,
[...].
Du hast ’n Pulsschlag aus Stahl.
[...]
Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt,
du Blume im Revier. Bochum, ich komm’ aus dir,
Bochum, ich häng’ an dir. Glück auf!
Bochum.» Herbert Grönemeyers Titelsong des 1984 erschienen Albums «4630 Bochum» avancierte zur inoffiziellen Hymne der Stadt, obwohl das Lied eher ein Schwanengesang auf eine bis ins 13. Jahrhundert zurückreichende Geschichte war. Seit damals wurde im heutigen Ruhrgebiet Steinkohle abgebaut. Der industrielle Bergbau setzte nach 1800 ein, innerhalb weniger Jahrzehnte entstanden knapp 300 Zechen, das Gebiet wuchs zum grössten industriellen Ballungszentrum Europas an. Die Kohlekrise 1957 führte zu einem anhaltenden Strukturwandel: 2009 gab es im Ruhrgebiet nur noch vier fördernde Bergwerke. Von 1989 bis 1999 begleitete die Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA) den Wandel im nördlichen Ruhrgebiet; stillgelegte Berg- und Stahlwerke wurden als Industriedenkmäler erhalten. Ein Denkmal hatte sich Bochum indes bereits 1935 gesetzt – mit dem nach Entwürfen von Fritz Schupp und Heinrich Holzapfel errichteten Museum. Die aktuelle Erweiterung durch Benthem Crouwel Architekten trägt der Bedeutung des Hauses auch als renommiertem Forschungsinstitut für Montangeschichte Rechnung («Schwarzer Diamant», S. 24ff.).
Nicht der Bergbau im klassischen Sinn, sondern das Bauen in den Bergen ist ein Thema in den alpinen Regionen Mitteleuropas. Die ersten Unterkünfte, einfache Biwakplätze unter überhängenden Felsen, dienten Hirten als Unterschlupf, Anfang des 19. Jahrhunderts kamen die Basislager der ersten Gletscherforscher hinzu. Das zunehmende Interesse am Alpenraum führte 1863 zur Gründung des Schweizer Alpen-Club und in der Folge zu einer erhöhten Bautätigkeit von Schutzhütten: Die im gleichen Jahr erbaute Grünhornhütte am Tödi war der erste einer Reihe von Bauten, die diesem neuen Bedarf entsprachen. Bei der Wahl des Standorts hatte die Schutzfunktion Priorität: Oft entstanden die Bauten in unmittelbarer Nähe zum Fels, der auch die Funktion einer Aussenwand übernahm. In den letzten Jahren entwickelten sich die kargen Biwaks von einst zunehmend zu Gästehäusern für die Masse – während die Kräfte der Natur unvermindert stark sind. So wurde die 1995 erbaute Anenhütte im Lötschental 2007 von einer Lawine zerstört. Der Wiederaufbau ist formal vom Widerstand gegen die Naturgewalten geprägt und hatte immense technische Herausforderungen zu überwinden. Im Inneren dagegen herrscht fast urbaner Komfort («Würfelquarz», S. 28ff.).
Tina Cieslik, Rahel Hartmann Schweizer