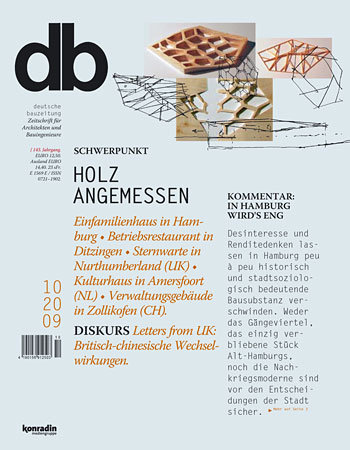Editorial
Emotionsbaustoff«? Öko-Vorbild? Oder schlichtweg die sinnvollste Alternative? – Vor allem im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion und des Strebens nach CO2-Reduktion gewinnt Holz als Baustoff vermehrt Aufmerksamkeit. Das Baumaterial der Zukunft also?
Wohin entwickelt sich der Holzbau? Nicht immer sind reine Holzbauten die wirtschaftlich cleverste Entscheidung. Die Vorteile, die sich daraus ergeben – kurze Bauzeiten, hohe Vorfertigungen, günstige U-Werte, ein niedriger Primärenergiebedarf und dadurch nachhaltiges Bauen – stehen manchen Nachteilen oder Hindernissen gegenüber – hohen Brandschutzauflagen, wenige im Holzbau erfahrene Handwerker oder Planer und damit z. B. schlechte Bauausführung oder Akustik. Wann lohnt sich eine reine Holzkonstruktion, wann ist eine Materialkombination, im Verbund mit Stahlbeton oder Stahl, sinnvoller? Letzteres erscheint zunächst überall da von Vorteil, wo bei einem Tragwerk aus gestalterischen oder statischen Gründen schlanke Bauteile gewünscht oder beispielsweise thermische Masse oder ein höheres Gewicht notwendig sind. Etwa bei Deckenkonstruktionen im Holz-Beton-Verbund, die es seit rund 15 Jahren gibt und die aufgrund der Änderung der DIN 1052 und dem darin geforderten Schwingungsnachweis zukünftig wohl häufiger umgesetzt werden könnten. Eine Veränderung beim Bauen mit Holz könnte auch die europäische Norm EN 13 501 mit sich bringen, die sich der Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen und damit den Inhalten widmet, die bislang DIN 4102 abdeckt. Da dann u. a. die materialbezogenen Aspekte der Brandschutzanforderungen entfallen (Stichwort -A oder -B), eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten für den Holzbau. Auch scheint durch das Angebot der digitalen Produktion bereits eine neue Richtung eingeleitet zu sein: Im Rahmen einer Seminararbeit an der ETH Zürich entstand z. B. ein modulares, variabel gestaltbares Wandsystem mit »Holzbausteinen« (s. Abb. links sowie S. 81), das die statischen und bauphysikalischen Ansprüche einer Außenwand erfüllt. Jedes Modul besteht aus Holzlatten gleichen Querschnitts, die ausschließlich durch Nägel verbunden sind. Durch ihr Eigengewicht fixieren sich die Module ohne zusätzliche Verbindungsmittel gegenseitig.
Doch zurück zur Anwendung von Holz im »Alltag« und nachfolgenden Projekten: Sie erzählen die Geschichte, die zur Wahl des Baumaterials bzw. dessen Kombination führen. Und sie zeigen: Es gibt weit mehr Aspekte, einen Holzbau zu »wagen«, als nur ökologische oder bauphysikalische Gründe.
Christine Fritzenwallner
Blattwerk und Tangram
(SUBTITLE) Betriebsrestaurant in Ditzingen
Das Raster ist tot, es lebe das Puzzle – diese Botschaft scheint die weitgespannte Stahl-Holz-Konstruktion über der neuen Trumpf-Kantine zu vermitteln, deren komplexe Struktur analog zur Natur erst dank CNC und individualisierter Massenfertigung möglich wurde. Mit ihren Gebäuden für den schwäbischen Präzisionsmaschinenbauer haben die Architekten schon öfters Sehgewohnheiten verrückt. Doch dieses Mal wirft der Neubau – zweifellos großzügig und skulptural sinnig – vor allem auch Fragen nach der Angemessenheit und den Grenzen konstruktiver Analogien auf.
Seit über zehn Jahren gestaltet das Büro von Frank Barkow und Regine Leibinger die bauliche Entwicklung des Konzerns Trumpf. Am Stammwerk Ditzingen, wo sich Leibingers Vater einst vom Lehrling zum Chef hochgetüftelt hatte, machten Erweiterungen und Umnutzungen eine völlige Reorganisation des Firmengeländes möglich. Schon bald nach der vielpublizierten neuen Laserfabrik im Westen des Werkes wurde auf der Ostseite eine ehemalige Gewürzmühle erworben und umgebaut. Zwischen diesem neuen Dienstleistungszentrum, den Verwaltungsgebäuden aus den Sechzigern und dem 2003 hinzugekommenen Vertriebs- und Servicezentrum blieb ein Freiraum übrig, der für die Anlage eines großzügigen Betriebsrestaurants genutzt werden sollte: Eine »soziale Mitte«, die es für jeweils 700 Mitarbeiter im Schichtbetrieb auszulegen galt, zugleich aber auch Betriebsversammlungen fassen sollte. Die bisherige Kantine für die insgesamt 2 000 Mitarbeiter war vor allem akustisch ungenügend in einem der Altbauten untergebracht.
Das unregelmäßige Fünfeck des neuen Gebäudes reagiert auf die bestehenden Raumkanten. Sein »Bug« weist nordwärts zur gewagt aus- kragenden, blitzblanken Pförtnerloge am 2007 hierher verlegten Haupteingang, das breite »Heck« steckt südseits in einem Hügel, der die nahe Autobahn auszublenden bestrebt ist.
Die nautischen Metaphern mögen fehl am Platze sein; sie drängen sich dem Betrachter gleichwohl auf, weil das stählern konstruierte Gebäude halb im Boden versunken liegt: Eingegraben, um an das Tunnelsystem anzuschließen, das alle Werksteile wetterunabhängig miteinander verbindet, gibt es seine 31 000 m³ Baumasse nicht gleich preis. Das Aha-Erlebnis folgt erst, nachdem man die unterirdischen Gänge passiert und den Boden des Raumes betreten hat, den »Kantine« zu nennen weit untertrieben wirkt.
Schwamm, Blatt, Waben – die Formfindung
Hatten die Architekten in ihren Bauten bislang – in der Tradition des mit Stanzmaschinen großgewordenen Unternehmens – überwiegend mit Metalloberflächen experimentiert, erschien ihnen für eine Gemeinschaftsfunktion das anheimelndere Holz angebracht. Sie verwenden es jedoch in Kombination mit Stahlträgern und -stützen, um mehr Leichtigkeit zu erreichen. Das Dach sollte das prägende, alles verbindende Element sein. Als Struktur-Vorbild für dieses schwebte den Entwerfern das Blatt, der Schwamm und eine Wabenstruktur vor:
Was beim Blatt die Stiele und die Hauptadern – die Primärstruktur – sind, sollten hier die Stahlträger übernehmen. Was die Blattverästelungen aus-füllen – die Sekundärstruktur – sollte das Holztragwerk sein. Ein Deckgewebe – aussteifende Holzelemente und Dichtbahnen – überzieht beide.
Die offenporige räumliche Struktur von Schwämmen bot eine Möglichkeit, Tragverhalten und günstige Akustik zu verbinden. Doch wie diese Strukturen bauen? Schließlich entstand eine Mischform, die durch vertikale Vor- und Rücksprünge plastisch-räumlich wirkt. Dabei übernehmen die Überstände keine statische Funktion. 1 550 Brettschichtholz-»Stäbe« aus Fichte, 10 cm breit und zwischen 90 und 150 cm hoch, insgesamt 3,6 km lang, bilden die wabenartige Struktur, die innerhalb der von den Stahlträgern aufgespannten neun Dreiecke statisch wie ein Trägerrost funktioniert.
Keine der Waben ist identisch. CNC-Sägen und -Fräsen haben sie in präzise Form gebracht, wie bei einem Tangram-Puzzle geht am Ende alles auf. An jeder Ecke verbinden sternförmige Laschen die Holzwaben miteinander; an den Wangen sind sie zusätzlich sichtbar verschraubt. An die Stahlträger sind Befestigungslaschen angeschweißt. Hinzu kommt die unterschiedliche Neigung der neun Dachflächen, so dass Übergangshölzer nötig waren, um die entstehenden Zwischenräume zu füllen. Die ausführende Holzbaufirma baute zunächst ein 1:1-Modell mehrerer Module, um die effizienteste Verbindungstechnik zu ermitteln.
Da die Verbindungen sehr aufwendig sind, entschied man sich aus Kostengründen für eine deutliche Vergröberung der Struktur auf 295 Knoten , was dem Ziel der Strukturanalogie geschadet hat. Die erstrebte Leichtigkeit ist weg, die Waben sind wieder Bauwerke und keine Schwämme und lasten doch erheblich auf dem Raum.
Spindeldürre Stützen
Die bis zu 40 m weit spannenden Stahlträger und die neun Stützengruppen wurden dagegen extrem abgespeckt. Mit Materialstärken von bis zu 6 cm an hochbelasteten Stellen und kompliziert zu schweißenden Knoten erfüllen sie statisch gewiss ihren Zweck. Für die mächtig geratene Holzwabenkonstruktion wirken aber insbesondere die Stützen zu zart. Das Auge »wiegt« die Wabenkonstruktion eben nicht als leichtes Blatt oder Schwamm, sondern als doch recht massive Holzkastenstruktur. Manch einer mag sich dabei gar an abgehängte Decken der siebziger Jahre erinnern. Auch andere Bauten von Barkow Leibinger wecken Reminiszenzen an diese Zeit.
Ansonsten erfüllt die Wabenkonstruktion, in Kombination mit der gelochten Aussteifungsschicht, sehr gut ihren Zweck: Trotz der harten Ober- flächen im übrigen Raum ist der Geräuschpegel noch angenehm. Und zum gewöhnungsbedürftig prekär anmutenden Tragwerk ihrer Kantine werden die – zumeist technisch versierten – Mitarbeiter schon Zutrauen entwickelt haben.
Raumhoch verglast
Frappierend ist die Helligkeit im Raum: Immerhin 4 m unter Straßenniveau, erhält der Raum über die vom Dach bis zum Boden reichende Rundum-Verglasung viel direktes und indirektes Sonnenlicht. Die grünen Böschungen geben dahinter etwas Hülle, verwehren aber die weiteren Ausblicke auf das Firmengelände. Da sich das öffentliche Leben auf dem »Campus« ansonsten nur in den Verbindungstunneln abspielt, ist dies schon eine gehörige Steigerung des Wohlbefindens. Auf der Rückseite können die Mitarbeiter sogar draußen auf einer Terrasse sitzen.
Die gerade im Verhältnis zur Decke fast schwerelos wirkende Fassade trägt nur sich selbst, sie wird durch die vertikalen Aluminiumschwerter mit wechselnden Hochpunkten ausgesteift – wieder eine (hier nur scheinbar willkürlich gestaltete) dreidimensionale Fassade des Büros. Am Übergang zur auskragenden Dachkonstruktion (s. Abb. 5) verläuft ein vertikal beweglicher Kunststoffbalg, der die thermischen und lastabhängigen Bewegungen des Daches um 6 cm auszugleichen in der Lage ist.
Noch-nie-Dagewesenes
Bleiben noch nicht-tragende Details anzufügen: Die gesamte Logistik und die Küchenfunktionen verschwinden geschickt im Mezzanin-Geschoss. Der felsenhafte Bau stärkt der gesamten Struktur den Rücken, der sichtbare Teil wurde zudem in dunkel eingefärbtem Beton errichtet, was seine Schwere unterstreicht. Vor diesem Hintergrund heben sich die strahlend weißen Anrichten aus fugenlosen Mineralwerkstoff-Platten ab. Der Estrich glänzt dagegen hellgrau, er enthält trotz seiner scheinbaren Härte schwingungsdämpfende Polyurethane.
Fliesen, indes keine mit sanitärer Ausstrahlung, tauchen an drei Orten im Gebäude auf: am Eingang in der dreieckigen Erweiterung des Tunnels in Grün, im sichtbaren Ausgabebereich der Küche in Weiß und an der Rückseite des Gebäudes zum Hang hin in Blauschwarz. Die insgesamt 12 000 Fliesen entstammen einer Kleinserie aus dreidimensionalen (konkaven und konvexen) Terrakotta-Elementen, die formale Anklänge an die Gesamtform der Kantine enthalten.
Die Dachfläche ist von den umliegenden Gebäuden aus gut sichtbar. Darum hat man nur die nötigsten Abzüge und Öffnungen hier installiert, die massivere Technik dagegen in zwei seitliche Türme ausgelagert. In einige Waben integrierte Oberlichter unterstreichen in ihrer Selbstähnlichkeit die Gesamtform, wirken von außen aber wieder mehr dekorativ, wie Edelsteine.
Es ist wohl diese Ambivalenz von Nutzen und Dekor, das spielerische Zusammenwirken von scheinbarer Willkür und präzisester Kalkulation und Technik, die das OEuvre von Barkow Leibinger für modern geprägte Architekten angreifbar macht. Ihr zeittypisches Streben nach »Noch-Nie-Dagewesenem« verunsichert, weckt aber auch Neugier und Staunen, gerade bei »ungeschulten« Betrachtern. Der – nicht realisierte – raupenförmige Pavillon für das Deutsche Architekturmuseum ist nur ein weiteres Beispiel dafür.db, Mi., 2009.10.07
07. Oktober 2009 Christoph Gunßer
verknüpfte Bauwerke
Betriebsrestaurant mit Auditorium
Käfer statt Vögel
(SUBTITLE) Einfamilienhaus in Hamburg
Aus Kosten- und aus statischen Gründen habe sich die Holzkonstruktion des Gebäudes so ergeben, lautete die simple Antwort der Architekten auf die Frage nach der Wahl des Baumaterials. Auch war Holz aus bauphysikalischen Gründen einfach besser – schließlich können die schlanken Wände Dämmwerte erreichen, die mit gewöhnlichem Stahlbeton oder Mauerwerk nicht in der Dicke zu erfüllen gewesen wären. Doch das Haus überzeugt nicht nur wegen seiner Materialität und ausgefeilten, dennoch einfach wirkenden Konstruktion, sondern vor allem aufgrund seines einzigartigen Raumerlebnisses.
Die Hamburger Walddörfer sind nicht gerade die Gegend, in der man unorthodoxen, innovativen Wohnungsbau, noch dazu in Holz, vermuten würde. Hier, im idyllisch-grünen, einst ländlichen Nordosten der Stadt ist man konservativ (Bürgerschaftswahl 2008: CDU 53,1 %), sicher (niedrigste Kriminalitätsrate Hamburgs), unter sich (niedrigster Ausländeranteil Hamburgs) und gut situiert (niedrigster Anteil von Hartz IV-Empfängern Hamburgs). Auch die das Bild prägenden Einfamilienhäuser sind eher bodenständige Vertreter aus Rotklinker mit Satteldach. Geradezu wie ein Affront wirkt da diese kleine Kiste aus Holz und Glas, die die jungen Architekten Tobias Kraus und Timm Schönberg für eine Familie in den Boden gegraben haben. Die Fremdartigkeit ist nicht nur den ortsuntypischen Materialien geschuldet, sondern auch deren eigenartiger Verteilung: Das OG, verschalt mit weiß gestrichenem Douglasienholz, thront auf einem gläsernen Sockel und wirkt, als schwebe oder balanciere es in einem prekären Gleichgewicht. Diese Wirkung ist kein vordergründiger Effekt, sondern den Zwängen des Ortes geschuldet: Erlaubt war auf dem Grundstück nur eine eingeschossige Bebauung auf kleiner Fläche, die nicht genügend Wohnraum geboten hätte. Die Architekten entwickelten daraufhin einen Zweigeschosser, der baurechtlich keiner ist, weil das EG – 1,5 m tief in die Erde gesteckt – nicht als Vollgeschoss gilt. Damit auf Grasnarbenebene keine Souterrain-Beklemmungen aufkommen, wurde der oberirdische Anteil der Etage komplett verglast. Es ist hell und heimelig in diesem Betontrog, dessen Oberfläche die ursprünglichen Schalungsbretter strukturierten. Auf freier Fläche wird gewohnt, gekocht und gegessen, bei schönem Wetter auch draußen auf einer in das Gelände eingegrabenen Terrasse. Lediglich der Ausblick ist ungewohnt: Statt Vögel in den Bäumen beobachtet man hier eher Käfer im Gras.
Geschärfte Wahrnehmung
Ungewöhnlich ist auch die variierende Deckenhöhe im EG. Sie ist den unterschiedlichen Höhen der darüber liegenden Räume im OG geschuldet. Die Architekten sind nicht zu Unrecht der Auffassung, dass unterschied- liche Nutzungen eine Differenzierung der Räume nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Höhe notwendig machen und haben sie entsprechend in der dritten Dimension gestaffelt. So ist beispielsweise einer der Räume darauf ausgerichtet, das Hochbett der Kinder aufzunehmen. Da das Flachdach tatsächlich flach bleiben sollte, ragen die Räume des OG nun also wie in einer Skulptur von Rachel Whiteread unterschiedlich tief hinab in die untere Ebene. Es ist eine beeindruckende Erfahrung: Räume bleiben nicht länger von Wänden, Böden und Decken umschlossene Volumen, sondern werden als Körper spürbar.
Durch den Trick der Differenzierung und Staffelung des OG nach unten wird die außen so eindeutige Einteilung in zwei Ebenen im Hausinneren aufgehoben. Statt eine gemeinsame horizontale Ebene zu definieren, winden sich die Räume um einen in der Mitte angeordneten, nach oben abgeschlossenen Luftraum hinauf. Immer wieder muss man auf dem Rundweg durch die obere Etage kleine Treppenstücke mit zwei oder drei Stufen hinauf oder hinab laufen; eine interessante Erfahrung, die die Wahrnehmung des Raumes schärft. Es entwickelt sich, nicht zuletzt durch die vielen Fenster und Wandeinschnitte im Innern, auf nur 125 m² Nutzfläche ein außerordentlich komplexes, spannungsvolles Raumgefüge. Der Luftraum, in den ein eindrucksvolles 6 m hohes Bücherregal eingebaut wurde, fungiert dabei als Zentrum und Schnittstelle. Hier kreuzen sich erstaunliche Sichtbeziehungen: vom elterlichen Schlafraum in das eine Kinderzimmer, vom anderen Kinderzimmer hinunter zur Küche, ja sogar vom bodentief verglasten Bad in den Wohnraum. Man bleibt also auf dem Laufenden über das Geschehen. Aber auch der Blick durch drei Fensterebenen über das Atrium hinweg bis zum Wald ist atemberaubend. Es ist dieses Spiel zwischen Gemeinsamkeit und Individualität, zwischen Offenheit und Geschlossenheit, die dieses Haus so einzigartig macht.
Wundervoll einfach
Die Komplexität des Hauses spiegelt sich in seiner Konstruktion wieder, denn das einzigartige Raumerlebnis ist Ergebnis eines ungewöhnlichen Tragsystems, das die jungen Architekten zusammen mit dem Büro von Werner Sobek entwickelt haben: In die Ortbetonwanne des EG wurden schlanke Rundrohrstützen eingespannt, auf denen ein Holztragwerk aus kreuzweise verleimten Fichtenholzplatten ruht. Sie bilden, miteinander verschraubt, die Böden und Wände der Raumkuben des OG. Die Verwendung von Kreuzlagenholz ermöglicht eine für die Holzbauweise erstaunliche Spannweite und Steifigkeit, so dass die Hauptwandscheiben ohne weitere Unterstützung über die gesamte Gebäudetiefe bis zu knapp 12 m reichen – im EG verstellt keine Stütze den wunderbar offenen Raum.
Die Nutzung von Kreuzlagenholz (auch Brettsperrholz genannt) im Hausbau ist erst seit den 90er Jahren in Deutschland gängige Praxis. Zur Herstellung der massiven Holztafeln werden drei bis sieben über Kreuz gestapelte Brettlagen miteinander verleimt. Der Vorteil des Verfahrens: Die Schichtung von Quer- und Längslagen des Holzes übereinander verhindert die (bei Einzelbrettern) übliche Dimensions- und Lageänderungen durch wechselnde Luftfeuchtigkeit und ermöglicht damit erst die hohe Formstabilität und Steifigkeit.
Durch die großen Spannweiten herrschen an den Auflagerpunkten hohe Drucklasten. Um sie in die Stahlstützen einzuleiten, wurden in die Massivholzplatten Stahllamellen einlaminiert. Die innovative, wie ein überhoher Trägerrost funktionierende Konstruktion aus gleichermaßen tragenden Außen- und Innenwänden war kompliziert zu berechnen, besitzt aber einige Vorzüge: Da alle Wände gleichermaßen zur Lastabtragung genutzt werden, konnten Innen- wie Außenwände mit gerade einmal 11,7 cm Durchmesser (bei Außenwänden zzgl. Dämmung und Außenverschalung) außerordentlich schlank gehalten werden. Zudem ist es ein sehr kostengünstiges System, denn die hölzernen Wand- und Bodenscheiben wurden, mit allen Aussparungen für Türen und Fenster, in der Fabrik vorgefertigt und vor Ort in zwei Tagen zusammengeschraubt. Sie blieben zudem innen völlig unbekleidet und erhielten lediglich einen weißen Acrylfarbanstrich; auch dies spart Zeit und Geld, fördert zudem ein gesundes Raumklima und die Recyclingfähigkeit. Und: Der Naturstoff Holz bleibt in seiner Haptik, seiner Struktur und seinem Geruch immer präsent. Es musste nicht einmal in den Brandschutz investiert werden, denn Kreuzlagenholz-Platten erreichen ohne zusätzliche Maßnahmen wie Feuerschutzplatten die Feuerwiderstandsklasse F90.
Durch die Vorfertigung und den geringen Arbeitsaufwand vor Ort konnte das ganze Haus letztlich in nur vier Monaten Bauzeit errichtet werden und kostete unter 300 000 Euro. Als einziger Nachteil steht all dem gegenüber, dass die einmal gewählte Raumkonfiguration im OG später nicht oder nur schwer verändert werden kann, weil sich keine Wände versetzen oder herausnehmen lassen. Doch auch im konventionellen Wohnungsbau tritt dieser Fall höchst selten ein.
Auch unter energetischen Aspekten kann sich die Wohnkiste sehen lassen: Die schlechte Wärmeleitfähigkeit der Holzwände sowie die außenliegende, hinter der Fassadenschalung angebrachte Dämmung machen das Gebäude zu einem Niedrigenergiehaus mit einem Jahresprimärenergiebedarf von knapp unter 60 kWh/m2. Der Transmissionswärmeverlust liegt unter 0,30 W/m2K – und dass, obwohl die Außenwände des EG einen hohen Glasanteil (Zweifach-Verglasung) besitzen. Geheizt wird mittels Geothermie, wobei der Strom für die Wärmepumpe nicht mehr als 50 Euro pro Monat kostet.
Man sieht: Dieses kleine, außergewöhnliche Wohnhaus ist nicht etwa einer gestalterischen Obsession seiner Architekten entsprungen. Es ist die perfekte Umsetzung einer neuartigen Vorstellung des familiären Zusammenlebens in einem Einfamilienhaus, das zusammen mit den Nutzern und den Tragwerksplanern entwickelt wurde. Dafür wurde ein höchst effizientes und zudem kostengünstiges Tragwerk ausgetüftelt, für das einzig der Werkstoff Holz in Betracht kam. Dass dieses Haus auch noch die Ressourcen schont, ein natürliches Wohnklima schafft und recyclingfähig ist, zeigt, dass eine gute Gestaltung und ökologisches, nachhaltiges Bauen überhaupt kein Widerspruch sein müssen. Es ist eine im backsteinernen Norden ungewöhnliche Kiste aus Holz und Glas, doch sie wird Schule machen – das ist gewiss.db, Mi., 2009.10.07
07. Oktober 2009 Claas Gefroi
Leben in der Bude
(SUBTITLE) Kulturzentrum in Amersfoort (NL)
In den Niederlanden ist die Verwendung von Holz eher noch ungewöhnlich. Doch um später aufgrund möglicher Kosteneinsparungen keine Abstriche bei der Oberflächengestaltung machen zu müssen, entschieden sich die Architekten von Anfang an für ein Tragwerk, dessen Massivholz- und Hohlkastenelemente auch unbekleidet und unbehandelt eine ansprechende und angenehme Oberfläche ergeben – eine kluge, taktisch geschickte Entscheidung, die die Innenraumqualität der »Kultur-Container« einmalig macht und vielleicht auch des- wegen immer für ein volles Haus sorgt?
Vathorst ist ein Neubauviertel im Nordosten der niederländischen Stadt Amersfoort. Es ist Teil des VINEX-Wohnungsbauprogramms der niederländischen Regierung, das 1993 mit der »Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra« (der vierten, außerordentlichen Raumplanungsnota) ins Leben gerufen wurde und in dessen Rahmen bis 2015 landesweit rund 750 000 neue Wohnungen in Großstadtnähe entstehen sollen. Inzwischen haben diese Siedlungen jedoch einen etwas zweifelhaften Ruf bekommen: Spricht man von einem »typischen Vinex-Viertel«, dann ist eine monotone und vor allem monofunktionale Reihenhaussiedlung auf dem Polder gemeint.
In diesem Sinne ist Vathorst, wo bis zum Jahr 2014 insgesamt 11 000 neue Wohnungen entstehen sollen, keine Ausnahme. Denn obwohl dort Versuche unternommen werden, etwas Variation in die Gebäudetypologien zu bringen und auch freistehende Einfamilienhäuser und städtische Wohn-blöcke zu errichten, besteht der Großteil der bisher fertig gestellten Plan- gebiete noch immer aus Reihenhäusern mit handtuchgroßen Gärtchen.
Ungewöhnlich ist in Vathorst allerdings, dass im Zentrum der halbfertigen Siedlung kein Shopping Center thront, sondern ein Kulturzentrum, das als Begegnungsort für die Bewohner gedacht ist. Auf einer großen Wiese, einem geplanten Park, steht ein Bau, der sich nicht nur durch seine Position und Funktion von der Umgebung abhebt, sondern auch durch sein Material: Er besteht aus Holz, was man in den backsteinernen Niederlanden eher selten sieht. Geht man um ihn herum, verraten die großen weißen Lettern, die über seine dunkelgrauen Holzfassaden verteilt sind, den Namen des Zentrums: »De Kamers«, zu deutsch »Die Zimmer«. Dieser Name diente als Leitmotiv für den Entwurf. Wie ein Stapel Bauklötze setzt sich das Gebäude aus mehreren kubischen Volumen zusammen, die einen Theatersaal sowie Räume für Ausstellungen, Kurse, Feiern und Konferenzen bergen.
Zwei oder drei umgebaute Container
»De Kamers« war aber keineswegs von Anfang an Teil des Masterplans von Vathorst. Statt dessen geht die Gründung des Kulturzentrums auf die Privatinitiative eines Pfarrers und eines Künstlers zurück, die beide in einem VINEX-Viertel nahe Amersfoort gewohnt und so erfahren haben, wie leblos diese Neubausiedlungen vor allem in den Anfangsjahren sein können. 2003 schlugen sie deshalb der Entwicklergemeinschaft Vathorst, zu der die Gemeinde Amersfoort und fünf kommerzielle Projektentwickler gehören, vor, ein Kulturzentrum einzurichten, das zunächst ganz bescheiden ausfallen sollte. Sie dachten nur an zwei oder drei umgebaute Baucontainer, in denen man Filme zeigen und hin und wieder ein Essen organisieren könnte. Die Entwicklergemeinschaft brachte die Initiatoren daraufhin in Kontakt mit Korteknie Stuhlmacher Architecten. Das junge Rotterdamer Büro, geleitet von der Deutschen Mechthild Stuhlmacher und dem Niederländer Rien Korteknie, wurde 2001 mit einem knallgrünen, parasitären Dachpavillon bekannt, der vollständig aus einem deutschen Massivholzprodukt gefertigt war. In den folgenden Jahren haben sie einige weitere Fertigholzbauten errichtet, darunter ein temporäres Künstleratelier bei Utrecht und ein Vereinsgebäude für einen Ruderclub in Amstelveen.
Wachsen und Schrumpfen
Zunächst lautete der Auftrag der Initiatoren an Korteknie Stuhlmacher also lediglich, ein paar vorgefertigte Baucontainer zu verschönern, damit sie als Kulturzentrum dienen könnten. Die Architekten überzeugten sie jedoch bald, dass man containerartige Räume besser selber bauen und damit ein erweiterbares Gebäude schaffen sollte. Dass dabei letztlich ein Bau mit 1 000 m² Bruttogeschossfläche und einem Budget von 1,4 Mio. Euro herauskommen würde, hätte damals noch keiner vermutet. In den ersten drei Jahren der Planungsphase wurde das Projekt ständig von Finanzproblemen gebeutelt, und auch der geplante Standort wechselte mehrmals. Je nach aktuellem Stand der Dinge wuchs und schrumpfte der Entwurf. Was jedoch von Anfang an konstant blieb, war das Baumaterial Holz, für das sich Korteknie Stuhlmacher aus einer ganzen Reihe von Gründen entschieden hatten. Zu den Vorteilen zählten zunächst einmal seine Preisgünstigkeit, Flexibilität und kurze Bauzeit. Außerdem erfordert es keine zusätzliche Bekleidung – deren Qualität in den Niederlanden oft als erste in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn das Geld knapp wird. Es hat gute akustische Eigenschaften und erzeugt eine wohn- liche Atmosphäre. Obendrein erhielt das Projekt dank des für die Niederlande neuartigen Baumaterials auch noch 60 000 Euro Subventionen vom Programm für »industrielles, flexibles und demontables Bauen« des Raumplanungsministeriums. Als dann noch eine beträchtliche Summe von privaten Spendern hinzukam, konnte der Bau endlich beginnen.
»De Kamers«
Wegen der vielfältigen Funktionen des Gebäudes sollte seine architekto- nische Form nicht programmatisch gebunden sein. Rund um ein Foyer entstand ein Ensemble aus unterschiedlich großen Kuben, in denen jeweils ein oder zwei Räume untergebracht sind: das Theater, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Lesezimmer und ein Dachzimmer. Das Tragwerk des Gebäudes besteht, wie bereits bei den anderen Holzbauten von Korteknie Stuhlmacher, vor allem aus Massivholzelementen, die aus kreuzweise verleimten Fichtenholzplatten bestehen. Da diese jedoch nicht für große Spannweiten geeignet waren, entschieden sich die Architekten für Geschossdecken mit vorgefertigten Hohlkastenelementen aus Fichtenholz. In ihre Unterseiten sind bereits akustisch wirksame Perforationen zur Schalldämmung eingearbeitet.
Beim Betreten bemerkt man sofort die erstaunlich warme, vor allem aber nicht »billig« wirkende Ausstrahlung des Gebäudes. Auch die etwas beklemmende Sauna-Atmosphäre, die Holzbauten manchmal verströmen, kommt glücklicherweise nicht auf. Im Erdgeschoss grenzen das Theater sowie Ess- und Wohnzimmer an das doppelgeschossige Foyer. Letzteres ist der einzige Teil des Gebäudes, der nicht auf dem Holzbau- system basiert: Bis zur Höhe des ersten Geschosses besteht seine Konstruktion aus Beton und Kalksandstein, denn sonst hätten die darüber liegenden Räume aufgrund niederländischer Brandschutzbestimmungen mit einer Brandschutzverkleidung versehen werden müssen.
Das Herz des Kulturzentrums ist das Wohnzimmer, das mit einem offenen Kamin und einer umlaufenden hölzernen Sitzbank sowie beinahe geschosshohen Schiebefenstern ausgestattet ist und für Veranstaltungen aller Art genutzt werden kann. Als zusätzliche Lichtquellen dienen einfache Leuchtstoffröhren. Nebenan befindet sich das Esszimmer mit Küche, das ebenfalls zweigeschossig mit Luftraum ist. Größter Raum im Erdgeschoss ist jedoch das Theater mit 100 Sitzen. Auch hier lassen zwei große Fenster mit Schiebeläden bei Bedarf Tageslicht einfallen, und die Umkleiden, die im ersten Obergeschoss liegen, können in den Bühnenraum integriert werden. Im ersten Stock befindet sich außerdem der Zugang zur Empore des Theaters und über dem Wohnzimmer der Leseraum mit Bibliothek. Darüber liegt nur noch das doppelt hohe Dachzimmer, in dem Kurse oder Workshops abgehalten werden können.
Die einzigen Farben, die in »De Kamers« mit dem hellen Holz kontrastieren, sind das Graugrün und Blaugrau der Türen, Fensterrahmen und des Bodenbelags. In manchen Räumen wurden auch die Wände mit einer farbigen Sockelvertäfelung aus MDF-Platten vor Verschmutzung geschützt. Diese Materialisierung und Farbwahl bestimmt alle Räume des Gebäudes und verleiht ihm trotz seiner additiven Struktur eine sehr harmonische Wirkung. Nicht einmal unschöne Installationen stören die Optik, denn von Kabeln bis Feuerwehrschläuchen ist alles in vorgefertigten Nischen und Aussparungen in den Wänden untergebracht.
Obwohl die Räume dank ihrer großen Fenster sehr hell sind und selbst das Theater über eine große Schiebetür Kontakt zur Außenwelt hat, wirkt der Bau von außen betrachtet erstaunlich geschlossen. Ab einer Höhe von 2,50 m ist seine Holzkonstruktion mit einer dunkelgrauen, hitzebehandelten Fassadenschalung aus Fichtenholz bekleidet. Darunter befindet sich ein Sockel aus Faserzementplatten, die von den Nutzern des Zentrums bemalt werden dürfen und der Architektur ein verspieltes Element hinzufügen. Vor allem tragen die ungezwungen bunten Wände aber deutlich nach außen, was die Hauptaufgabe von »De Kamers« ist: etwas Leben und Spaß in die Schlafsiedlung Vathorst zu bringen.db, Mi., 2009.10.07
07. Oktober 2009 Anneke Bokern