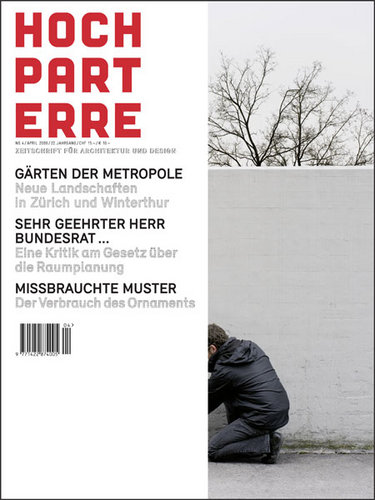Editorial
Edition Hochparterre bei Scheidegger & Spiess
Die Krise rumort, aber wir bauen einen neuen Firmenzweig auf: In der «Edition Hochparterre bei Scheidegger & Spiess» wird Roderick Hönig regelmässig Bücher über Architektur, Design, Landschaftsarchitektur und Planung herausgeben. Dank Scheidegger & Spiess werden unsere Bücher weit über Hochparterres Kreis hinaus in die Welt finden. Roderick Hönigs erstes Buch dieser Serie heisst «Unterwegs in Zürich und Winterthur. Stadträume und Landschaftsarchitektur 2000—2009». Zusammen mit Claudia Moll führt der handliche Führer ein faszinierendes Kapitel zeitgenössischer Landschaftsarchitektur vor.
Nirgendwo in der Schweiz sind Stadtlandschaften und Freiräume so reich gewachsen wie in Zürich und Winterthur. Zürichs Alt-Stadtpräsident Ledergerber hat gerne und laut gejammert, seine Stadt brauche endlich einen architektonischen Leuchtturm. Kannte er die Pärke seiner Stadt nicht? Er wird ein Exemplar des Buches erhalten und erblassen über die gestalterische Vielfalt, die während seiner Regierungszeit entstanden ist. Vernissage des Buches ist am 16. April 2009 bei Hochparterre Bücher an der Gasometerstrasse 28 in Zürich. Und wer nicht kommen kann, bestelle sein Exemplar auf Hochparterres Website. In Roderick Hönigs weiterem Programm wartet ein Führer über das zeitgenössische Bauen in der Stadt Bern und bald wird «Zumthor sehen.» ausgeliefert, ein Buch zur Fotografie von Hans Danuser über Peter Zumthors Arbeiten. Vernissage ist am 29. April 2009 in Chur.
Gabriel Vetter heisst der Kolumnist, dessen Text ab diesem Heft auf Seite 13 zu lesen ist. Der preisgekrönte Dichter und Slumpoet schreibt über Sitten, Bräuche und Rituale der Designerinnen, Planer und Architekten. Zum Beispiel was die Architekten vorkehren können, um die Ärzte von Platz 1 in der Balzhitparade zu verdrängen.
Köbi Gantenbein
Inhalt
06 Meinungen
10 Funde
13 Kolumne
19 C-Ausweis
20 Titelgeschichte: Die Entdeckung neuer Räume
Die Landschaftsarchitektur ist in der Stadt angekommen. Hochparterre begrüsst sie mit einem Buch und berichtet hier von sechs neu gestalteten Orten.
32 Raumplanung: Das eidgenössische Sollen
Brief des Stadtwanderers an den Bundesrat zum neuen Gesetz.
34 Architektur: Zurück in die Zukunft
Die vorbildliche Sanierung des Schulhaus Dula in Luzern.
40 Design: Luft über den Wolken
Swiss spart Gewicht mit neuen Sitzkissen.
42 Architektur: Alles oder nichts
Der Künstler Not Vital baute ein Haus, das verschwindet.
46 Verkehr: Das Ende der Autobahn
Die Westumfahrung ist fertig. Jetzt kann die Hardbrücke weg.
54 Wettbewerb: Brücken zwischen Statik und Ästhetik
Jürg Conzett im Gespräch über den Ingenieurwettbewerb.
56 Design: Das missbrauchte Muster
Die Expertin sagt, welche Ornamente gelungen sind, welche nicht.
62 Architektur: Bildung im Klinkerkleid
Die neuen Mauern des Careum prägen das Zürcher Platte-Quartier.
68 Leute
72 Siebensachen
74 Bücher
78 Fin de Chantier
84 Raumtraum
Alles oder nichts
Der Künstler Not Vital hat in Sent ein Haus gebaut, das auf Knopfdruck in der Erde verschwindet.
Not Vital verwirklicht einen Bubentraum nach dem anderen. Letztes Jahr hat der international erfolgreiche Künstler aus Sent im Unterengadin eine Insel im chilenischen Patagonien gekauft, in die er ein Höhlensystem graben will. Im italienischen Carrara höhlen seit über einem Jahr zwei Steinmetze in seinem Auftrag ein 9x2x2 Meter grosses Marmorstück aus — daraus entsteht eine begehbare Turmskulptur für einen belgischen Sammler. Auch in der afrikanischen Wüstenstadt Agadez baut der Künstler.
Seit 2000 erstellt er dort Lehm-Skulpturen — eine Schule oder ein Haus, das nur dazu dient, den Sonnenuntergang zu beobachten siehe HP 11 / 06. 1999 kaufte er den unfertigen Traum eines Anfang letztes Jahrhundert ausgewanderten Senters, einen Park, den der Industrielle am Eingang zu seinem Heimatdorf zwischen den Weltkriegen anlegen liess. Vital hat ihn in die Stiftung «Parkin Not dal mot» überführt und in jahrelanger Arbeit zusammen mit seinem Bruder Duri renoviert. 14 Skulpturen und Installationen hat er bis anhin darin realisiert. Unter anderem ein Haus aus Glas, eine Holzhütte am Wasserfall, zwei Eselsbrücken aus Aluminium, einen Turm der Stille.
Ein Bubentraum
Seinen Hang zum Bauen erklärt der Künstler mit seiner Lebensgeschichte, schon als Kind baute er Hütten im Wald: «Die Sommer in Sent waren lang, die Schulen fünf Monate geschlossen. Was mit der vielen Freizeit anfangen», fragt er und gibt die Antwort gleich selbst: «Hütten bauen!» Zusammen mit den anderen Dorfbuben, aber auch alleine konstruierte er aus Abfallholz und Fundstücken Baumhütten, Unterstände, kleine Refugien. «Ich wollte schon immer meine bauen», so der heute 61-Jährige. Sein internationaler Erfolg als Plastiker, Zeichner oder Kupferstecher erlaubt es ihm nun, an seine Bubenträume anzuknüpfen und sie rund um die Welt und im grösseren Massstab zu verwirklichen. So hat sich das Haus als Skulptur als wichtiger Zweig in Vitals vielseitigem Schaffen etabliert.
Rauf und runter
Sein neustes Werk ist «Josüjo» («Runter-Rauf-Runter»in Rumantsch). Er hat es mit seinem Assistenten Mitsunori Sano entwickelt und in den «Parkin» gebaut. Es ist ein Einraum-Stahlhaus — ein «Teepavillon», wie Vital sagt — der auf Knopfdruck in der Erde verschwindet. «Ich wollte eine neue Skulptur in den bauen, aber den Gesamteindruck, die ausgewogene Verteilung der bisherigen Werke im Gelände, nicht in Frage stellen», erklärt Vital sein Dilemma rückblickend. «Das führte schliesslich zur Idee von , einem Haus, das da und dann wieder weg ist.» Form und Ausführung waren schnell klar: Das «Haus» sollte aus 10 Millimeter dicken Stahlplatten gebaut sein, im steilen Hang unterhalb der Strasse liegen und die Form eines Kuchenstücks haben.
Hydraulische Hebeanlage
Mit diesen wenigen Vorgaben ging Vital zum Ingenieur Jürg Buchli, der schnell Feuer fing für das Projekt. «Anfangs haben wir noch Ideen verfolgt, das Haus mit Luftkissen oder Wasserdruck zu heben. Wir haben aber schnell gemerkt, dass solche Lösungen das Budget sprengen. Deshalb haben wir uns für eine konventionelle hydraulische Hebeanlage entschieden. Sie lässt heute das über zehn Tonnen schwere Gebilde rauf- und runterfahren», so der Ingenieur aus Haldenstein. Das Projekt musste zwei grosse Hürden nehmen: Das schwierige Gelände und Kosten, die sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Denn die Betonwanne, in der der Stahlkörper rauf und runter fährt, liegt in einem Grund, der nicht sehr stabil ist und erst noch Wasser führt. Deshalb mussten die Arbeiter eine ziemlich grosse — und damit teure — Baugrube für die über fünf Meter tiefe Betonwanne ausheben. Aushub und Wanne machen rund die Hälfte der Baukosten aus, erklärt Jürg Buchli. Die hohen Kosten der Arbeit unter der Erde schränkten die Raffinesse der Hebeanlage ein. Deshalb liegen die drei Hubzylinder für den Betrachter unsichtbar in den Ecken des Innenraums und nicht wie erwartet zwischen Betonwanne und Haushülle. «Eigentlich ist die Hebeanlage nicht mit einem Lift, sondern eher mit der Kippanlage eines Lastwagens vergleichbar», schmunzelt der Ingenieur.
Kunst und Architektur
Not Vital selbst klassiert «Josüjo» als Architektur- und Kunstwerk. An seinem jährlichen «Parkin»-Fest präsentierte der Bündner das Haus zum ersten Mal einer grösseren Öffentlichkeit. Geladen waren viele Architekten und Künstler.
Die Reaktionen gingen von Begeisterung bis hin zur Irritation. «Mich erinnert das Haus an Filmsets von Ken Adam», sagt der Lausanner Künstler Karim Noureldin, «besonders interessant finde ich aber auch, wie sich das Haus wortwörtlich an der Schnittstelle von Skulptur und Architektur bewegt. Selten nähert sich eine Plastik derart an ein Gebäude an, ein bewohnbares Haus, das gleichzeitig nur Zeichen, Bild und Kunstwerk ist.» Robert Obrist sieht das Haus weniger als Architekturobjekt, denn als begehbare Plastik: «Für mich ist vor allem ein wichtiger Diskussionsanstoss», meint der St. Moritzer Architekt, «es wäre doch elegant — und meiner Meinung nach technisch durchaus machbar —, wenn man alle Zweitwohnungsbauten im Engadin auf Knopfdruck verschwinden lassen könnte. Doch leider ist die rege städtebauliche Diskussion verstummt, die an Vitals Fest entbrannte.»
Für Christoph Gantenbein stellt das Haus grundsätzliche Fragen ans Bauen und die Architektur: «Für uns Architekten ist es das tägliche Brot, anstelle des Nichts etwas zu schaffen», so der Partner bei Christ & Gantenbein. «Not Vital kehrt dieses Prinzip um: Er lässt ein Haus einfach wieder verschwinden.»
Aus dem Nichts ins Nichts
Ob Kunst- oder Architekturwerk — «Josüjo» kann durch sein quasi spurloses Verschwinden auf Knopfdruck als subversive Kritik an der Architektur verstanden werden. Denn wenn das Haus versenkt und der Lärm der Hydraulik verhallt ist, bleibt nur noch scheinbar unberührte Landschaft übrig. Dadurch, dass der Ort gleichzeitig mit und ohne Haus erlebbar ist, sozusagen das Vorher und Nachher gleichzeitig abrufbar sind, schärft Vital unsere Wahrnehmung und den Blick auf die Landschaft. Damit ist die Skulptur trotz ihrer rohen Umsetzung radikaler als manches ausgefeilte Bauwerk: Sie stellt nicht die Frage nach der Art der Architektur, sondern ob es sie überhaupt braucht.
Skulpturenpark Sent
Den Skulpturenpark «Not dal mot» am Dorfeingang von Sent kann man im Sommer besichtigen. Not Vital hat den historischen Park gekauft, ihn zusammen mit seinem Bruder Duri ausgeräumt und darin unter anderem eine Baumhüt-te platziert, einen Turm der Ruhe, eine Esels-brücke, ein Haus aus Glas und ein Haus, um den Wald anzuschauen. Vitals neuste Arbeiten sind «Josüjo» und die Spiegelbrücke «Punt». Im Sommer veranstaltet Sent Tourismus jeden Freitag Führungen durch den Park.hochparterre, Mo., 2009.04.06
06. April 2009 Roderick Hönig, Annina Weber
Brückenschlag zwischen Statik und Ästhetik
Jürg Conzett zum Auswahlverfahren an Wettbewerben: «Den Bauingenieur über das Honorar zu wählen, macht die Brücken nicht besser.»
Gehts dem Brückenwettbewerb in der Schweiz schlecht?
Erfreulicherweise sind heute Brückenwettbewerbe wieder ein Thema. Noch in den Achtzigerjahren gab es sie kaum. In Graubünden war die Tardisbrücke in Landquart 2001 nach etwa zwanzig Jahren der erste Wettbewerb für eine Strassenbrücke im Kanton. Dem vorausgegangen war ein Dialog, in dem ein paar Kollegen und ich das Tiefbauamt aufgefordert hatten, wieder Brückenwettbewerbe auszuschreiben. Man ist darauf eingestiegen und kam zum Schluss, dass das Verfahren gut war. Es folgten im Kanton Graubünden viele Brückenwettbewerbe.
Weshalb haben Sie eine Tagung zum Brückenwettbewerb veranstaltet?
Die verschärften Konkurrenzvorschriften des Gatt / WTO bedrohen den Ingenieurberuf. Denn sie haben vor allem zu Honorarkonkurrenzen geführt. Den Bauingenieur über das Honorar zu wählen, ist zwar üblich, aber die Brücken werden so nicht besser. Denn die Büros schrumpfen ihre Arbeit auf ein Minimum ein und Engagement wird bestraft. So entsteht keine Qualität, sondern die billige Standardisierung wird gefördert. Eine solche Entwicklung widerspricht unseren Interessen, denn wir nennen uns «Gesellschaft für Ingenieurbaukunst». Auch wenn der Brückenwettbewerb immer noch ein neues Verfahren ist, können wir heute dank der kleinen Renaissance des Wettbewerbs auf die letzten Jahre kritisch zurückschauen.
Modell für die Beurteilung
Was muss sich im Ingenieurwettbewerb verbessern?
Über den Einzelfall hinaus hätte ich gerne ein paar allgemeine Konventionen. Die Verfahren sind zwar in den SIA-Ordnungen gut geregelt. Doch wir sollten von den Architekten lernen: Ich wünsche mir beispielsweise, dass alle Projekte auch anhand vom Modellen beurteilt werden.
Das wird nicht gemacht?
Nein, Modelle lässt der Veranstalter erst von den Projekten in der engeren Wahl bauen. Bei der Taminabrücke hatten wir eine schöne Brücke eingereicht. In der Beurteilung hiess es, der Bogen sei zu dick. Wir hatten im Büro natürlich ein Modell gebaut, das wir nicht abgeben durften. Der Bogen war profiliert und nach meiner Beurteilung sah das Modell nicht schlecht aus. Eine erste Wahl akzeptiere ich, aber dann will ich in dieser Stufe keine ästhetische Kritik über Proportionen hören.
Was machen die Bauingenieure sonst noch falsch?
Wir sollten mehr an die Nachwuchsbüros denken. Sie erhalten zu wenige Chancen. Und wir vergessen häufig, dass ein Wettbewerb auch Öffentlichkeitsarbeit ist. Es geht nicht nur darum, einen Sieger zu finden, sondern auch, weitere rangierte und nicht rangierte Projekte zu zeigen. Diese Diskussion sollten wir nicht nur unter Fachleuten führen, sondern auch öffentlich. Das wäre die beste Art, die oft introvertierte Arbeit des Ingenieurs bekannt zu machen.
Jurierungen überdenken
Könnte man auch anders jurieren?
Wir sollten uns bei den Jurierungen fragen, ob man ein bestimmtes Konzept und die entsprechenden Projekte prämiert, die einander ähneln, oder ob man von verschiedenen Konzepten jeweils das am besten ausgearbeitete Projekt belohnt. Die erste Haltung fördert eine präzise Art des Denkens und schafft eine Entwurfskultur, während die zweite nach aussen eher unentschieden wirkt. Man könnte sich vielleicht auch einmal in der Erarbeitung des Programms für den geeignetsten Brückentyp entscheiden und dann einen Wettbewerb mit vorgegebenem Typ durchführen. Dies würde die Entwurfsenergie bündeln und zudem auch die Wettbewerbsveranstalter und die Jurys mehr in die Verantwortung nehmen.
Ist der offene Wettbewerb das Heilmittel?
Im Gegensatz zu den Architekturwettbewerben wird der Veranstalter bei einem Brückenwettbewerb nicht überschwemmt. Bei einem offenen Ingenieurwettbewerb werden zehn bis vierzig Projekte abgegeben, was problemlos zu bewältigen ist. Ich begrüsse den offenen Wettbewerb. Selbstverständlich gibt es auch andere Verfahren, die je nach Fall ebenso ihre Berechtigung haben. Mit Wettbewerb im Brückenbau meine ich den Projektwettbewerb, den Studienauftrag, den Gesamtleistungswettbewerb und zum Beispiel auch den Miniwettbewerb, den Michel Donzel während seiner Amtszeit im Bundesamt für Strassen immer wieder veranstaltete.
Die Tradition des Ankaufs gibt es bei den Ingenieuren nicht. Halten sie sich zu brav an die Bedingungen?
Meine Meinung ist: Es sollte unnötig sein, dass man sich nicht an Bedingungen hält. Es gehört zur Ingenieurarbeit, mit Vorgaben umzugehen. Häufig gibt es bei Strassen- und Bahnbrücken harte Bedingungen. Ich kann die Lage einer Brücke nicht verschieben. Es ist auf jeden Fall gut, klar zu sagen, was geht und was nicht. Je präziser die Bedingungen im Wettbewerbsprogramm formuliert sind, desto besser versteht man die Aufgabe und desto besser das Resultat. Interessant ist, dass auch unter stark einschränkenden Bedingungen immer ein Gestaltungsspielraum besteht.
Die Tradition
Warum ist das Kostenargument so wichtig bei Ingenieurwettbewerben?
Es hat mit der Geschichte des Ingenieurberufs zu tun. Die Tradition reicht bis zur 1747 in Frankreich gegründeten École Nationale des Ponts et Chaussées zurück, zur ersten Ingenieurschule. Man wollte damals alle Strassenbauer zentral ausbilden, damit sie die ökonomischen Interessen des Staates wahrnehmen. Der Strassen- und Brückenbau war vorher in den Händen von Zünften gewesen. Ein Grund für den Beruf des Ingenieurs war: Wir wollen Leute, die präzis voraussagen können, was etwas kostet und leistet. Das war ein Bedürfnis der Gesellschaft vom 18. Jahrhundert an bis heute.
Und der Wettbewerb soll denjenigen belohnen, der am günstigsten ist?
Ein schönes Beispiel ist die 1930 fertiggestellte Salginatobelbrücke von Robert Maillart, die bekanntlich im Wettbewerb die billigste war. Ich wage zu behaupten, dass es damals keine Rolle spielte, ob sie auch die schönste war. Die ganze Eisenbetonbauweise konnte sich durchsetzen, weil sie eben billiger war als Stahl oder Stein. Die Kosten waren ein kräftiges Argument, um das Neue zu fördern.
Maillart war deshalb erfolgreich. Die Auseinandersetzung mit der Wirtschaftlichkeit ist Teil des Ingenieurberufs. Doch heute muss man das im Umgang mit dem baulichen Erbe in Frage stellen. Bei einer Instandsetzung immer die billigste Lösung zu nehmen, ist sicher falsch. Doch nicht nur in der Denkmalpflege müssen diese Fragen neu formuliert werden. Aber es ist schon so: Bei einer grösseren Brücke gehts sofort um viel Geld, meist um zweistellige Millionenzahlen.
Dürfte eine schöne Brücke auch mehr kosten als unbedingt nötig?
Dass man überhaupt wagt, diese Frage zu stellen, und nicht davon ausgeht, dass die wirtschaftliche Lösung auch die richtige ist – das wünsche ich mir.
Das Ansehen des Ingenieurs heben
Im Februar fand zum ersten Mal eine Diskussion zum Thema «Wege zur Ingenieurbaukunst — der Brückenwettbewerb» statt. Veranstaltet hatte sie die Gesellschaft für Ingenieurbaukunst zusammen mit der Stiftung Forschung Planungswettbewerbe.
Jürg Conzett provozierte im Einführungsreferat mit Forderungen zum Brückenwettbewerb, während Michel Donzel, Bereichsleiter Kunstbauten beim Bundesamt für Strassen, den «Miniwettbewerb» propagierte, ein selektives Verfahren für Bausummen unter fünf Millionen Franken. Donzel kam zum Schluss, dass die Öffentlichkeit bereit sei, für Ästhetik mehr zu zahlen. Der ETH-Professor für Baustatik, Thomas Vogel, und der Bauingen-ieur Massimo Lanffranchi berichteten von ihren Erfahrungen mit dem Ingenieurwettbewerb. Jürg Conzett ist Teilhaber des Büros Conzett, Bronzini, Gartmann in Chur. Er ist seit zwei Jahren Präsident der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst. Ziel der 270 Mitglieder ist, das Ansehen des Ingenieurs in der Schweiz zu heben. Konkret hat die Gruppe Bücher herausgegeben wie «Robert Maillart — Beton-virtuose» oder «Christian Menn — Brückenbauer».
Kommentar: Austausch tut not
Als Architekt staunt man. Die Ingenieure halten sich an die gleichen SIA-Normen. Und doch herrscht eine andere Wettbewerbskultur. Die Verfahren sind teilweise völlig anders. Wer sich nicht an die Bedingungen hält, der fliegt aus dem Verfahren. Der Ankauf ist unbekannt, also kann der bewusste Verstoss gegen das Wettbewerbsprogramm nicht belohnt werden.
Modelle lassen die Veranstalter selbst bauen, aber nur von den Projekten in der engeren Wahl. Das verbreitete Punktesystem eignet sich kaum für eine faire Gesamtbeurteilung. Selbst Statikprofessoren fordern, die Ingenieurwettbewerbe «architektenmässiger» zu gestalten. Doch staunt der Architekt auch, wie offen die Bauingenieure über die Verfahren reden. Fairness ist oberstes Ziel. Und da wird sogar über die Juryzusammensetzung diskutiert — eine heilige Kuh bei den Architekten. Kurz: Architekten und Bauingenieure können voneinander lernen. Das wäre ein Thema für eine nächste Tagung.hochparterre, Mo., 2009.04.06
06. April 2009 Ivo Bösch
Bildung im Klinkerkleid
Dem Careum ist ein starker Auftritt gelungen. Die Mauern bieten der Schule mehr Platz und verleihen dem Platte-Quartier einen neuen Charakter.
Die Platte, eine Geländestufe am Zürichberg, ist seit Langem ein Brennpunkt des Gesundheitswesens und der Architektur. Das jüngste Familienmitglied ist der Careum Campus, eine Überbauung von GWJ Architekten mit dem Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe und Wohnungen. Dort wo die Platte in den Hang übergeht, stehen fünf kantige, in Klinker gehüllte Kuben. Die Hauptrolle spielt das Schulgebäude an der Ecke Gloria- / Pestalozzistrasse, das mit einem «Schaufenster» in die Stadt blickt. Dahinter ragt eine höher gestellte Hausscheibe mit weiteren Schul- und Laborräumen empor. Diese spannt mit dem Haupthaus einen Winkel auf und umschliesst den dreieckigen Platz, den eine Sandsteinklippe von Piero Maspoli gegen die Strasse abschliesst. Drei weitere Gebäude stehen im hinteren Teil des Areals; im einen gibt es Büros in den Sockel- und Wohnungen in den Obergeschossen, die beiden anderen sind Wohnhäuser.
Harte Hülle
GWJ Architekten haben den Careum Campus als ein Stück Stadt komponiert. Die fünf Häuser vermitteln zwischen dem grossen Massstab des Spital- und Hochschulquartiers mit dem Zahnärztlichen Institut und dem Schwesternhochhaus in der unmittelbaren Nachbarschaft und der kleinmassstäblichen Bebauung des Zürichbergs. Die Architekten nutzten das abfallende Gelände, um Höfe und Terrassen zu bilden, die Landschaftsarchitekten Klötzli und Friedli haben diese Aussenräume gestaltet.
Wer durch die Höfe und Gassen spaziert, begibt sich auf eine Promenade architecturale; zwischen den Neubauten hindurch öffnen sich Blicke auf die anderen Bauten des Campus, auf die stolzen Villen des Zürichbergs oder auf die Grossbauten der Sechzigerjahre. Die verschiedenartig gemauerten Klinkersteine verbinden die unterschiedlich genutzten Gebäude zu einem Ensemble: An den Sockelbereichen, an den Deckenstirnen und den Stützmauern bilden Läuferverbände homogene Flächen, in den Geschossen ist jede zweite Läuferschicht zurückgesetzt, sodass eine starke horizontale Zeichnung entsteht, die entweder als geschlossene Wand oder als lichtdurchlässiges Gitter ausgeführt ist.
Im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten changieren die Fassaden in unterschiedlichen Farben, nicht nur dank dem lebendigen Material, sondern auch dank dem Relief, das wie ein präzises Ornament über den Gebäuden liegt. Der Klinker ist als Material so dominant, dass man erst auf den zweiten Blick die unterschiedlich gros-sen, aber immer geschosshohen Öffnungen registriert — Fensterbänder an den Schulgebäuden, Lochfenster an den Wohnhäusern.
Weicher Kern
Das Herzstück des Hauptgebäudes ist die sogenannte «Kommunikations- und Bildungslandschaft» mit Bibliothek, Cafe-teria und Studierhof im Erd- und Sockelgeschoss. In den Obergeschossen sind die vielfältig nutz- und umnutzbaren Unterrichtsräume untergebracht. Dazu gehören die «Skillslabs», originalgetreu nachgebildete Krankenzimmer und Operationsräume, in denen die künftigen Pflegefachfrauen und -männer üben können — zum Teil an Schauspielerpatienten. Das Gebäude erinnert weniger an ein Schulhaus, bei dem die pädagogischen Anforderungen in Beton gegossen oder in Stein gemauert sind, sondern eher an ein Bürogebäude. Wer an die Trennwände klopft, stellt fest: Leichtbau! Die Raumaufteilung ist eine Momentaufnahme der aktuellen Bedürfnisse. Wandeln sich diese, bricht man die Wände mit wenig Aufwand ab und zieht sie an anderer Stelle neu ein.
Massiv und unverrückbar ist das Gebäude hingegen in seinem Kern. Treppenturm und Lichthof verbinden die «Bildungslandschaft» der unteren mit den Unterrichtsräumen der oberen Geschosse. Urs Eberles kräftige farbliche Gestaltung dieser beiden Räume unterstreicht die Bedeutung dieser Vertikalen als Orte der Kommunikation.
Das Erbe des Pfarrers
So neu die Gebäude und so modern der Name, so alt ist die Tradition, die hinter dem Careum steht. Im Jahr 1880 regte Pfarrer Walter Bion an, eine Anstalt zu gründen, an der Krankenpflegerinnen frei von religiöser Propaganda ausgebildet werden können. 1882 nahm sie ihre Arbeit auf und wurde bald zur Stiftung. Die Ausbildung war immer das wichtigste Standbein, obschon das angegliederte Rotkreuzspital in der Öffentlichkeit bekannter war. Als in den Neunzigerjahren die Belegung stark zurückging, prüfte die Stiftung Kooperationen mit anderen Privatspitälern. Diese waren aber nicht realisierbar, auch wegen des Vetos der kantonalen Gesundheitsdirektion, die Akutbetten und Kosten reduzieren wollte.
Schliesslich beschloss die Stiftung, das Rotkreuzspital Ende September 1997 zu schliessen. «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», meinte Stiftungspräsident Arnold Saxer.
Die Neuausrichtung zielte auf die Erhaltung der Bildung in den Gesundheitsberufen. Dafür wurde eine neu konzipierte Berufsschule für Pflege geplant. Neben der Schule sollten aber auch Wohnungen des mittleren und oberen Segments entstehen. Dies, um den gesetzlichen Wohnanteil von vierzig Prozent zu erfüllen, aber auch als Immobilienanlage, deren Erträge wieder in den Stiftungszweck investiert werden.
Zwei Workshops mit der Stadt Zürich bildeten die Basis für die Planung. Ende 1999 lud die Stiftung fünf Architektenteams zu einem begleiteten Studienauftrag ein. «Begleitet» heisst, dass die Architekten während des Verfahrens ihre Skizzen und Entwürfe in zwei Workshops vorstellten.
Nicht hinter verschlossenen Türen planen
Die erste Veranstaltung fand im Februar 2000 statt. Das Tagesziel waren eine Auslegeordnung der städtebaulichen und planerischen Strategie sowie das Verhältnis zwischen Alt- und Neubauten. Während des ganzen Tages waren auch sämtliche Wettbewerbsteams anwesend. Am Abend wusste also nicht nur die Stiftung, in welche Richtung die einzelnen Teams arbeiteten, sondern auch die Konkurrenten waren gegenseitig über ihre Konzepte orientiert.
Im zweiten Workshop im Mai 2000 stellten die Teams ihre Projekte unter Ausschluss ihrer Konkurrenten vor. «Erhärtung der Projektstrukturen» lautete das Tagesziel. Die letzte Runde des Studienauftrags endete mit der Abgabe der fünf Projekte im Sommer 2000 und dem Entscheid des Beurteilungsgremiums.
Mark Werren von GWJ Architekten erinnerten die Workshops an die Zwischenkritiken zu Studienzeiten: «Dieses Verfahren hat uns motiviert. Wir lernten die Bauherrschaft kennen und verstanden, welche Programmpunkte noch offen sind.» Damals war in der angestrebten neuen Art der Ausbildung noch nicht alles definiert und die Stiftung gewann die Erkenntnis, dass sie das Projekt allenfalls etappieren oder einzelne Bauten erhalten will — was schliesslich ein wichtiger Punkt für die Wahl von GWJ Architekten war. Als einziges skizzierte ihr Projekt die Verwirklichung in zwei voneinander unabhängigen, städtebaulich überzeugenden Etappen.
Neue Schule fürs neue Haus
Parallel zu den Planungen am neuen Haus arbeitete die «Stiftung Schwesternschule und Krankenhaus vom Roten Kreuz in Zürich-Fluntern», wie sie immer noch hiess, an den neuen Ausbildungsgängen. Der Kanton wollte seinerseits die 26 bestehenden Ausbildungsstätten für Gesundheitsberufe auf zwei reduzieren, in Winterthur und in Zürich. Mit der neuen Ausbildung und dem neuen Haus, das bereits im Bau war, stand die Stiftung für diese Aufgabe bereit. Die Bemühungen haben sich gelohnt: Anfang 2005 wurde mit dem Kanton Zürich die Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Zusammen mit den drei Partnern Kalaidos, Neumünster und Eleonorenstiftung wurde das «Careum Bildungszentrum, Zürich» gegründet. Damit waren die Voraussetzungen für den Start der zweiten Bauetappe gegeben.
Für die Gebäude, die nicht vom eigenen Bildungszentrum benötigt werden, wurden weitere Mieter gesucht, die dem Stiftungszweck entsprechen. So zogen die Medizinbibliothek der Universität und des Universitätsspitals, das Dekanat und das Studiendekanat der Medizinischen Fakultät ins Haus. Dazu gesellten sich weitere Institutionen aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich. Doch auch die Stiftung Careum expandierte, gründete einen Verlag oder ein Fachportal im Internet.
Das erste Jahr unter Vollbetrieb ist abgeschlossen; gegen 2000 Studierende beleben den Campus — zur Zufriedenheit aller, wie Stiftungsrat René Kühne unterstreicht: «Die Reaktionen der Schülerinnen und der Bewohner sind positiv. Das hat nicht zuletzt mit der Architektur zu tun.»hochparterre, Mo., 2009.04.06
06. April 2009 Werner Huber