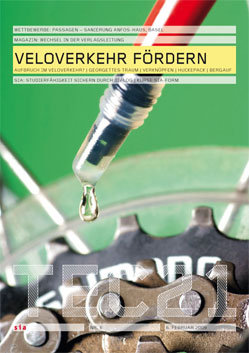Editorial
Vor Kurzem konnte man in der Zeitung die Schlagzeile «Auf Frühenglisch folgt nun Frühfranzösisch» lesen - bei einem solchen Programm bleibt Kindern kaum Zeit für freie Beschäftigungen wie «Velöle»: Einfach mit dem Velo durch die Gegend fahren, Spass haben und gleichzeitig Sicherheit im Umgang mit dem Fahrzeug bekommen. Eine bedenkliche Tatsache ist, dass immer weniger Kinder und Jugendliche mit dem Velo unterwegs sind. Dabei ist Velofahren eine gesunde und umweltfreundliche Mobilitätsform, und jeder neue Velofahrer entlastet den öffentlichen und den Individualverkehr. Im Hinblick auf bestehende Verkehrsprobleme ein lohnender Gedanke.
Ein gutes Verkehrsangebot hilft, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen, und animiert auch Personen, die dem Velofahren noch reserviert gegenüberstehen, das Velo vermehrt für die täglich zurückzulegenden Wege zu benutzen. Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren den Veloverkehr in die Planung ihrer Vorhaben einbezogen. Werden weitere Schwachstellen beseitigt, können die Massnahmen ihre Wirkung voll entfalten und das Velo als Nahverkehrsmittel eine Renaissance erleben. In den Agglomerationsprogrammen der Kantone sind viele solcher Massnahmen geplant und werden vom Bund unterstützt.
Um das Velofahren interessant zu machen und mehr Menschen für den Gebrauch im Alltag zu begeistern, braucht es aber mehr als nur infrastrukturelle Massnahmen. Der Ausbau der Verkehrswege und die Parkierungsmöglichkeiten können noch so durchdacht sein, es werden sich immer verschiedene Verkehrsmittel den zur Verfügung stehenden Raum teilen müssen. Ein störungsfreies und sicheres Miteinander wird erreicht, wenn viele Verkehrsteilnehmer alle Verkehrsformen nutzen und so das gegenseitige Verständnis geschult wird. Verhältnisse wie im Comic «Georgettes Traum» (S.20) werden immer ein Traum bleiben, dennoch ist die Förderung des Veloverkehrs notwendig und sinnvoll.
Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Passagen – Sanierung Anfos-Haus, Basel
13 MAGAZIN
Wechsel in der Verlagsleitung
18 AUFBRUCH IM VELOVERKEHR?
Ruedi Weidmannn
Das grosse Potenzial und die Schwachstellen sind bekannt, die Handbücher und Vollzugshilfen verfasst; dennoch wird die Förderung des Veloverkehr noch stiefmütterlich behandelt.
20 GEORGETTES TRAUM
Anna Röthlisberger
Hindernisfrei durch die Stadt, genügend Veloabstellplätze – ein
Traum?
23 SINNVOLL VERKNÜPFEN
Alexander Felix
Die Vorteile von Velo und öffentlichem Verkehr können durch eine
sinnvolle Verknüpfung und passende Massnahmen gefördert werden.
28 UNGELIEBTES HUCKEPACK
Nora Kempkens
In der Schweiz scheint die Meinung vorzuherrschen, dass die Velomitnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln die sinnvollste Förderung sei: ein Gegenbeispiel aus den Niederlanden.
30 BERGAUF
Daniela Dietsche
Ein Lösungsansatz wird immer wieder diskutiert: Der Velolift in Trondheim läuft seit gut 15 Jahren unfallfrei. Dennoch gibt es weltweit keinen zweiten.
34 SIA
Studierfähigkeit sichern durch Dialog | Sofia, europäische Hauptstadt – A&K-Reise | Zwei Register | Kurse SIA-Form
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Aufbruch im Veloverkehr?
Seit 30 Jahren fördern Schweizer Gemeinden das Velofahren – mit insgesamt mässigem Erfolg. Doch nun könnte das Velo definitiv entdeckt werden, denn in den Agglomerationen stossen die Verkehrssysteme an Kapazitätsgrenzen. Der Bund hat das grosse Entlastungspotenzial im Veloverkehr erkannt: Seine Agglomerations- und Klimapolitik, die Rezession und steigende Energiepreise könnten Kantone und Gemeinden dazu bringen, die an sich bekannten Velofördermassnahmen ernsthaft umzusetzen. Wie sähe eine Förderung aus, die konsequent die Vorteile des Velos nutzt und seine Nachteile mildert?
Velofahren braucht fünf Mal weniger Energie als Gehen und rund 100 Mal weniger als Autofahren. Trotz dieser technischen Genialität und weiteren Vorteilen haben Kantone und Gemeinden, mit wenigen Ausnahmen, das Velo als Nahverkehrsmittel bisher kaum ernst genommen. Sie haben auf den öffentlichen Verkehr (ÖV) gesetzt. Doch nun beginnt dieser am eigenen Erfolg zu leiden. Zum Stau auf den Strassen kommen immer häufiger überfüllte Züge, S-Bahnen, Trams und Busse hinzu – und der Verkehr soll weiter zunehmen. Etwa die Hälfte der Wege, die in den Agglomerationen mit ÖV oder Auto zurückgelegt werden, würden mit dem Velo weniger als zwanzig Minuten dauern. Ein konsequent geförderter Veloverkehr könnte den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den ÖV im Alltag wie in der Freizeit entlasten. Investitionen in den Veloverkehr sind volkswirtschaftlich deutlich effizienter als beim MIV und beim ÖV:[1] Velofahren braucht 10 bis 20 Mal weniger Verkehrsfl äche als der MIV, schont die Umwelt und trägt dank der Bewegung zur Gesundheit bei. Im Zeichen von Rezession, Klimaerwärmung, mittelfristig steigenden Energiepreisen und zunehmender Überlastung des ÖV dürften diese Vorteile an Bedeutung gewinnen. Umso mehr, wenn der Bund wie angekündigt weitere externe Kosten des MIV über eine CO2-Abgabe und eine höhere Mineralölsteuer internalisieren und zusätzliche ÖV-Infrastruktur über höhere Billettpreise finanzieren wird.
Potenzial und reale Trends
Eine Studie des Nationalen Forschungsprogramms 412 schätzt, dass der Langsamverkehr bis zu 50 % aller MIV-Fahrten in städtischen Gebieten ersetzen könnte (Velofahrten 100 %, Etappen zu Fuss 40 %, ÖV-Fahrten 30 %, MIV – 50 %). Grossstädte in Holland und Nordrhein- Westfalen haben solche Zahlen erreicht und den Veloanteil an allen innerstädtischen Fahrten auf 30 bis 40 % gesteigert. In der Schweiz erreicht Winterthur immerhin 25 %. Eine andere Schätzung sieht ein Verlagerungspotenzial für 6–15 % aller landesweiten MIV-Fahrten.3 Zum realen Veloverkehr ist die statistische Datenbasis dünn – hierzulande ein Indiz dafür, dass ein Gebiet von der Politik nicht ernst genommen wird. Zahlen gibt es nur aus einigen Städten. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat ein Konzept für den Aufbau einer schweizerischen Langsamverkehrsstatistik erarbeiten lassen, die den Langsamverkehr in einer mit dem MIV und dem ÖV vergleichbaren Weise erfassen würde.[4] Der Veloverkehr hat in den letzten Jahrzehnten langsam zugenommen, doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Veloanteil am Langsamverkehr nun stagniert.[5] Vor allem die Zahl velofahrender Kinder und Jugendlicher hat in den letzten zehn Jahren deutlich abgenommen.[6] Für den Veloverkehr ist das verheerend, denn wer nicht als Kind Velo fahren lernt, wird später kaum noch damit beginnen.
Neue Bundespolitik
Der Bund hat die Bedeutung des Veloverkehrs erkannt. Er will ihn zusammen mit dem Fussverkehr im Interesse einer zukunftsfähigen Verkehrsinfrastruktur als gleichwertige dritte Säule des Personenverkehrs neben MIV und ÖV etablieren.[7] Seine Unterstützung von Verkehrsinfrastrukturprojekten der Agglomerationen bis 2018 mit 6 Mrd. Franken aus der Mineralölsteuer gewährt er aufgrund von Agglomerationsprogrammen, die unter anderem konkrete Ziele und Fördermassnahmen für den Fuss- und Veloverkehr enthalten müssen.[8] Die Neuausrichtung der Bundespolitik dürfte Signalwirkung auf Kantone und Gemeinden haben. Studiert man die 30 vom Bund unterstützten Agglomerationsprogramme aus Sicht des Langsamverkehrs, zeigt sich ein insgesamt zufriedenstellendes Bild. 2011–18 sollen 618 Mio. Franken in Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs investiert werden, ein guter Teil davon kommt dem Veloverkehr zugute, meist einer Vielzahl von einzelnen kleinen Verbesserungen. Hinzu kommen Veloparkings bei Bahnhöfen für über 50 Mio. Franken.[9] Die Gelder für 2011–14 sollen im Herbst 2009 freigegeben werden.
Lücken und Uneinheitlichkeit
Manche Gemeinde hat schon bisher viel Geld in Velowege gesteckt. Zürich beispielsweise richtet seit über 30 Jahren Velostreifen ein, wo es rasch und einfach möglich ist.[10] Es konnte so den Veloanteil zunächst verdreifachen, doch heute stagniert er bei tiefen 6 % der Wege.[11] Nun zeigt sich die Krux dieser pragmatischen Strategie: Lücken im Veloverkehrsnetz wirken überproportional abschreckend. Der Arbeits- oder Schulweg ist eben nur so sicher wie seine gefährlichste Stelle. Die pragmatische Strategie ist ausgeschöpft und muss von einer konsequenten Veloförderung abgelöst werden, die alle Lücken, Gefahrenstellen und Umwege im Veloroutennetz beseitigt.[12] Ist dies erreicht, wird ein Quantensprung im Modalsplit möglich; dann werden alle bisher investierten Gelder fruchtbar werden.
Ein Problem ist die Uneinheitlichkeit der Infrastruktur. Die Unterschiede zwischen den Kantonen und Gemeinden sind nicht nur gross, was die bisherige Veloförderung betrifft, sondern auch bei der Gestaltung im Detail. Eine Velotour durch die Schweiz entpuppt sich als abwechslungsreiches Kennenlernen von Dutzenden von möglichen Verkehrslösungen. Das Patchwork setzt sich im Ortsinnern fort. So beklagt etwa die IG Velo Zürich, dass auf der 1.6 km langen Fahrt zwischen Helvetiaplatz und Zentralbibliothek in Zürich das Verkehrsregime für Velos 13 Mal wechsle.[13] Neben einzelnen VSS-Normen besteht keine kohärente Sammlung von Vollzugshilfen zu Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturanlagen des Veloverkehrs. Veloverkehrsnetze mit Lücken bleiben Flickwerke, die weder Auto- noch potenzielle Velofahrende als Verkehrssystem erkennen können. Hier braucht es einheitliche Definitionen und eine nationale Normierung. Die Velokonferenz Schweiz und das Astra wollen deshalb gemeinsam eine Sammlung von Vollzugshilfen erarbeiten.[14] Noch fehlende VSS-Normen zu Knoten und Querungen müssen zügig erstellt werden.
Bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen ist der Kanton Bern Vorbild: Er schreibt im Richtplan Veloverkehr vor, dass bei Strassenprojekten 10–20 % der Mittel für den Langsamverkehr eingesetzt werden müssen, und unterstützt die Gemeinden bei den Kosten.[15]
Stärken fördern
Konsequente Velopolitik muss die Stärken des Velos fördern und seine Schwächen mildern: – Innerorts und im Flachen hat das Velo eine höhere Tür-zu-Tür-Geschwindigkeit als MIV und ÖV. Dieser Vorteil im Alltagsverkehr muss einerseits durch ein Netz von direkten, lückenlosen, schnellen und sicheren Velorouten gestärkt werden, bestehend aus Velostreifen auf allen Hauptachsen, die an Knoten nicht unterbrochen werden und keine Konfliktstellen mit Fussgängern aufweisen.[16] Andererseits braucht es genügend Kurzzeit- und gedeckte Langzeit-Abstellplätze möglichst nah am Eingang aller öffentlichen und privaten Gebäude und ÖV-Stationen. Die kantonalen Baugesetze müssten für alle Wohn- und Geschäftshäuser genügend Veloabstellplätze – oder noch besser: Veloräume im Erdgeschoss – festschreiben. 17 Auch in diesem Punkt liegt der Kanton Bern mit seiner Bauverordnung vorne. Gemeinsame Veloräume mit Aufenthaltsqualität als Werkstatt und Garderobe wären eine sinnvolle Nutzung für das Erdgeschoss städtischer Wohnhäuser.
– Der Velo-Freizeitverkehr hat ebenfalls noch Potenzial und kann neue Tourismusimpulse setzen. Er braucht ein zweites, interkommunales Netz, das vor allem sicher sein muss.– Die maximale individuelle Bewegungsfreiheit im Siedlungsgefüge ist eine grosse Stärke des Velos. Sie wird durch flächendeckende Velotauglichkeit aller Strassen und Wege gestützt. Hier bewegen sich auch langsamere, mehr auf Sicherheit bedachte Velofahrende. – Die Kosten liegen, inklusive regen- und wintertauglicher Kleidung, bei wenigen hundert Franken pro Jahr. Sie sinken noch, wenn gedeckte Abstellplätze das Velo vor der Witterung schützen. Die Vorteile des Velofahrens geniesst eher, wer sich ein Velo von hoher Qualität leistet. – Die physische Bewegung des Systems Mensch–Velo kann Freude vermitteln. Voraussetzung dazu ist gutes Beherrschen des Geräts. Kurse könnten die Fahrtechnik verbessern, den Spass fördern und die Hemmschwelle für Umsteigewillige senken.
...und Schwächen mildern
Die Schwächen des Velos müssen mit spezifischen Massnahmen gemildert werden: – Velofahren ist gefährlicher als Zufussgehen. Nach den Regeln des Astra eingerichtete Velowegnetze würden hier aber bereits einen beträchtlichen Fortschritt bringen. – Auf langen Strecken und bergauf ist das Velo langsam. Kommunale Behörden versprechen seit 30 Jahren Lösungen durch den intermodalen Kombiverkehr. Doch je voller Trams und Busse werden, umso unwahrscheinlicher wird dieser Weg (vgl. Artikel S. 28). Er funktioniert nur, wo ÖV-Kapazitäten unternutzt sind. In den Agglomerationen ist deshalb die Lösung für Strecken über 10 km Länge eher im Aufbau der «Bike & Rail»-Kultur zu suchen (vgl. Artikel S. 23). Hilfe am Berg verspricht hingegen der Velolift (vgl. Artikel S. 30). – Velofahrende sind dem Wetter ausgesetzt. Durch Fortschritte der Outdoor-Bekleidungsindustrie sind die Unannehmlichkeiten heute fast passé. Es gibt kein schlechtes Velowetter mit Ausnahme von Glatteis. Schneeräumung auf Velostreifen sollte allerdings Pflicht werden. – Das Velo ist kein Statussymbol wie das Auto. Das ist ein veritabler Knackpunkt und eine interessante PR-Aufgabe. Massnahmen, die das Velofahren umständlich machen oder die Hemmschwelle für potenzielle Umsteiger zusätzlich erhöhen, wie die vom Bundesrat in Betracht gezogene Helmtragpflicht, sind hinderlich.
– Velos können relativ leicht gestohlen werden. Mit einem Zusatz zur Hausratversicherung für Diebstahl auswärts lässt sich das Velo für eine einstellige Frankensumme pro Jahr zum Neuwert versichern. Es wäre einmal zu prüfen, ob dieser Zusatz in die obligatorische Velo- Haftpflichtversicherung integriert werden könnte, was die Kosten auf einige Rappen senken und diese Sorge aus der Welt schaffen dürfte.
Daneben existieren hartnäckige Vorurteile: Dass Velofahren anstrengend sei oder dass man im Winter friere. Dabei empfindet der Körper täglich erbrachte Leistungen nicht als anstrengend, und frieren tut, wer sich nicht bewegt, also ÖV-Benutzer beim Warten.
Veloförderung als Querschnittaufgabe
So wichtig bauliche Massnahmen auch weiterhin sein werden, sie reichen allein nicht mehr aus. Veloförderung darf nicht mehr die Aufgabe von isolierten und im Vergleich mit MIV und ÖV massiv unterdotierten Fachstellen sein, sondern muss zu einer Querschnittaufgabe werden, die in allen Ämtern, die mit Mobilität zu tun haben, den gleichen Stellenwert hat. Es braucht auch mehr Massnahmen in den Bereichen Evaluation und Monitoring, Politiksteuerung, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Imageförderung und Akzeptanzsteigerung.
Investitionen in die Zukunft
Am wirksamsten ist Veloförderung bei den Kindern. Damit möglichst viele Velo fahren lernen, sind Tempo-30- und Begegnungszonen vor der Haustür nötig. Die Schule sollte Velofahren auf dem Schulweg ab dem Kindergartenalter aktiv fördern[19] und als Schulsport anbieten. Schliesslich ist die geniale Erfindung selber noch verbesserungsfähig. Mit vergleichsweise wenig Forschungsförderung wären spürbare Verbesserungen bei Gewicht, Mechanik, Unterhaltsbedarf, Licht, Zulademöglichkeit und nicht zuletzt beim Design zu erzielen.
Anmerkungen
[1] Astra (Bundesamt für Strassen): Effizienz von öffentlichen Investitionen in den Langsamverkehr. Bern 2003
[2] Netzwerk Langsamverkehr: Die Zukunft gehört dem Fussgänger- und Veloverkehr. Bericht A9 NFP 41, Bern 1999
[3] Astra: CO2-Potenzial des Langsamverkehrs. Bern 2005
[4] Astra: Konzept Langsamverkehrsstatistik. Bern 2005
[5] Macht der Veloboom Pause? Tiefbauamt der Stadt Zürich, Infoblätter Verkehrsplanung 1/2008
[6] Astra: Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Materialien Langsamverkehr Nr. 115, Bern 2008
[7] Astra: Leitbild Langsamverkehr, Entwurf
[8] Astra: Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogrammen. Materialien Langsamverkehr Nr. 112
[9] ARE (Bundesamt für Raumentwicklung): Prüfberichte des Bundes zu den Agglomerationsprogrammen. Bern 2008
[10] Pete M. nssen: 30 Jahre Veloförderung in der Stadt Zürich, 1975 bis 2005. Hg. Stadt Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, Zürich 2006; Tiefbauamt der Stadt Zürich: Mobilitätsstrategien der Stadt Zürich, Teilstrategie Veloverkehr. Zürich 2004
[11] Tiefbauamt der Stadt Zürich: Mobilitätsstrategie der Stadt Zürich, Teilstrategie Veloverkehr, Standbericht 2007; Tiefbauamt der Stadt Zürich: Macht der Veloboom Pause? Infoblätter Verkehrsplanung 1/2008
[12] Tiefbauamt der Stadt Zürich: BYPAD, Audit der Velopolitik der Stadt Zürich, Audit-Bericht und Qualitätsplan. Zürich 2008
[13] IG Velo Zürich, Positionspapier Innenstadt
[14] Christof Bähler: Handbuch «Infrastruktur Veloverkehr» – Werkstattbericht, Vortrag (PDF unter www.velokonferenz.ch/referate)
15 Tiefbauamt des Kantons Bern: Kantonaler Richtplan Veloverkehr
16] Astra: Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogrammen, Materialien Langsamverkehr Nr. 112; Christof Bähler: «Veloführung» in: TEC21 19/2007, S. 19–22; Astra, Stadt Langenthal: Problemstellenkataster Langsamverkehr, Erfahrungsbericht am Beispiel Langenthal, Bern 2005; Schweizerische Velo-Konferenz, Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat: Velos auf Trottoirs, Zürich und Bern 2005
[17] Astra: Veloparkierung: Empfehlungen zu Planung, Realisierung und Betrieb, Handbuch, Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 7, Bern 2008
18] Astra: Planung von Velorouten, Handbuch, Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 5
[19] Tiefbauamt der Stadt Zürich: BYPAD, Audit der Velopolitik der Stadt Zürich, Audit-Bericht und Qualitätsplan, Zürich 2008TEC21, Do., 2009.02.12
12. Februar 2009 Ruedi Weidmann