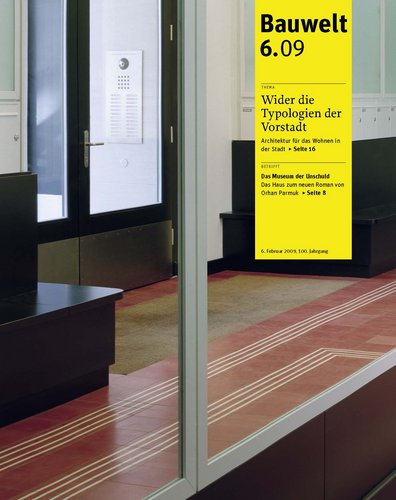Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Das harmlose Antlitz der Zerstörung. Aleksandra Polisiewicz’ „Wartopia“ | Jan Friedrich
03 imm cologne 2009/Passagen | Michael Kasiske
03 Renaturierung als Planungsstrategie | Kerstin Kuhnekath
04 Riegler-Riewe-Ausstellung | Eva Maria Froschauer
BETRIFFT
08 Das Museum der Unschuld | Olaf Bartels
WETTBEWERBE
12 Schaumagazin Abtei Brauweiler in Pulheim| Friederike Meyer
14 Neuauflage des Londoner Routemaster
15 Auslobungen
THEMA
16 Schwarzwaldblock, Mannheim | Enrico Santifaller
21 Das neue Interesse am Wohnen in der Stadt | E-Mail-Interview mit Gregor Jekel vom Difu
24 Choriner Straße, Berlin | Ulrich Brinkmann
28 Passage Goix, Paris | Sebastian Niemann
32 Otto und Alex, Chur | Hubertus Adam
REZENSIONEN
39 Housing moves on | Anne Boissel
39 Im Brennpunkt: Innenstadtwohnen | Anne Boissel
39 Kreuzschwinger | Michael Kasiske
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
06 Leserbriefe
38 Kalender
40 Anzeigen
48 Die letzte Seite