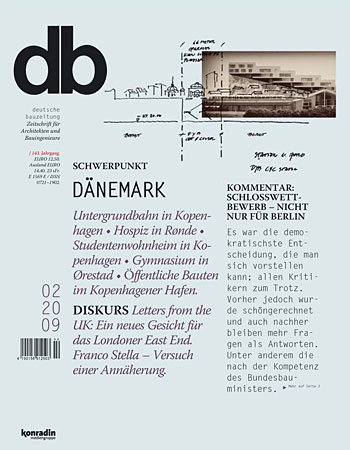Editorial
Wie überall, wo die Wirtschaft (noch) gut vorankommt, blühen die Künste, wird Wert auf Qualität gelegt und eröffnen sich Spielräume. Architektur und Design haben in Dänemark zudem Tradition, auch deshalb, weil der dänische Staat seit einiger Zeit stärker auf die Qualität von Funktion und Gestalt einwirkt als das in anderen Ländern der Fall ist. In Sachen Infrastruktur und Baukultur wird einiges geboten – hohe Steuern und eine gezielte Architekturpolitik machen es möglich. Dazu kommt ein reges Stiftungswesen, das gemeinnützige Projekte fördert und die Qualität der öffentlichen Bauten gerne als Marketinginstrument einsetzt. Ein System, das neidvolle Blicke der Nachbarn auf sich zieht, auch wenn es (noch) nicht ganz so rund läuft, als dass kritische Töne ausblieben.
Die Hauptstadtregion profitiert hiervon am meisten, die Innovationskraft strahlt aber auch in die Provinz aus. ge
Inhalt
Diskurs
03 Kommentar
Schlosswettbewerb – Nicht nur für Berlin | Nikolaus Bernau
06 Magazin
12 Letters from the UK
Ein neues Gesicht für das Londoner East End | Alex Haw
14 Im Blickpunkt
Franco Stella – Versuch einer Annäherung | Claudius Ziehr
Schwerpunkt
18 Dänemark
19 Zum Thema – Architekturpolitik in Dänemark | Clemens Bomsdorf
20 Gymnasium in Ørestad, 3XN | Ulrich Höhns
28 Studentenwohnheim in Kopenhagen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter | Bernd Hauser
36 Hospiz Djursland in Rønde, Arkitektfirmaet C. F. Møller | Dirk Evers
42 Stiftungswesen Clemens Bomsdorf
43 Anti-Hochhaus-Beschluss für Kopenhagens historisches Zentrum | Clemens Bomsdorf
44 Öffentliche Bauten am Kopenhagener Hafen Klaus Englert
52 Metro in Kopenhagen, KHR Arkitekter | Reinhart Wustlich
Empfehlungen
60 Kalender
Ausstellungen
Multiple City – Stadtkonzepte 1908 - 2008 (München) | Christoph Randl
61 Schein Werfen, Theater – Licht – Technik (Wien) | Bettina Maria Brosowsky
62 Neu in …
...Frankfurt (Main) | Franziska Puhan-Schulz
...Hamburg | Claas Gefroi
...Kopenhagen (DK) | Klaus Englert
64 Bücher
Trends
66 Energie
Solarthermische Klimatisierung | Bernhard Lenz
72 Technik aktuell
Wissenschaftswerkstatt: Das »inHaus2« in Duisburg | cf
Produkte
Produktberichte
76 Fenster, Tore, Beschläge | rm
84 Schaufenster
Fassaden | rm
Anhang
88 Planer / Autoren
98 Bildnachweis
90 Vorschau / Impressum
Experiment Schule
Die dänische Gymnasialreform verlangt von neuen Schulbauten Offenheit und Flexibilität. Im neuen Kopenhagener Quartier Ørestad wurden diese Anforderungen in ein vielschichtiges System mit fließenden Räumen, scheinbar schwebenden Lerninseln und geschwungenen Treppenlandschaften übersetzt. Entstanden ist ein Gebäude, das Spaß macht und die Schüler fördert, indem es sie fordert.
Das Ørestad Gymnasium liegt im Mittelpunkt eines Kopenhagener Stadtteils, der seit einigen Jahren auf freiem Gelände südlich der Innenstadt entsteht. Dieser 600 Meter breite und fünf Kilometer lange urbane Streifen ist eine mit Solitären unterschiedlichster Formen und Qualität besetzte Bandstadt, in der bald 80 000 Menschen arbeiten und studieren und 20 000 wohnen sollen. Der zentrale, weitgehend fertiggestellte Abschnitt »Ørestad City«, in dem sich die Schule befindet, wird von einem großen Einkaufszentrum und der weithin sichtbaren »landmark« des eleganten Ferring-Hochhauses von Henning Larsen Architects beherrscht. Die dritte an dieser Stelle im öffentlichen Raum wirksame Komponente ist die Hochtrasse der Metrolinie 1, die das Rückgrat von Ørestad bildet. Sie verläuft direkt vor der Schule, eine Station liegt in unmittelbarer Nähe. Die in kurzer Abfolge verkehrenden Bahnen verbinden Ørestad innerhalb weniger Minuten mit dem Kopenhagener Zentrum. Sie sind das allgegenwärtige Metronom dieser Handtuchstadt, verhelfen ihr zu einer gewissen metropolitanen Anmutung – und sind die Voraussetzung für ihre Funktionsfähigkeit.
Das Architekturbüro 3XN – das Kürzel steht für dreimal Nielsen – wurde 1986 in Århus gegründet und ist heute eines der erfolgreichsten dänischen Architekturbüros mit einer beeindruckenden Werkliste herausragender nationaler und internationaler Bauten. In Deutschland wurden die Architekten 1998 mit dem Bau der dänischen Botschaft in Berlin innerhalb des Ensembles der »Nordischen Botschaften« bekannt. Ihr fünfgeschossiges Gymnasium am Ørestad Boulevard an der Ecke Arne Jacobsens Allé, die hier leider als trister Wendehammer endet, reiht sich in die Struktur der Einzelbauten ein. Die Schüler kommen wie die Angestellten nebenan in ihre »Arbeitswelt«. Einer der Unterschiede zu den Nachbarn besteht darin, dass dieses Haus sein Äußeres verändern kann. Farbige, gläserne Senkrechtlamellen vor der eigentlichen Fassade erzeugen das Bild freundlich offenstehender Fenster und geben dem weißen Kubus etwas Spielerisches. Nur an der nördlichen und streckenweise auch an der östlichen Fassade verharren sie unbeweglich. Werden sie vor die Fenster gedreht, so beruhigt sich der Ausdruck des Hauses. Die mit Chiffren bedruckten Lamellen schließen dann fast plan mit den weißen Brüstungen ab, und die große Form wirkt geschlossen. Nur die etwas zurückgesetzte Verglasung der Eingangshalle und der darüber liegende hausbreite Balkon im vierten Obergeschoss zeichnen sich als markante Einschnitte ab. Die elegante Wirkung des überhohen, an drei Seiten raumhoch verglasten Erdgeschosses, auf dem der Kubus zu schweben scheint, geht an der Rückseite jedoch jäh verloren, denn hier kommt es zu einer Kollision mit einem ungestalteten flachen Parkhaus mit dem anmaßenden Namen »Kay Fisker« (der bedeutendste dänische Wohnungsbau-Architekt, 1893–1965). Ein Teil dessen Flachdaches, gegliedert durch ¬Entlüfter und Lichtöffnungen, dient der Schule als Freifläche. Auch das Flachdach der Schule mit seinen zylindrischen Aufbauten ist auf einem hölzernen Steg zugänglich.
Offenes System
Der weite, helle und luftige Innenraum der Schule, der vom Unter- bis zum vierten Obergeschoss reicht, entschädigt für alle unzulänglichen Kleinigkeiten. Das Erlebnis dieser offenen, großen Hohlform mit ihrer zentralen Treppe und den vielen Galerien ist überwältigend, aber nicht einschüchternd.
Die Orientierung im gesamten Haus ist erstklassig, und gleichzeitig entsteht Entdeckerfreude, denn es gibt keine Standardräume, die sich von Stockwerk zu Stockwerk wiederholen, stattdessen eine unglaubliche Vielfalt von Passagen, Öffnungen, Teilräumen und Nischen. Die Drehung einer jeden Ebene gegen die nächste unter Beibehalt nur weniger konstruktiv notwendiger Konstanten wie kreisrunder Fluchttreppen und Sanitärbereiche führt zu einem selten gesehenen Abwechslungsreichtum der Räume, der absolut nichts mit der statisch wirkenden Außenhülle des Hauses gemeinsam hat. Die vor vier Jahren entwickelte dänische Schulreform mit ihren Forderungen nach Offenheit, Transparenz und Eigenverantwortlichkeit für interdisziplinäres, einem Studium vergleichbaren Lernen in weitgehend hierarchiefreien Räumen findet hier ihren ersten baulichen Ausdruck. In ihm spiegelt sich das Raum gewordene Selbstverständnis eines liberalen, wohlhabenden Staates wider, der seinen Schülern bis dahin ungeahnte Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet. Die Schule und ihre Architekten sind in Dänemark deshalb berühmt. Viele Schüler finden es nach eigener Aussage »cool«, hier zu lernen, und nehmen dafür weite Wege auf sich. Etwas mehr als 1000 Schüler gibt es, für die 110 Lehrer da sind. Die Zahlen verblüffen, denn die subjektive Wahrnehmung dieses Raumwunders erklärt nicht, wie dieses Haus fast 1200 Menschen Platz bieten kann. Es gibt pro Stockwerk nur wenige abgeschlossene Gruppenräume, etwa für die Fachklassen, die wie Meisterkabinen hinter Glas und Holz an die Außenwände des Hauses gerückt sind, oder einige hermetisch verschlossene, kreisrunde Räume mit »Ruheinseln« auf ihren »Dächern«, auf denen Schüler in den Pausen auf Sitzsäcken »abhängen«, gern mit dem Laptop auf dem Schoß. Jeden Tag finden große Wanderungsbewegungen durch das Haus statt, und der Computer – die Schule ist bis in den letzten Winkel mit iMacs und iBooks ausgestattet, die auch der schnellen Orientierung auf der Suche nach dem richtigen Kurs und Raum dienen – ist allgegenwärtig. Jeder offene Raum und Teilraum dient dem Unterricht in kleinen und größeren Gruppen, mit und ohne Lehrer. Einige Schüler sind darüber nicht so glücklich, weil ihnen dann doch die Orientierung fehlt und der Lärm trotz schallschluckender Oberflächen einiger Ausbaumaterialien die Konzentration erschwert.
Die vor gut einem Jahr eröffnete Schule ist an vielen Stellen bereits abgenutzt und pflegebedürftig. Der schwarze Industriefußboden, das helle Holz der Treppen oder die weißen Wände entlang der Hauptwege zeigen Spuren der Beanspruchung und sollen vielleicht auch nicht von ewigem Bestand sein. Der große zentrale Innenraum mit Mensa und Auditorium im Erd- und Untergeschoss ist auf allen Ebenen zugleich auch ein Außenraum, der nachlässiger behandelt wird als die kleineren Innenräume. Abgegessene Teller und benutztes Besteck finden sich überall, der spätnachmittägliche Zustand der Toiletten erinnert an Autobahnraststätten während der Urlaubszeit.
Was den Energiehaushalt der Schule betrifft, so sind die Aussagen unpräzise. Dies ist offenbar (noch) kein wirkliches Thema für die gegenwärtige dänische Architektur. Das Haus ist an das Fernwärmenetz angeschlossen, die Wärmedämmung entspricht dem nationalen Standard, und natürlich schützen die drehbaren Glaslamellen vor der Sonne, die in Dänemark aber nicht so heiß und immer willkommen ist. Im Grunde geht es bei diesen Elementen nicht nur um Fragen der Energieeffizienz, sondern auch um den Spaß am veränderlichen Dekor der Außenhaut mit einer Vielzahl von Lichtbrechungen und Farbspielen.
Der hohe inhaltliche Anspruch und der freie Geist dieser dank ihrer Offenheit wegweisenden Schule, die ihren Benutzern ein unvergleichliches und prägendes Raumerlebnis bietet, sind die eigentlichen Grundlagen für ihre nachhaltige Wirkung.db, Di., 2009.02.03
03. Februar 2009 Ulrich Höhns
verknüpfte Bauwerke
Ørestad Gymnasium
Verflechtung und Ausbau
(SUBTITLE) Untergrundbahn »Metro« in Kopenhagen
Die vollautomatische Kopenhagener U-Bahn wurde 2002 eröffnet und wird seither stetig ausgebaut. Die Linienführung folgt den zentralen Entwicklungsachsen – sie ist integraler Bestandteil der Stadtentwicklung. Alle Haltestellen – unter wie auch über der Erde – sind in klassisch-funktionalem skandinavischen Design gehalten und machen die Verkehrsbauten als öffentlichen Stadtraum erlebbar.
Der Manager, der zwischen Århus und dem Flughafen Kastrup pendelt, die Kulturinteressierte, die vom Louisiana-Museum in Humlebæk Umsteigebahnhof Nørreport zurückfährt, die Sonnensüchtigen, die von Amager Strand zurückkehren, die Pendlerin aus Malmö, die nach 26 Minuten Zugfahrt Ørestad erreicht – sie alle nutzen den Kopenhagener Verbund von Regionalbahn, S-Tog (S-Bahn) und Metro, der sich wie ein Spinnennetz über die Metropol-Region spannt. Das Mare nostrum heißt hier Øresund, und seit der Eröffnung der Øresund-Verbindung (2000, Meerestunnel- und Brückenverbindung nach Schweden) wachsen Kopenhagen und Südschweden auch per öffentlichem Nahverkehr zu einer Region zusammen
Der Blick auf die Karte zeigt im Norden die enge Seepassage zwischen Seeland und Skåne (Schonen), vom Städtedoppel Helsingør und Helsingborg flankiert. Die Planer der Raumordnung kritisieren, dass hier die Verbindung der beiden Länder nicht vorankommt – und so der südliche Ballungsraum überproportional wächst, nämlich das metropolitane Schwergewicht der Hauptstadtregion Kopenhagen mit 1,6 Mio. Einwohnern, von denen 510000 auf die Hauptstadt selbst entfallen.
Die südöstlich vorgelagerte Insel Amager mit 160000 Einwohnern fasst den Kopenhagener Hafen ein und bildet geografisch den Übergang nach Schweden. Auf der anderen Seite des Sunds liegt Malmö mit seinen 25 8000 Einwohnern. Seit der Eröffnung der Øresundquerung ist Calatravas 190 Meter hoher Turning Torso (2005) zur gemeinsamen Landmarke geworden, versteht sich auch der südliche Teil des Sunds als »Doppelstadt«, deren Häfen als »Copenhagen Malmö Port« firmieren, deren Universitäten sich zusammenschließen.
Metropolitane Struktur
Die Øresund-Region ist seit 2000 auf Wachstumskurs. Sie weist jährlich drei Prozent mehr Bruttoinlandsprodukt aus, die Bevölkerungszahlen werden von 3,6 Mio. auf prognostizierte 4,0 Mio. Einwohner in den kommenden zwanzig Jahren steigen[1]. Die Region will hohe Standards in die internationale Städtekonkurrenz einbringen, etwa einen modernen, leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr.
Lange vor der Krise, die jetzt London, New York und andere Global Cities in der Entwicklung stagnieren lässt, konnte das große »ABC« der kleineren europäischen Metropolen Amsterdam, Barcelona und Copenhagen internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen: beste Ausbildung junger Eliten, internationale Offenheit, hohes Einkommensniveau, exquisite Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungssektoren, Freizeitangebote in Kultur und Landschaft, die selbst US-Firmen anlocken.
Im Entwicklungskonzept der »Doppelstadt« gewinnt die 96 Quadratkilometer große Insel Amager mit ihren traditionellen Industrie- und Raffineriestandorten, alten Arbeiterquartieren, den Gemeinden Tårnby und Dragør und dem skandinavischen Luftverkehrszentrum (dem Großflughafen Kastrup) an Bedeutung: Seit 2000 entsteht hier die Neugründung Ørestad, eine Bandstadt mit vier Distrikten – entlang der Trasse des südlaufenden Zweigs der Metro, der 2002 eröffnet wurde. Bezeichnenderweise ist die Ørestad-Entwicklungsgesellschaft auch Träger des neuen Metro-Systems.
Der zweite Zweig der Metro, in einigem Abstand zur Küstenlinie am Sund geführt, hat den Flughafen zum Ziel. Für die internationale Klientel, die das schnelle, bequeme Transportmittel annimmt, ist der Zugangsbahnhof (die Endhaltestelle Lufthavn) eher nüchtern-standardisiert, der Bergstation einer Seilbahn nicht unähnlich. Der Betrieb ist vollautomatisiert, Fahrpläne finden sich keine. Schnell wird klar, dass führerlose Kurzzüge in knappen Intervallen fahren, in der Rushhour im Abstand von zwei Minuten.
Das von KHR Arkitekter, Kopenhagen, entwickelte Design soll skandinavisch kühl und minimalistisch erscheinen. Vom Flughafen bis Lergrafsparken verläuft die Fahrt auf einer aufgeständerten Trasse – man ist gespannt, wie sich das System nun endlich im Untergrund anfühlt; wahre Überraschungen sind kaum zu erwarten.
Doch dann kommen, wie große Aquarien, die ersten Stationen in Sicht, Schaufenster in den beleuchteten Tunneln, Bahnsteige, von Glas umschlossen, dahinter im hell, klar gegliederten, übersichtlichen Raum die »Ausstellung« der Wartenden (Objekte von Duane Hanson?). Kürzer als erwartet, nur 67 Meter lang, wirken die Zugangsebenen in 18 und mehr Metern Tiefe unter der Stadt eher wie Foyers des einen großen Veranstaltungsraums, der Kopenhagen heißt. Tatsächlich öffnen sich die Schiebetüren der Waggons und der gläsernen Stationswände parallel, ein nicht unbeträchtlicher Sicherheitsaspekt. Dann merkt der Fahrgast, dass die Atmosphäre, die ihn positiv einstimmt, mit der Lichtmischung zu tun hat – Tageslicht aus Glasprismen auf Straßenniveau und ein präzises Lichtdesign, das Funktionen lesbar macht: die großen Plastiken der Rolltreppen, den Drift nach oben, die Spiegelungen, die ihn auf dem Weg nach oben begleiten. Während sich unten Schiebetüren schließen, Schall sich gedämpft entfernt, Helligkeit bleibt: ein Foyer, kein finsterer Nicht-Ort.
Metro-Town Ørestad
Die ersten Pioniergebäude gab es in Ørestad 1999, schon 2001 folgte die erste Industrieansiedlung. Der weitere Ausbau soll 15 bis zwanzig Jahre dauern. Heute leben hier bereits 3500 neue Einwohner (sechzig Prozent von ihnen unter vierzig Jahre alt), während die Zahl der angesiedelten Arbeitsplätze von 8000 auf 10000 wächst. Ziel: Wohnungen für 20000 Einwohner, zugleich aber 60000 bis 80000 Jobs.
Ørestad-Nord, das am weitesten fortgeschritten ist, wird von den Universitäten geprägt. Ihm dienen die Stationen Islands Brygge (in Tieflage) und DR Byen/Universität, die wieder herausgehoben an der Hochbahntrasse liegt. Dieser Bereich ist nicht nur tägliches Ziel von Tausenden von Studenten (neue IT Universität, siehe db 8/2005: 1600 Studenten; Universität Kopenhagen, Campus Amager – allein bei den Humanwissenschaften 11500 Studenten). Die Station DR Byen bindet die »Kasbah« des Dänischen Rundfunks an, ein Multimedia-Zentrum – u. a. mit einer 1800 Plätze fassenden Konzerthalle (Ateliers Jean Nouvel, Eröffnung: Januar 2009).
An der zentralen Station Ørestad markiert ein zwanziggeschossiger Turm (Henning Larsen Architects) den Kreuzungspunkt mit der Regionalbahn zum Flughafen und zur Øresund-Verbindung. Die schwarze Landmarke des Pharmazie-Konzerns Ferring ist noch von Malmö aus sichtbar. In der Nachbarschaft schließen Perlenketten-Projekte an wie Ørestad Gymnasium (2007, siehe Seite 20), expressive Wohnprojekte wie der VM Mountain (2008, siehe Seite 63); dazu ein großes Einkaufszentrum, neue Cityblöcke zum Wohnen (bis zu zwölf Geschosse hoch), dazu gewerbliche Ansiedlungen, die allein hier 20 000 Arbeitsplätze schaffen sollen.
Mit Downtown (Planung: Daniel Libeskind) und Ørestad-Süd (Planung: ARKKI aps, ein Joint Venture von APRT, Helsinki, den Autoren des städtebaulichen Masterplans von 1994 und KHR, Kopenhagen) folgen die größten Entwicklungsbereiche erst nach.
Metro im Stadtwandel
Im Übrigen greifen alte städtebauliche Bestände und neue Standorte über die Infrastruktur ineinander, verändern sich wechselseitig zu Linienstrukturen. Das ältere S-Bahn-System, seit 1934 entwickelt, ab 2005 zum letzten Mal erweitert, verzweigt sich strahlenförmig nach Nord- und Südwesten, die Metro auch nach Westen, indem sie die historische Altstadt im Bogen nördlich unterfährt. Ihr gelten die Investitionen der Zukunft, da bis 2018 ein zusätzlicher Ring um die Kernstadt gelegt werden soll, der auch die nördlichen Entwicklungsbereiche des Hafens nahe dem Amerika Plads und dem Bereich Langeliniespitze/Marmorkai (dem Wettbewerbsstandort von Steven Holls Hafentorkomplex) anbindet.
Nach Westen liegen als Verknüpfungspunkte die Station Kongens Nytorf (im Einkaufs- und Touristenzentrum) und der Bahnhof Nørreport direkt am Rande der Fußgängerzonen, der zwischen der Gründerzeitvorstadt jenseits der grünen Zone der Contrescarpe und der Altstadt vermittelt. Er ist der zweitgrößte Knotenpunkt des metropolitanen Nahverkehrs. Auf mehreren Ebenen kreuzen sich die Trassen von Staatsbahn, S-Bahn und Metro.
Ab Fasanvej steigt die Trasse aus der Tunnellage erneut auf und führt stadtauswärts. Flintholm Station wurde wiederum zum Kreuzungspunkt mit der S-Bahn ausgebaut, die hier einerseits weiter in die Region ausschwenkt, andererseits den weiten Bogen des westlichen S-Bahn-Rings bildet. Auf acht Stahl-Pylonen ruht ein 5000 Quadratmeter großes Glasdach, das alle Einrichtungen des neuen Bahnhofs (2004, Architekten: KHR Arkitekter A/S – DSB Arkitekter) zusammenfasst. Die Dänischen Staatsbahnen prognostizieren, dass Flintholm Station in absehbarer Zeit allein 45 000 Fahrgäste täglich für die S-Bahn aufnehmen wird. Unmittelbar nach Osten schließt Flintholm Urban Center an, Quartierszentrum für ein Konversionsgebiet, dessen Areal gleichfalls industriell besetzt war.
Gestalterisch ähnelt der Kopenhagener Standard etwa der Metro in Bilbao (Foster and Partners). Der Vergleich mit den älteren Kopenhagener Bahnhöfen der S-Bahn, etwa in den Tunnellagen von Nørreport macht den Fortschritt deutlich: Die freundliche Stadtatmosphäre wird bis in den Untergrund ausgeweitet – nicht umgekehrt. Die internationale Konferenz Metrorail wählte die Kopenhagener U-Bahn 2008 zur »besten der Welt« – Zuverlässigkeit, Frequenz, Kundenzufriedenheit, Sicherheit.
[1] Bundesagentur für Außenwirtschaft (11/2008): Die Øresund-Region erwirtschaftet gegenwärtig bereits ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts der Länder Dänemark und Schweden; innerhalb der nächsten zwanzig Jahre, so die Prognosen, wird die Region einen Wert erreichen, der bereits der Hälfte des gesamten schwedischen Bruttoinlandsprodukts entsprechen wird.db, Di., 2009.02.03
03. Februar 2009 Reinhart Wustlich