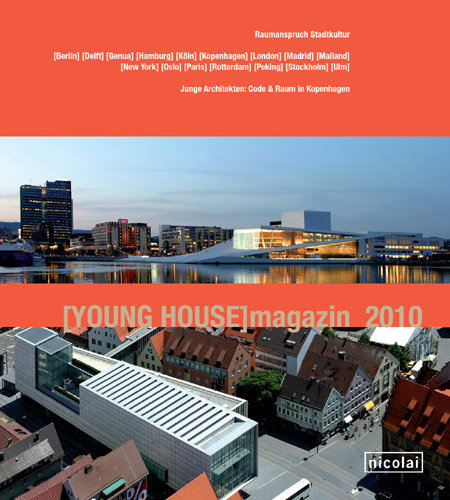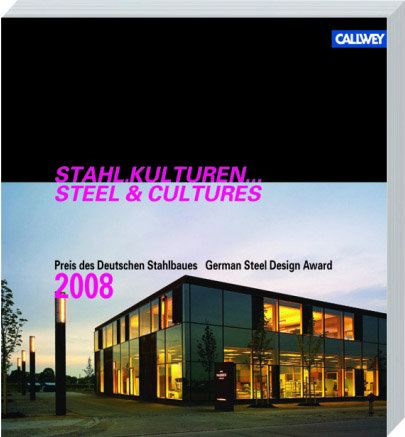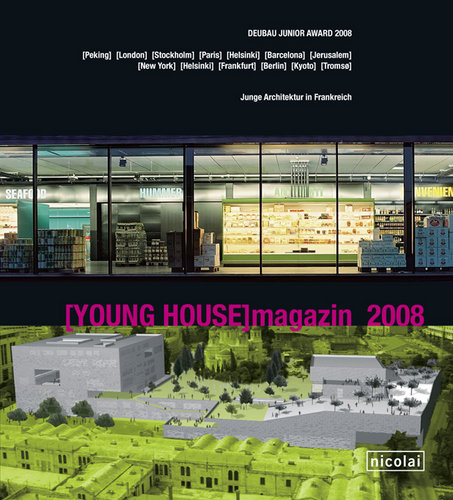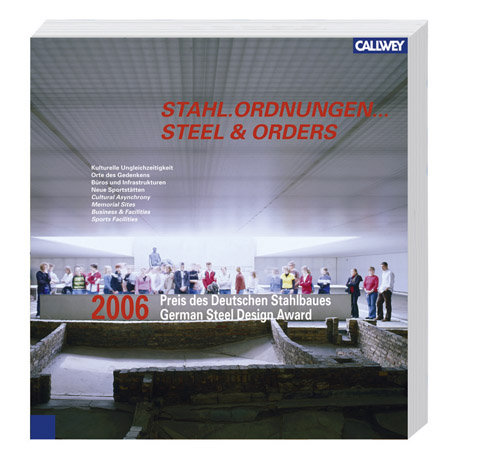Haus Mayer-Kuckuk in Bad Honnef
Weitgehend vorgefertigt wurde das Einfamilienhaus 1967 innerhalb von sechs Tagen errichtet. Seine entlang der Längsfassaden sichtbare, gestalterisch überhöhte Tragstruktur aus Holz verhilft ihm zwar zu seiner Unverwechselbarkeit, ist aber auch Ursache großer Bauschäden. Dank einer umfangreichen Sanierung im Jahr 2016 legt es weiterhin Zeugnis vom Strukturalismus in Deutschland ab.
Weitgehend vorgefertigt wurde das Einfamilienhaus 1967 innerhalb von sechs Tagen errichtet. Seine entlang der Längsfassaden sichtbare, gestalterisch überhöhte Tragstruktur aus Holz verhilft ihm zwar zu seiner Unverwechselbarkeit, ist aber auch Ursache großer Bauschäden. Dank einer umfangreichen Sanierung im Jahr 2016 legt es weiterhin Zeugnis vom Strukturalismus in Deutschland ab.
Ein bemerkenswerter Fall: Alle Teile, aus denen das Gebäude 1967 wie aus einem Baukasten errichtet wurde, sind konventionell. Dennoch bezeichnete ein Fördervertrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz das Objekt 2014 in seiner Essenz als »utopistische technoide Innovation«. Ein Raumtragwerk aus überkommenen Elementen: Punktfundamente, Metallschuhe als Stützenfüße, Pfosten und Tragbalken der Decken und des Dachs als Leimbinder, Andreaskreuze aus diagonal gespannten Stahlstäben, Ausfachungen der Außenwände als Sandwich-Tafeln, Flügeltüren in den Wandöffnungen etc. Auch das Subthema des Gebäudes, die elementierte Vorfertigung in Serie, geht auf historische Entwicklungen wie die Elementierung der Ständerbauweise zurück. Technoide Innovation?
Das Gebäude, das diese Widersprüche auf so anregende Weise vereint, ist das Haus Mayer-Kuckuk. Vor 50 Jahren in Bad Honnef am Rhein errichtet, sollte es bereits nach 25 Jahren als Denkmal eingetragen werden. Der Rat der Stadt sperrte sich, doch 2007 wurde das Gebäude auf Antrag der Eigentümer doch unter Denkmalschutz gestellt und 2016, nach akribischer Sanierung, erhielt es den alle zwei Jahre vergebenen Rheinisch-Westfälischen Staatspreis für Denkmalpflege.
Ein Gespräch des Architekten Wolfgang Döring mit dem Architekturhistoriker Heinrich Klotz (»Architektur in der Bundesrepublik«, 1977) offenbart weitere interessante Widersprüche: Auf die Feststellung des Interviewers, das Aussehen des Hauses negiere die üblichen Erwartungen an ein Einfamilienhaus, und die Frage, warum das Haus Mayer-Kuckuk diese Form habe, antwortete der Architekt: »Das Aussehen des Hauses hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert.« Mit dieser, die Haltung zum Werk wie zum Auftraggeber eher strapazierenden Behauptung eröffnet Döring ein Katz-und-Maus-Spiel.
Tatsächlich erfolgt der Ausbruch aus der Konvention dadurch, dass die konstruktiven Prinzipien demonstrativ ausgestellt, wörtlich: vor die schützende Raumhülle des Gebäudes gestellt und die Verbindungen des Raumtragwerks, die Knoten der Zangenkonstruktionen, gestalterisch überhöht werden. Der Effekt entsteht dadurch, dass die Verbindungsmittel der Knoten – trapezförmige Platten, die eher dem historischen Stahlbau entlehnt scheinen – als Sperrholzdreiecke überdimensioniert angelegt sind. Döring: »Ich habe natürlich ein bisschen übertrieben, sie sind eine Idee zu groß.« So ist es der Zeichencharakter der weißen Trapeze, ihr serielles Hinter- und Übereinander, das die ungewöhnliche Signalwirkung des Gebäudes begründet. Und es sind die schmalen, festverglasten Bänder zwischen den Balkenlagen, die Lichtschlitze, die das Flächenhafte der Wände aufbrechen. Die 60er Jahre sind die Zeit der Op Art, der Erfolge der Minimal Art: der skulpturalen Raumstrukturen, Gitter- und Rasterkonstruktionen – der »serials« Sol LeWitts und der formalen Strenge Donald Judds.
Dörings Einlassung, »die Form ergab sich eigentlich nur aus der Konstruktion«, ist eine Behauptung, der Klotz nicht folgt: »Es kam Ihnen sehr darauf an, die Konstruktion zu zeigen (...). Ist das nicht eine Ästhetisierung konstruktiver Momente?« Während Döring auf der Erfüllung der Zwecke beharrt, der konstruktiven Funktion des Raumtragwerks, folgert Klotz: »Aber es sind doch die Einzelheiten, die das Haus interessant machen, denn sonst wäre es ja tatsächlich eine Baracke geworden.« Und Döring: »Danke, meine Häuser sind keine Baracken.«
Dass der Architekt diese Anmutung zurückweist, ist verständlich. Die Empfindung des Leichten, Schwebenden wie bei einem Pavillon geht auf »einen Satz einfachster Bauelemente zurück, eine Versuchsanordnung für ein kulturelles Experiment« (Kurt W. Forster). Bei dem, wie Klotz meinte, durchaus dramatisiert wurde. Und Döring: »Das muss man auch tun, so verantwortungsvoll muss ein Architekt sein, dass es eben keine Baracke wird.« Der Pavillon – ein Nachklang nomadischen Bauens, Ausdruck einer »intellektuellen Sehnsucht nach dem Leichten, Provisorischen, dem noch nicht einbetonierten Leben« (Dieter Hoffmann-Axthelm).
Man kann Mies van der Rohe zitieren. Zur Wirkung von Hochhäusern erklärte dieser, nur in der Bauphase offenbarten sie die mutige, bauliche Idee ihrer aufstrebenden Struktur, den überwältigenden Eindruck. Sobald die Fassade bekleidet sei, werde die kühne »Sensation« vernichtet. Gab es Wege, eben diese Anmutung sichtbar zu erhalten? Bereits in der Frühzeit des Hightech, bei Norman Foster und Richard Rogers, finden sich Entwurfsstrategien, die auf diese Sensation setzen – etwa bei der »Reliance Controls Electronics Factory« in Swindon (1965-1966), deren Konzept der Vorfabrikation von Stahlelementen, dem »structural steelwork« galt. Dem Raumtragwerk aus seriellen Komponenten, die nach außen (mit diagonalen Auskreuzungen) wie nach innen ausgestellt wurden: ein Spiel, das am Pariser Centre Pompidou expressiv überhöht wurde.
Was beim Stahlbau weniger riskant erschien, später aber zunehmend höhere Erhaltungsinvestitionen verursachte, durfte beim Bauen mit Holz kaum ohne Vorkehrungen des konstruktiven Holzschutzes realisiert werden – zumal dann, wenn das Material Leimholz so frivol zur Schau gestellt wurde. War doch dessen Widerstandsfähigkeit gegen wechselnde Feuchte wie durch die Verwendung von Nadelhölzern begrenzt. Konnte den Bewohnern allein die Verantwortung überlassen werden, den Holzschutz in den jährlichen Lebensablauf zu integrieren wie die Gartenpflege?
Dass bereits mit der Konstruktion die Geschichte der späteren Sanierung, die Herausforderung der Erhaltung begründet wird, zeigt, dass »das Provisorische nicht leicht zu haben« (Hoffmann-Axthelm), das »Bild der Leichtigkeit« nur unter enormem Aufwand zu erhalten oder wiederherzustellen ist.
Dass der ideelle Zustand des Gebäudes gesichert werden konnte, war längere Zeit ungewiss. Während die Bauzeit 1967 gerade eine Woche betragen haben soll, ließ die Sanierungsphase das Haus fast ein Jahr lang unbewohnbar. Eine Dokumentation zeigte in großem Umfang Zerstörungen durch Pilzbefall, Strukturschäden der Hölzer, Fehlstellen, die sich insbesondere an den Balkenköpfen der Knoten – den neuralgischen Punkten der Aussteifung des Raumtragwerks gegen die Wind- und Querkräfte häuften. Massive Schädigungen wurden auch während des Ersatzes des Tragwerks entdeckt, etwa unter den Fensteröffnungen. Bei der Reparatur bedurfte es erheblicher Korrekturen im Detail: nur mit besseren Materialien und umfassendem Holzschutz – wozu auch Blechabdeckungen der Balken- und Knotenköpfe gehörten – war das Haus langfristig zu sichern. Aufwendig war nicht nur der Austausch der einzelnen Felder des Raumtragwerks, Achse für Achse, sondern auch die Stabilisierung des Gebäudeganzen während des Herauslösens, Zerlegens und Einfügens der neuen Balkenlagen von Hand. Herausziehen und Durchstecken beschreiben eher unzulänglich, dass die Träger von den Dach-, Decken-, Bodenelementen und Innenwänden gelöst, die in den Zangenlagen geführten sanitären und elektrischen Installationen demontiert werden mussten. Die Reparatur des wohnlichen Raumensembles erforderte allein im Innern an die fünf Monate Bauzeit. Die Eigentümer, beispielhaft in ihrem Engagemen, das außerordentliche strukturalistische Werk zu erhalten, kommentierten das Abenteuer eher lakonisch: »Bei Experimentalbauten werden tradierte Regeln schon mal außer Acht gelassen.«
db, Fr., 2017.06.02
verknüpfte Zeitschriften
db 2017|06 Anders bauen